
Die Krefelder Wählerschaft hat am 14. September entschieden. Jetzt überlegen die gewählten Vertreter, wie sie den Auftrag der Wähler am besten umsetzen. Es könnte Koalitionen geben. Klimaschutz ist unverändert wichtig, um die stete Verschlechterung der Lebensbedingung auf diesem Planeten aufzuhalten, wie man fast täglich in den Nachrichten lesen kann und die Wissenschaft belegt (siehe Blog 65). Damit es nicht an konkreten Ideen mangelt: Hier sechs Krefelder Projekte, die im Laufe der Legislaturperiode umgesetzt werden könnten. Es gibt noch viel mehr zu tun. Dazu ist manches in den bestehenden Klimaschutzplänen der Stadt festgelegt. Mit diesen stehen die hiesigen Vorschläge nicht in Konflikt. Aber ich denke einige „große“ Leuchtturmprojekte könnten zusätzlich motivierend sein – für politische Vorkämpfer und auch für die Bürger. (Die meisten sind übrigens für die Stadt kaum budgetrelevant).
Projekt 1) Wärmeplan Krefeld beschließen: Die Fachleute der Stadt Krefeld, der SWK, der NGN und des Beratungsbüros Drees&Sommer arbeiten seit zwei Jahren intensiv daran. Die Wärmeplanung ist schon weit gediehen. Im Umfeld der Wahlen wurde es ruhiger. Aber hinter den Kulissen schreitet die wichtige Grundlagenarbeit fort. Eine solide Entscheidungsbasis ist geschaffen. Es wird jetzt noch abzuwarten sein, welche Rahmenbedingungen die neue Bundesregierung setzt. Dann kann die Wärmeplanung für Krefeld beschlossen werden. Dies ist wichtig, denn viele Akteure stehen in den Startlöchern, in die Energiewende zu investieren (Hausbesitzer und Wohnungsgesellschaften mit Heizungstausch und Sanierung, SWK/NGN mit Netzausbau und Fernwärmeplanung etc., Anbieter mit Investitionsplanungen, .....). Auch wenn die Wärmeplanung nicht rechtlich verbindlich ist, ist sie doch für viele Akteure eine bedeutsame Entscheidungsgrundlage. Zudem muss sie nach jetziger Gesetzeslage ohnehin bis zum 30. Juni 2026 verabschiedet werden. Jeder Monat früher spart CO2-Emissionen.
Projekt 2) 19 Windkraftanlagen auf den Weg bringen: Windkraft ist das „Arbeitspferd der Energiewende“ (siehe Blog 41). Sie bläst auch nachts, wenn die Sonne nicht auf die Solaranlagen auf den Dächern scheint. Zudem brauchen Windkraftanlagen weniger Fläche als Freiflächensolaranlagen, stören die Landwirtschaft kaum. Sie fördern lokale Wertschöpfung und Energieunabhängigkeit. Über die gesetzliche Kommunalbeteiligung würden die Anlagen sogar viele hunderttausend Euro für kommunale Projektefreisetzen. 19 Standorte in Krefeld wurden in den im Klimaausschuss vorgestellten Untersuchungen für besonders prüfungsbedürftig erachtet. Für möglichst viele sollten kurzfristig Investitionszusagen und Bauanträge auf den Weg gebracht werden. Dafür braucht es für die Investoren vor allem auch verbindliche Perspektiven der Politik.
Projekt 3) Geothermales Fernwärmenetz Hüls Zentrum: Die Wärmeversorgung von Hüls Zentrum ist nicht leicht. Die verdichtete Bebauung spricht für ein Fernwärmenetz, die Anbindung an das vorhandene Netz ist aber schwierig. Auf Wasserstoff zu hoffen ist ein gefährliches und teures Glücksspiel. Da trifft es sich gut, dass der Geologische Dienst bei der Probebohrung am alten Stadthaus Anfang 2025 für Geothermie gut geeignete Kalkschichten gefunden hat. Diese Schichten „verkippen“ Richtung Hüls in die Tiefe, was deutlich mehr Wärme bedeutet. In 2000 m Tiefe sollten es 70 Grad sein. Das wäre hervorragend für Fernwärme. Zusätzlich testet der Geologische Dienst derzeit in Kempen die Eignung des Untergrundes für Wärmespeicherung (siehe Blog 57). Ideale Voraussetzungen also für ein emissionsfreies lokales Fernwärmenetz! Das Gebiet soll im Rahmen der Wärmeplanung als Prüfgebiet näher untersucht werden. Dies sollte intensiv gefördert werden. Eine lokale Seismik wäre nötig. Die gegenseitige Blockierung von Erkundungsberechtigtem und SWK sollte überwunden werden.
Projekt 4) Unterstützungsportfolio für Sanierung, Heizungstausch und lokale Netze: Wer sein Haus energetisch sanieren will, läuft derzeit von Pontius nach Pilatus. Viele trauen sich gar nicht anzufangen. Die Planung und Koordination lokaler Wärme- oder Kältenetze, die sich in vielen Bereichen lohnen würde, ist noch schwieriger. Was gebraucht wird, ist ein Netzwerk aus Beratern, Koordinatoren, Finanzinstituten und Anbietern, welches niedrigschwellig „individuelle Komplettpakete“ entwickeln hilft. Viele Städte machen Schritte in diese Richtung („One-Stop-Shops“, Sparkassenkooperationen etc.), von denen man lernen kann. Akteure wie Stadtverwaltung, SWK, Berater, Verbände wie „Haus und Grund“, Sparkassen, Installateure können solch ein Konzept gemeinsam entwickeln. Die Politik sollte dies auf den Weg bringen und unterstützen.
Projekt 5) Abwasserwärmeprojekte Krefeld: Mit dem Abwasser fließt derzeit warmes Wasser in den Rhein. Die Wärme könnte genutzt werden. Die SWK haben dazu schon die Möglichkeit einer Großwärmepumpe im Zu- oder Ablauf des Klärwerkes untersucht. Eine zweite Möglichkeit ist die Nutzung der Wärme in lokalen Hauptsammlern für die Fernwärme oder lokale Netze. Dazu hat die KBK schon Überlegungen angestellt. Für die Umsetzung könnte Rückenwind aus der Politik helfen.
Projekt 6) Umsetzung der Radwegeplanung Krefeld: Das ist eigentlich ein „alter Hut“ und als Rahmenplan am 6. Mai 2025 im Rat beschlossen. Es kommt aber schwer voran. Einzelmaßnahmen müssen beschlossen werden, Voraussetzungen für die Umsetzung geschaffen werden. Da ist politischer Nachdruck gefragt. Über den Nutzen der Radverkehrsförderung für Aufenthaltsqualität, Gesundheit und Klima sind sich doch eigentlich alle einig.
In verstreuten Blogs werde ich in den nächsten Wochen einzelne Projekte noch detaillierter unter die Lupe nehmen.
Es würde mich freuen, wenn diese Aufstellung dazu motivieren könnte, Energiewendeprojekte trotz knapper Kassen (obwohl wir doch langfristig dadurch sparen!) und scheinbar nachlassender Priorität in der öffentlichen Wahrnehmung weiter voranzutreiben. Immerhin halten in Umfragen unverändert über die Hälfte der Befragten Klimaschutz für sehr wichtig. Vielleicht verlassen sich inzwischen zu viele darauf, dass das Bewusstsein dafür auch bei allen Entscheidungsträgern angekommen ist und die Umsetzung auf dem Weg ist. In Krefeld sind wir dafür eigentlich in einer sehr guten Position. Wir dürfen nur nicht erlahmen!
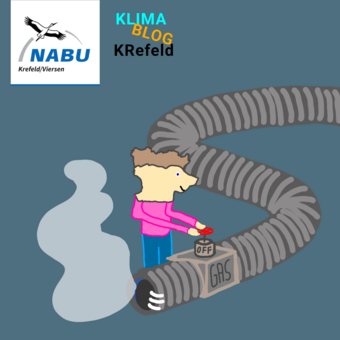
Nur eine Woche nachdem ich Blog 66 zur Stilllegung von Gasnetzen online gestellt hatte, erschien am 11.09.2025 in der Zeitschrift „Zeitung für Kommunale Wirtschaft“ ein Interview mit den Geschäftsführern der Netzgesellschaft Niederrhein mbH (NGN), Herrn Christof Epe und Herrn Hans-Werner Leenen, zum gleichen Thema: https://www.zfk.de/unternehmen/nachrichten/gasnetz-waermewende-regulierung-stadtwerke-bundesnetzagentur - vermutlich zugangsbeschränkt. Da es wichtige Stimmen aus Krefeld sind, die noch viele weitere interessante Gesichtspunkte aufwerfen, versuche ich hier eine Zusammenfassung der wesentlichen Gedanken.
Worum geht es in dem Interview?
Anlass für das Interview ist die unzureichende Rechtslage der Gasnetzstilllegung. In Blog 65 hatte ich sehr allgemein erwähnt, dass es zwar kleinere Anpassungen der Rahmengesetzgebungen gegeben hätte, dass aber noch Details zu regeln seien. Herr Epe und Herr Leenen formulieren dies sehr viel deutlicher: Die Rechtslage reiche für eine geordnete, wirtschaftliche und soziale Stilllegung nicht aus!!!
Die Ausgangslage wird dazu in Interview und Blog vergleichbar formuliert: Durch Umstieg von Kunden auf andere Energieträger werden die Benutzer des Gasnetzes ausgedünnt. Wenn aber das ganze Netz erhalten werden muss, werde dies für den Rest der Nutzer immer teurer. Nach jetziger Rechtslage könne der Netzbetreiber bei der weiteren Entwicklung nur zusehen. Aufgrund der Anschlusspflicht könne er keinen Kunden von sich aus vom Netz nehmen – auch nicht mit Vorlaufzeit – und damit keinen Einfluss auf das Fortschreiten der Stilllegung nehmen. Man könne nicht stadtteilscharf reagieren und Teilnetze stilllegen. Man müsste das ganze Netz erhalten und damit unnötige und teure Doppelstrukturen schaffen. Und es gibt noch weitere widersprüchliche Regelungen: Die Gesetzeslage erfordere z.B. auch, dass laut Methanemissionsverordnung auch weiterhin Gasspürer ausgebildet und eingestellt werden müssten, um durch Berentung ausscheidende KollegInnen zu ersetzen. Das sei wirtschaftlich ebenfalls nicht sinnvoll.
Konkrete Beispiele werden erläutert
So gebe es in Krefeld Bereiche, in denen noch ältere Gasleitungen aus verschraubtem Stahl lägen, die einen erhöhten Betriebsaufwand erforderten. Es wäre wirtschaftlich sinnvoll, diese zuerst stillzulegen. In Villengebieten lägen oft modernere Netze. Dort wohnen aber tendenziell finanzstärkere Menschen, die leichter auf andere Energieträger umsteigen können; sie können damit auf Preissteigerungen reagieren. Dies leitet über zu der wichtigen sozialen Frage, dass sich gerade in den Bereichen, wo technisch-wirtschaftlich eine Stilllegung des Netzes prioritär wäre, eher Menschen wohnen, die sich den Umstieg auf eine Wärmepumpe weniger leisten können. Sie leiden dann besonders unter Preisanstiegen durch Ausdünnung. Hinzu kommen die Fernwärme-Vorranggebiete, bei denen man sicherlich ebenfalls frühzeitig Teilbereiche des Gasnetzes stilllegen sollte, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Schließlich erwähnt Herr Leenen auch noch Kunden, die jetzt oder in Zukunft Biogas beziehen wollen. Mit Fortbestehen der Anschlusspflicht könnten sie das an jedem Ort erzwingen und damit auch die Aufrechterhaltung eventuell völlig unwirtschaftlicher Teilnetze.
Wie kann es weitergehen?
Herr Epe sieht drei Möglichkeiten: „Die erste Option ist eher dirigistisch. Hier würde der Gesetzgeber klare Regeln setzen, was in welcher Zeit wo zu passieren hat.“ Die zweite Option wird favorisiert: Hier erhielte der Netzbetreiber vom Gesetzgeber die Möglichkeit, einen klaren Plan mit Stilllegungszielen für jeden Stadtteil zu erarbeiten. Die dritte Möglichkeit sei ein Fortbestand der vagen Regeln. Damit könnte der Kunde weiter entscheiden. Dies aber wäre mit Sicherheit „für alle Beteiligten die teuerste“ Variante.
Sollte der Gesetzgeber dem Netzbetreiber die Möglichkeit zur intelligenten Steuerung geben, so könnten – auf der Basis der bereits begonnenen Wärmeplanung – detaillierte Stilllegungspläne erarbeitet werden, wie dies Winterthur in der Schweiz gemacht hat (siehe Blog 66). Dann könnte man in technisch und wirtschaftlich sinnvollen Teilnetzbereichen die Bürger gezielt ansprechen, bezüglich Alternativen beraten und evtl. sogar Preisanreize zum Umstieg setzen. Ultimativ kann in Einzelfällen auch ein Abschalten von Gasanschlüssen zum Tag X in den Raum gestellt werden. Unmissverständlich machen Herr Epe und Herr Leenen aber klar, dass die Netzsicherheit in allen Bereichen bis zur kompletten Abschaltung eines Teilnetzes oberstes Gebot ist.
Für alle Varianten wäre es wichtig, dass bald eine gesetzliche Grundlage geschaffen würde, damit eine ausreichende Vorlaufzeit für Planung, Beratung und zur Umsetzung bleibt. (Aus meiner Sicht gehört dazu auch eine rasche Verabschiedung der Wärmplanung durch den Stadtrat). Die Bürger müssen sich auf die Entwicklungen einstellen können. Akzeptanz entsteht, wenn überzeugend vermittelt werden kann, dass ein geordneter Gas-Ausstieg für alle Betroffenen das Beste ist.
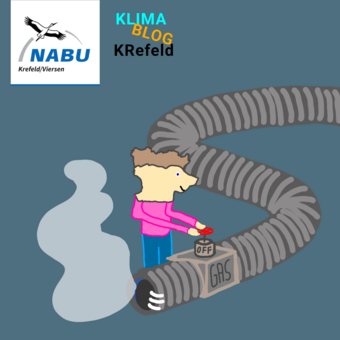
Krefeld verfügt über ein gut ausgebautes Gasnetz von 1062 km Länge. Ab 2045 soll aber Erdgas bundesweit nicht mehr für Heizzwecke verwendet werden. Das ergibt sich aus dem Klimaschutzgesetz (KSG) in Verbindung mit dem Gebäude-Energie-Gesetz (GEG). Es kann sein, dass kleinere Abschnitte des Gasnetzes für andere Gase (Wasserstoff, Kohlendioxid etc.) weiterverwendet werden können oder eine ganz andere Weiternutzung erfahren (beispielsweise als Leerrohre für digitale Leitungen). Im großen Ganzen aber wird das Gasnetz nicht mehr gebraucht und muss stillgelegt werden. Es kommt erschwerend hinzu, dass der Betrieb des Netzes schon vor 2045 von immer weniger Nutzern bezahlt werden muss, da die Leute nach und nach zu Fernwärme, Wärmepumpen und anderen emissionsarmen Wärmequellen wechseln. Damit verteuert sich Gas noch zusätzlich, was, zusammen mit dem schrittweise ansteigenden CO2-Preis, für Viele immer weniger bezahlbar sein wird und den Ausstieg noch beschleunigt.
Gibt gesetzliche Rahmenbedingungen für eine Stilllegung?
Der Betrieb und auch die Stilllegung von Gasanschlüssen oder ganzen Gasnetzen wird in einer Fülle von Gesetzen, Verordnungen und Arbeitsblättern geregelt. Diese im Detail darzustellen ist hier nicht der Ort. Nur einige Schlaglichter: Die Politik hat sich natürlich über das Problem des Gasausstieges in letzter Zeit auch schon Gedanken gemacht (https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/G/green-paper-transformation-gas-wasserstoff-verteilernetze.pdf?__blob=publicationFile&v=4 ) und zum Teil schon gesetzliche Grundlagen angepasst, über das schon erwähnte Nutzungsverbot für Heizungen ab 2045 hinaus. So gibt es zum Beispiel verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für die Gasnetzbetreiber, damit diese nicht auf ihren Investitionskosten sitzen bleiben und gleichzeitig die fortbestehenden Betriebskosten gleichmäßiger auf die abnehmenden Netznutzer verteilt werden (KANU 2.0; https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/20240925_KANU.html ). Im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) besteht auch noch eine Anschlusspflicht für Gaskunden. Allerdings erlischt diese Pflicht, wenn das Netz stillgelegt wird. Wie man allerdings dahin kommt, bedarf noch gesetzlicher Regelung (mehr dazu in Blog 67).
Einzelne Bürger können ihre Leitung jederzeit stilllegen – gegen Geld
Der einzelne Bürger kann schon immer jederzeit „aussteigen“. Wenn man z.B. eine Wärmpumpe eingebaut hat und die Gasleitung nicht mehr benötigt, kann man sich entscheiden, ob die NGN die Leitung nur im Haus verschließen soll oder sie jenseits der Grundstücksgrenze vom Gesamtnetz abtrennen soll. Es kann auch die komplette Entfernung der Leitungen auf dem Grundstück verlangt werden. Eine Rechnung erhält man in jedem Fall. Wenn lediglich Abbau der Messeinrichtungen und ein Verschluss der Leitung an der Straßegewünscht wird, werden 3570 Euro fällig (Preisblatt der NGN: https://cdn.swk.de/assets/download/Preisblatt_Netzanschluss_gueltig%20ab%2015%2010%202024.pdf ). Kompletter Rückbau wird individuell kalkuliert und ist deutlich teurer. Entscheidet man sich allerdings, die Leitung im Haus liegen zu lassen, werden jährliche Zahlungen für die Dichtigkeitsmessung des lokalen Netzes fällig (64,26 Euro). Erst wenn der ganze Straßenzug gasfrei ist, ein Hauptregler geschlossen werden kann und damit die Leitung gasfrei wird, fallen diese Gebühren weg.
Aber ein ganzes Netz abschalten? Mannheim preschte vor...
... und bekam viel Ärger. Am 8. November 2024 kündigten die Mannheimer Stadtwerke (MVV) relativ plötzlich an, das Gasnetz bis 2035 stillzulegen. Sie begründeten dies mit Klimaschutzaspekten und steigendem CO2-Preis. Das sorgte für große Verunsicherung. Eine Bürgerinitiative wurde gegründet („Mannheim gibt Gas“). 56.000 Haushalte waren betroffen. Viele fühlten sich „getäuscht“, da sie noch kurz zuvor Gasheizungen eingebaut hätten (hätten sie mal Blog 29 gelesen!). Der Gemeinderat und umliegende Kommunen schalteten sich bremsend ein. Schließlich bezeichneten die MVV 2035 als „Zielkorridor“. Obwohl schon andere Städte entsprechende Ankündigungen gemacht hatten, wurde auch bundesweit viel über Mannheim diskutiert.
Winterthur in der Schweiz war geschickter
Voraus ging ein Bürgerentscheid, dass die Stadt bis 2040 das Ziel „netto Null Treibhausgasemissionen“ erreichen sollte. Am 1. September 2022 verbot das kantonale Energiegesetz den Ersatz von Gasheizungen. Die Entscheidung, das Gasnetz stillzulegen, war Teil des kommunalen Energieplanes. Da man nicht passiv warten wollte, bis nur noch einzelne Kunden im Netz hingen, wurde ein klarer Zeitplan für den Ausstiegerarbeitet. 2030 sollten die Gebiete mit Fernwärmeversorgung vom Netz getrennt werden. Bis 2040 auch die anderen Gebiete. Stadt und Energieversorger haben die betroffenen Haushalte schriftlich informiert. So habe man frühzeitig auf Bedenken reagieren können und aktiv andere Heizsysteme anbieten können. Erst wenn ein ganzer Straßenzug umgestiegen sei, habe man die Leitung außer Betrieb genommen. Dennoch gab es auch in Winterthur Probleme. Bürger fühlten sich trotzdem überrascht. Die Umstiegskosten machten Sorgen. In manchen Gebieten gab es erschwerende Grundwasserschutzauflagen. Die Stadt suchte Lösungen. Es gab sogar Restwertentschädigungen für Gasheizungen (5 Prozent des Anschaffungswertes pro verbleibendem Nutzungsjahr).
Wie wird sich Krefeld verhalten?
Auch in Krefeld wird das Netz in absehbarer Zeit stillgelegt werden müssen. Wie gesagt, könnten einzelne Leitungen vielleicht für Wasserstoff zur Versorgung von Industriebetrieben genutzt werden oder sogar CO2 von Emittenten eingesammelt und zum „Recycling“ geleitet werden. Der überwiegende Teil aber wird nicht mehr gebraucht und im Betrieb auch viel zu teuer je näher 2045 rückt, da immer weniger Nutzer vorhanden sind, die sich die Betriebskosten teilen müssen. Es ist zu vermuten, dass die Stadtwerke sich schon intensiv Gedanken machen, wie dieser Prozess begleitet und moderiert werden kann. Wichtig ist, dass die Politik endlich den „Kommunalen Wärmeplan“ verabschiedet, mit dessen Erstellung Krefeld mustergültig früh begonnen hat. Wegen der anstehenden Kommunalwahlen verzögert sich aber der Ratsbeschluss. Es ist zu hoffen, dass der neu konstituierte Stadtrat den Plan rasch verabschiedet, damit jeder planen kann: Die Bürger müssen wissen, welche Heizungsform in ihrem Viertel verfügbar sein wird (z.B. Fernwärme?). Erst dann können sie alle gegebenen Möglichkeiten abwägen. Entsprechend können Stadt und Stadtwerke erst dann die Bürger über die Zukunft von Gas in ihrem Viertel informieren und Pläne für Alternativen und einen geordneten Ausstieg machen. Wie Winterthur zeigt: Eine gute Vorbereitung und maximale Kommunikation sind sehr wichtig, um Konflikte zu minimieren.
Werbeblock zur Kommunalwahl 2025 (Für eventuelle Interessenten an den Wahlprogrammen habe ich diesen “Werbeblock” nach der Wahl nicht gelöscht): Am 14. September wird der Stadtrat neu gewählt. Bitte gehen Sie wählen! Jede Stimme zählt – gerade im kommunalen Parlament! Der NABU ist strikt überparteilich und wird dazu keine konkreten Empfehlungen abgeben. Ich stelle Ihnen hier aber die Links zu den im Internet einsehbaren Parteiprogrammen (in der Reihenfolge ihrer derzeitigen Repräsentation im Stadtrat) zur Verfügung, damit Sie sich selbst ein Bild machen können, welche Parteien dem Klimaschutz das aus Ihrer Sicht richtige Gewicht im Rahmen der vielen kommunalen Aufgaben geben. Wie wichtig er aus meiner Sicht ist, habe ich ja in Blog 65 (und in vielen anderen zuvor) versucht zu begründen.
CDU Krefeld: https://www.cdu-krefeld.de/app/uploads/2023/06/CDU-Wahlprogramm_2020-2025.pdf
SPD Krefeld: https://www.spd-krefeld.de/wp-content/uploads/sites/1875/2025/08/WK-K23-LY3-Wahlprogramm-DRUCK.pdf
Bündnis 90/Grüne Krefeld: https://www.gruene-krefeld.de/wp-content/uploads/2025/07/Wahlprogramm_Krefeld_2025.pdf
Die FDP hat für 2025 kein umfassendes Wahlprogramm erstellt. Wohl gibt es ein Papier für Krefeld-West: https://krefeld.freie-demokraten.de/sites/default/files/2025-05/Kommunalwahlprogramm%20Krefeld%20West%202025_final.pdf
Von der AFD gibt es ein Kurzwahlprogramm: https://afd-krefeld.de/aktuelles/2025/08/unser-kurzwahlprogramm-fuer-krefeld-am-14-09-afd-waehlen/
Die Linke Krefeld: https://www.die-linke-krefeld.de/fileadmin/kvkrefeld/Kommunalwahlen_2025/Dokumente/Kommunalwahlprogramm_Die_Linke_Krefeld_2025.pdf
Freie Wähler Krefeld: https://www.freie-waehler-krefeld.de/kommunalwahl-2025/grundsatzprogramm/
Liste für Umweltschutz, Klimagerechtigkeit und Soziale Gerechtigkeit (LUKS; Björna Althoff): Ein Wahlprogramm gibt Google nicht her – wohl Interviews und Zitate.
Ähnliches gilt für „Die Partei“ (Jan Hertzberg) sowie „Wir Krefeld“ (Salih Talusoglu).

Am 28. Mai 2025 ereignete sich im Lötschental im Kanton Wallis in der Schweiz eine Katastrophe: Vom kleinen Nesthorn (ca. 3.800 m hoch) stürzten mehrere Millionen Tonnen Felsmaterial auf den Birchgletscher. Der Gletscher brach zusammen. Eine gewaltige Schutt- und Eislawine ergoss sich in das Tal und verschüttete große Teile des Dorfes Blatten. Der Klimawandel spielte bei dem Unglück eine zentrale Rolle: Dauerfrostböden tauen weltweit und rutschen damit an steilen Hängen leichter ab; Gletscher tauen und werden ebenfalls instabil. Im Lötschental kam beides zusammen.
Zum Glück konnten sich alle Einwohner des Dorfes den Gefahrenbereich rechtzeitig verlassen (bis auf einen Schäfer, der sich oberhalb des Dorfes befand). Schon Tage zuvor hatten Geologen starke Bewegungen im Fels registriert und zu einer Evakuierung des Dorfes geraten. Diese erfolgte zehn Tag zuvor vom 17. Bis 19. Mai 2025. Es gab keine Proteste, die Bevölkerung folgte der Behördenanweisung rasch und diszipliniert. Offenbar war die Gefahr allen bewusst. Es wusste keiner, wann der Berg rutschen würde und wie stark. Aber die Möglichkeit einer Katastrophe war so groß, dass Abwarten für niemand eine Option war.
Ganz anders ist dies mit anderen klimabedingten Gefahren
Gerne hätte ich es bei meiner Kurzbeschreibung der Atlantischen Umwälzströmung (Atlantic Meridional Overturning Circulation – AMOC, in Teilen auch „Golfstrom“ genannt) in Blog 55 belassen, die noch recht vorläufige Aussagen zur Geschwindigkeit der Abschwächung dieser wichtigen Strömung machte (inzwischen habe ich schon einzelne warnende Studien ergänzt). Auch hätte ich gerne die Abfolge der vorausgesagten Kipp-Punkte aus Blog 43 (Erläuterung siehe dort) bei Steigerung der Durchschnittstemperatur der Welt um über 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau so belassen, dass ein Zusammenbruch der AMOC noch unter „ferner liefen“ gelistet war. Leider machen neue Studien eine neue Bewertung notwendig. Ich habe gezögert, ob ich dies in einem neuen Blog darstellen sollte – auch weil ich die Erkenntnis gerne selbst verdrängen würde. Andererseits rettete Einsicht in die Zusammenhänge die Bürger von Blatten. Es ist also wichtig den Stand der Wissenschaft zur Kenntnis zu nehmen. Es sind eine ganze Reihe neuerer Studien. Ich werde die Kernerkenntnisse hier nur in aller Kürze auflisten:
Bedeutung der Atlantischen Umwälzströmung (AMOC): Sie transportiert Wärme mit einer Leistung von einem Petawatt (1015 Watt) von der Südhalbkugel nach Nordeuropa. Das ist etwa 50mal mehr Energie als die gesamte Menschheit verbraucht. Eine gigantische Klimamaschine. Sie garantierte damit in den zehn Jahrtausenden seit der letzten Kaltzeit eine große und einigermaßen stabile Klimazone, in der wir unsere landwirtschaftlich geprägte Kultur Schritt für Schritt entwickeln konnten - sowohl im Norden, den sie wärmt (die Nordhalbkugel ist dadurch ca. 1,4°C wärmer als die Südhalbkugel), als auch im Süden, den sie vor Überhitzung schützt. Und wir sind heute mehr denn je auf eine ertragreiche Landwirtschaft für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung angewiesen. 1987 stellte Wally Broeker anhand von Tiefseesedimenten und Bohrungen auf Grönland schon fest, dass sich das Klima im Laufe der Jahrtausende des Öfteren sprunghaft veränderte. Er vermutete Änderungen der AMOC als Ursache. Er meinte damals schon, dass wir mit unseren Treibhausgas-Emissionen „Russisch Roulette“ mit unserem Klima spielen. Das komplexe System, getrieben von einem austarierten Gleichgewicht aus feinen Unterschieden in Temperatur und Salzgehalt, gerät aus den Fugen. Neuere Forschung legt nahe, als würden die derzeitigen rechnerischen Klimamodelle einen zu stabilen Zustand der AMOC ermitteln, während reale Messungen in der Natur eine fortgeschrittene Instabilität nahelegen. Eine umfassende aktuelle Zusammenfassung der Zusammenhänge mit erklärenden Grafiken findet sich bei Rahmstorf: https://tos.org/oceanography/article/is-the-atlantic-overturning-circulation-approaching-a-tipping-point ).
Historische Klimaforschung: Interessant ist ein Rückblick auf das Eem-Zeitalter ca. 126.000 bis 115.000 Jahren vor heute. Es war die letzte Warmzeit vor der jetzigen Warmzeit, die vor ca. 10.000 Jahren begann. Dazwischen lag eine ca. 100.000jährige Kaltzeit mit überwiegend massiver Vereisung der Pole. Die Temperatur lag ca. ein Grad über der Temperatur des vorindustriellen Zeitalterns (also der 10.000 stabilen Jahre bevor unser aktueller Temperaturanstieg begann). Das Meer stand etwa so hoch wie heute. Grönland und die Antarktis wiesen in etwa den gleichen Vereisungsgrad auf wie heute. Die Neanderthaler bevölkerten Europa. Vieles war ähnlich wie heute. Dann plötzlich stieg der Meeresspiegel innerhalb von 100 Jahren einige Meter an (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379116303195 ), weil Grönland und die Westantarktis abzutauen begannen. Die dadurch hohe Frischwasserzufuhr beschleunigte das Tauen exponentiell und die AMOC versiegte, was zu einem Temperatursturz auf der Nordhemisphäre führte (https://acp.copernicus.org/articles/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.html ). Es folgte die 100.000jährige Kaltzeit mit Vereisung Nordeuropas. Heute ist die Temperatur bereits 1,5 Grad höher als in der vorindustriellen Zeit – und das Tauen der Eisschilde hat erneut begonnen. Damals war vermutlich die Stellung der Erde zur Sonne entscheidend für das Überschreiten des AMOC-Kipp-Punktes. Heute sind es unsere Emissionen von Klimagasen.
Beschleunigte Erwärmung in den letzten Jahren: In einer sehr engagierten Arbeit analysieren Hansen et al., warum der Temperaturanstieg der Erde in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen hat (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00139157.2025.2434494 ). Sie beklagen, dass der Weltklimarat (IPCC) diesen neuerlichen Temperaturanstieg systematisch unterschätzt und äußern die Befürchtung, dass wir vermutlich schon jetzt die selbstverstärkenden Prozesse in Gang setzen, die im Eem-Zeitalter zum Ende der Warmzeit geführt haben – inklusive Abbruch der AMOC innerhalb von 50-150 Jahren. Diese Zeitschätzung unterstützen auch andere Wissenschaftler (z.B. Ditlevsen und Ditlevsen 2023 https://www.nature.com/articles/s41467-023-39810-w , van Westen 2024 www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adk1189 , Zhu et al. 2023 https://www.nature.com/articles/s41467-023-36288-4 , Li et al. 2025 https://www.nature.com/articles/s43247-025-02589-3 , Drijfhout et. al 2025 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/adfa3b ).
Meeresströmungsveränderungen auch in anderen Bereichen: Noch beunruhigender als die Erkenntnisse zu AMOC sind neuere Studien zum Südpol, ein Bereich, der bisher weniger beachtet wurde, da das Meereseis dort bis 2016 eher noch etwas zuzunehmen schien. Seither aber geht es rascher zurück als das Meereis im Norden. Sprunghafte Veränderungen von Meereisausdehnung, Meeresströmung und Ökosystem kündigen sich an. Ein Abrutschen eines Großteiles des Westantarktischen Eispanzers steht bevor (mit Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern). In einer neueren Arbeit ist dies kurz aber umfassend und relativ verständlich zusammengefasst. Nur eine umgehende Klimastabilisierung zwischen plus 1,5° und 2° könne die krisenhaften Veränderungen noch begrenzen (Original zugangsbeschränkt: https://www.nature.com/articles/s41586-025-09349-5, Zusammenfassung: https://www.antarctica.gov.au/news/2025/new-study-confirms-abrupt-changes-underway-in-antarctica/ ). Auch aus anderen Meeresbereichen werden neuartige Strömungsveränderungen berichtet: Aktuell blieb die sonst regelmäßige saisonale nährstoffreiche aufsteigende Strömung im Golf von Panama aus – mit entsprechenden Folgen für die Fischerei (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2512056122 ). Die Ozeane scheinen ihre stabilisierendes Verhalten der letzten 10.000 Jahre grundlegend zu ändern.
Was passiert, wenn die AMOC versiegt: Eine grundsätzliche Umverteilung des Klimas auf dem Globus träte ein. Erste Zeichen sind schon erkennbar („Kälteblob“ über dem Nordatlantik). Beginnend noch in diesem Jahrhundert sänken die Temperaturen hoch im Norden, verbunden mit starkem Meeresspiegelanstieg. Ein Eispanzer würde sich vom Nordpol Richtung Süden ausbreiten (und damit den Meerespiegel über hunderte Jahre wieder senken). Er war „kürzlich“, während der letzten Eiszeit, sogar bis Krefeld gekommen (der Hülser Berg ist als Endmoränenrest Zeugnis davon). Auf der Südhalbkugel würde die Durchschnittstemperatur mehrere Grad steigen. Weite Gebiete würden hitzebedingt unbewohnbar (https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2023-06/klimawandel-erderwaermung-klima-daten-hitze-unbewohnbar ), die Regenwälder würden versteppen und ihre Funktion im Wasserkreislauf verlieren. Landwirtschaftlich bearbeitbare Gebiete würden Mangelware. Wie schon in Blog 55 gesagt: Dazwischen gibt es dann eine sehr „ungemütliche“ Zone mit starken Wetterextremen aufgrund des extrem gestiegenen Temperaturgradienten (über 4°C Differenz zwischen Nord- und Südeuropa), in der wir Mitteleuropäer – zusammen mit Millionen von Klimaflüchtlingen - versuchen zu überleben. Über Jahrhunderte würde es vermutlich auf der ganzen Erde wieder kälter, da die sich im Norden ausbreitenden Eismassen die Sonneneinstrahlung zunehmend reflektieren und die Erde wieder auskühlen würde. Ob es dann für die Überlebenden wieder „gemütlicher“ wird?
Wo sind denn nun die Parallelen zum Lötschental?
Die Gemeinsamkeit ist, dass Fachleute sagen, dass eine Katastrophe droht und raten, Maßnahmen zu ergreifen. Der Unterschied ist, dass die Zusammenhänge unübersichtlicher sind, die Katastrophe ferner in der Zukunft liegt und sie weniger konkret vorstellbar ist. Es gibt zudem mehr Unsicherheiten. Fachleute geben das zu. Sie meinen aber übereinstimmend, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unverändert fortgesetzte Emission von Klimagasen zu großen Problemen führen wird, inzwischen so groß ist, dass es fahrlässig wäre, auf weitere Beweise zu warten (siehe Rahmstorf – Link oben; auch die OECD https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/12/climate-tipping-points_9994de90/abc5a69e-en.pdf ). Bis wir sichere Beweise hätten, wäre es definitiv zu spät zu handeln. Der Prozess wäre nicht mehr umkehrbar. Der Schaden wäre gigantisch. Zudem betonen alle Experten, dass „halbes Handeln“ die sprunghaften Klimaumschwünge nicht verhindern wird – so wie es im Lötschental nicht gereicht hätte, nur am Wochenende das Dorf zu verlassen. Man musste schon die unbequeme Flucht komplett antreten. Zum Glück war das ja allen Einwohnern von Blatten sofort klar. Den Bewohnern der Erde ist die AMOC-Problematik leider nicht klar.
Es gibt ja auch Steilvorlagen für „Verdränger“
Zum einen sind dies ernste und sorgfältig erstellt wissenschaftliche Arbeiten, die zu anderen Detailergebnissen kommen. So wird z.B. wiederholt die Geschwindigkeit der Abschwächung der AMOC diskutiert (z.B.https://www.researchgate.net/publication/389358421_Continued_Atlantic_overturning_circulation_even_under_climate_extremes; ). Verschiedene Computermodelle kommen zudem zu verschiedenen Ergebnissen – z.T. sogar die gleichen Modelle bei mehrfachen Durchläufen (https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/36/18/JCLI-D-22-0536.1.xml ). Missverständnisse treten auch durch die Wortwahl auf: Wenn Arbeiten eine Arbeit titelt, dass AMOC nicht so bald “zusammenbricht”, im Text aber eine deutliche Abschwächung bestätigt, fühlen sich die “Klimaskeptiker” bestätigt; der reale Prozesse aber ist der Gleiche.
Es gibt aber auch politische Tendenzen, die immer konkretere Grundlagenforschung insgesamt in Frage zu stellen (vor allem bei populistischen Parteien). So gab z.B. das Energieministerium der USA im Juli 2025 eine 140seitige Stellungnahme heraus, die die Gefahren des Klimawandels stark herunterspielt. (https://www.energy.gov/sites/default/files/2025-07/DOE_Critical_Review_of_Impacts_of_GHG_Emissions_on_the_US_Climate_July_2025.pdf ).
Medien stimmen ein: In Deutschland z.B. „entlarvt“ DIE WELT „umstrittene Katastrophenprognose“ (https://www.welt.de/wissenschaft/plus68abf4168c33b226bcae6cdd/Klimawandel-Der-Skandal-um-die-umstrittene-Klimastudie.html , http://guggenberger.me/2025/08/30/klimastudie-aus-potsdam-wie-fragwuerdige-prognosen-politik-und-wirtschaft-in-die-irre-fuehrten/ ). Sie erklärt eine Veröffentlichung mit drastischen Worten als wissenschaftlich falsch und sogar von politischen Verstrickungen manipuliert. Sie erweckt den Anschein, als ob damit auch alle anderen weltweiten Klimastudien und die politischen Konsequenzen zweifelhaft seien (dabei geht es in der kritisierten Studie “nur” um Abschätzung von ökonomische Folgen, nicht um physikalische Ursachen des Klimawandels). Will man sich eine Meinung bilden, muss man alle Artikel (sowohl die Originale als auch die Diffamierenden) schon sehr genau lesen. Das ist mühsam. Verdränger und Leugner entscheiden sich daraufhin gerne zu warten, bis sie die Lawine mit eigenen Augen rollen sehen. Leider ist es dann zu spät zu laufen. Und es wundert, dass die realen Hitzewellen, Starkregen, Waldbrände, Gletscherschmelze, Meeresspiegelanstieg etc. noch nicht überzeugend genug sind.
Klimaschutz tritt in der Wahrnehmung als Problem zurück
Die USA führen - gegen alle Evidenz in ihrem Land - eine komplette Wende durch, leugnen Klimawandelfolgen und schaffen Klimapolitik ab. Viele Länder bessern ihre unzureichenden Klimaziele nicht nach (momentan nehmen wir global Kurs auf 2,7°C Temperaturanstieg). Großbanken verabschieden sich reihenweise von Neutralitätsversprechen. Die bei der Klimakonferenz 2024 in Baku beschlossene Verdreifachung der Erneuerbaren Energien bis 2030 wird einfach nicht umgesetzt. Die EU schwächt ihre Klimarhetorik und manche Maßnahmen ab, viele Firmen ebenfalls. Bundeskanzler Merz spricht ständig negativ über Elemente der Energiewende, statt zu motivieren. Wirtschaftsministerin Reiche betont lieber die Notwendigkeit der Versorgungssicherheit (als wäre das ein Gegensatz zu Nachhaltigkeit) und will schon gemachte Fortschritte der Energiewende wieder zurückdrehen.
Auch in Krefeld fehlt Klimaschutz bei der Kommunalwahl 2025 fast völlig
Krefeld, einst „Solarhauptstadt“ und früh auf dem Weg der Energiewende, NRW-weit „vorbildlich“ bei der Wärmplanung, hüllt sich sich zunehmend in Schweigen. Die wenigsten Parteien räumen Klimaneutralitätsprogrammen oder Energiewendezielen eine nennenswerte Rolle in ihren Wahlprogrammen für die Kommunalwahl 2025 ein. Eine große Partei erwähnt sie nicht einmal und spekuliert in der Presse (WZ 26.7.2025), dass es ja im Klimabereich einsparbare Stellen gäbe.
Katastrophengerede hilft nicht? Positiv geht auch!
Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, da ich schon wieder auf Gefahren hinweise. Studien sagen, dass das nicht motiviert. Aber das Schicksal des Lötschentals zeigt, dass Wissen Leben retten kann! Aber ich sage es gerne nochmal von der positiven Seite: Wenn wir jetzt in Deutschland massiv in Überlandleitungen und Speicher investieren (was bereits erfolgreich begonnen ist, nur weitergeführt werden muss) und gleichzeitig die regenerative Energieerzeugung weiter ausbauen, werden wir in wenigen Jahren preiswerte und unerschöpfliche eigene Energie haben!!! Der sinnvolle Weg führt nach vorn. (Mitten im steilsten Anstieg stehen bleiben, weil es anstrengend ist, ist bei einer Bergtour das Schlechteste, was man tun kann). Deutschlands Städte sollten die Energiewende beschleunigen. Die Pläne liegen allenthalben vor. Sie sind in Gefahr, zerredet zu werden. Wenn aber alle motiviert mitziehen, geht es leichter. Industrie und Energieversorger haben das verstanden.
In Krefeld gehört dazu eine rasche Verabschiedung der Wärmeplanung, intensive Unterstützung der Bürger bei der Umsetzung, rasche „Vergrünung“ der Fernwärme, weiterer Ausbau von Solar- und Windenergie, Fortsetzung der Verkehrswende. Das kostet viel Geld; aber wenn wir fertig sind, sparen wir auch und wir haben für Jahrzehnte preiswerte und sichere Energie. Es kostet langfristig viel mehr, wenn wir zu wenig tun. Und erst recht kann jeder Einzelne etwas tun. Es geht darum, möglichst viel Emissionen möglichst schnell einzusparen. Wenn Sie fünf Minuten nachdenken, fallen Ihnen bestimmt mindestens zehn Möglichkeiten ein, wo sie lieber heute als morgen zur Emissionsminderung beitragen können (haben z.B. schon alle Ihre Lampen LED-Birnen?….). Es lohnt sich, auf begründete Warnungen zu hören. Fragen Sie die Bürger von Blatten im Lötschental!
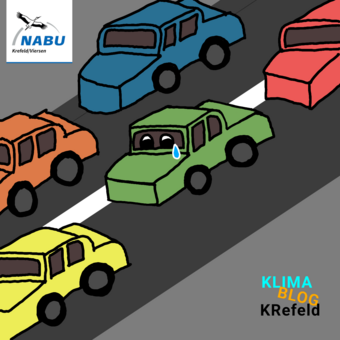
Immer häufiger liest man von der „Krise des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV)“. Aktuell (16.6.2025) titelte auch die Rheinische Post für Krefeld: „Warum der Nahverkehr ein Sorgenkind ist“. Anlass war die Jahresbilanz 2024 der SWK: Zwar historisch zweithöchster Gesamtgewinn aber ein Minus von 42 Millionen Euro bei SWK mobil. Die Landesregierung NRW sieht zwar auch das Problem: 2022 stellte das Land dem unter gestiegenen (Energie-)kosten leidenden ÖPNV 200 Mio. Euro zur Verfügung (https://www.umwelt.nrw.de/minister-krischer-wir-wollen-den-oepnv-krisenfest-machen ). Angesichts eines Minus von 42 Millionen allein in Krefeld ist das leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Besonders mittelgroße Städte wie Krefeld haben zu kämpfen
Mittelgroße Städte befinden sich in einer strukturellen Mittellage: Sie haben zu viel Verkehr für ländliche Lösungen aber zu wenig Nachfrage und Ressourcen, um Großstadt-Angebote möglich zu machen. Hohe Energie- und vor allem Personalkosten (Akzentuiert durch die kürzlichen Lohn- und Gehaltsabschlüsse sowie den leergefegten Arbeitsmarkt) steigern die Ausgaben (der Corona-Einbruch tat ein Übriges), während die Einnahmen kaum gesteigert werden können, da Menschen dann bei hohen Preisen lieber auf den Individualverkehr umsteigen und in mittelgroßen Städten trotzdem gut vorankommen. Stehende Autos stören zudem auch nicht so stark wie in Großstädten, so dass es anteilig mehr Autobesitzer und genug Parkplätze gibt. Ohnehin kostet ein guter ÖPNV in mittelgroßen Städten mehr pro Fahrgast. Und so nützlich das Deutschlandticket als Anreiz ist, es verbessert die finanzielle Klemme der Anbieter nicht. Auch die „klassische“ Quersubventionierung des ÖPNV mit Einnahmen aus der Energiebereitstellung wird rechtlich schwieriger und gerät aktuell in Konkurrenz zu den hohen Ausgaben, die auch für die Energiewende notwendig sind.
Was kann man tun?
Es ist ein Teufelskreis: Eine Reduzierung des Angebotes, um die Kosten zu senken, macht den ÖPNV (noch) unattraktiver, was den Prozess nur beschleunigt. Eine Erhöhung der Beförderungspreise macht ihn ebenfalls unattraktiv und zudem unsozial. Was sind die möglichen Schlussfolgerungen?
1) Busse und Bahnen komplett einstellen
Die Klimaneutralität des Verkehrs könnte man auch komplett durch Individualverkehr (Elektroautos, Radverkehr, Fußgänger) erreichen. Busse und Bahnen fielen in den meisten Bereichen weg. Große Städte könnten, wegen der hohen Fahrgastzahlen, einen wirtschaftlichen ÖPNV vermutlich noch am ehesten gewährleisten. Es träfe vor allem die kleineren Städte und die ländlichen Räume, die ohnehin mobilitätsmäßig benachteiligt sind. Besonders getroffen wären die sozial Schwachen, die sich kein Auto leisten können oder gesundheitlich nicht fahren können und dann meist auch nicht auf das Fahrrad umsteigen können. Und was ist mit SchülerInnen? Noch mehr „Elterntaxis“ vor den Schulen? In Krefeld wären ca. 30-40.000 Menschen betroffen. Zudem würden die Städte noch mehr unter den Folgen des Autoverkehrs leiden: Unfallgefahr, mindere Aufenthaltsqualität, Mehrkosten für Ausbau und Erhalt der Straßeninfrastruktur, Stress und Lärm (auch bei Elektroautos). Die Versöhnung von Auto, Rad und Fußgänger im Straßenraum würde durch höhere Autozahlen noch schwerer fallen. Zudem ist das ÖPNV-Angebot rechtlich verankert als Teil der „Daseinsvorsorge“ (§8 PBefG, https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/__8.html und ÖPNVG NRW, v.a. §2 Abs. 3, https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&bes_id=3913&aufgehoben=N ).
2) Den ÖPNV aus externen Quellen finanzieren
Zunächst wäre nach Bund und Land zu rufen. Das Land ist zwar für die allgemeinen Pläne verantwortlich, nicht aber für die Finanzierung im Einzelnen. Diese bleibt meist an den Kommunen hängen. Wie ganz oben erwähnt, gibt es durchaus Finanzierungen durch Bund und Land, die aber nicht reichen – besonders für mittelgroße Städte. Da wird es in Zukunft noch politischen Diskussionsbedarf geben.
Alternativ gibt es weltweit diverse Modelle, den ÖPNV aus anderen Quellen zu finanzieren. So verwendet Wien die Einnahmen aus Parkgebühren zweckgebunden. Andere Städte erheben eine zweckgebundene City-Maut (Oslo, Singapur, Mailand u.a.), was in Deutschland aber derzeit rechtlich ausscheidet. In der Regel handelt es sich auch um Großstädte. Krefeld hat wenig Möglichkeiten bzw. würde das Defizit nur von einer in die andere Tasche umverteilen. Ob ein „Bürgerticket“ bzw. „Mobilitätspass“ (alle Bürger zahlen einen monatlichen Beitrag und nutzen dann kostenlos) wie in Hassfurt (Bayern), Templin oder aufgrund verschiedener Modellversuche in der „Mobilitätsstrategie 2030“ von Baden-Württemberg angeregt (Seite 64, https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/Broschueren_Publikationen/Broschüre_ÖPNV-Strategie_2030.pdf ) durchsetzbar wäre, wäre zu diskutieren. Jobtickets gehen in die Richtung. Eine zweckgebundene Grundsteuererhöhung in Haltestellennähe würde wohl definitiv die Machbarkeit sprengen.
3) Attraktivitätssteigerungen
Viele Städte (z.B. Wien im „Wien-Plan 2035“, https://www.wien.gv.at/pdf/ma18/wien-plan.pdf ) versuchen, den ÖPNV gezielt attraktiver zu machen. Bei großen Städten mag dies mit angemessenem Kosten-Nutzen-Verhältnis möglich sein. Bei mittelgroßen Städten mit üblicherweise ausreichend breiten Straßen, vielen Parkplätzen und kurzen Fahrzeiten arbeitet man bergauf. Sicher gibt es zahlreiche Defizite, die zu verbessern wären, es würde zur Rettung nicht reichen. Eine reine zeitliche Angebotsverbesserung ändert z.B. wenig, wenn die räumliche Erreichbarkeit dünn ist. So führt eine Einführung des 10-Minuten-Taktes zu Millionen Mehrkosten (gerade wegen der Personalkosten) aber nur wenigen hundert zusätzlichen Fahrgästen. Eine Verdichtung des Netzes ist noch teurer. Bus- und Bahnfahren hat zudem in kleineren Städten gegenüber Großstädten immer noch ein Imageproblem. Relativ zum Auto konkurrenzfähig würde der ÖPNV nur eingebettet in eine sehr grundsätzliche Umgestaltung der innerstädtischen Mobilität (mit unpopulären Maßnahmen wie intensiver Verkehrsbeschränkung, aggressiver Parkraumbewirschaftung etc.). Das aber weckt die Sorge, Kunden und Besucher nur in andere Städte zu vertreiben. In studentisch geprägten Städten wie Tübingen oder Jena (Vorzeigestadt für ÖPNV im Osten) überwiegt anscheinend die Akzeptanz (und die Kundschaft). Das Konzept „KrefeldKlimaNeutral 2035“ versucht hier einen Mittelweg, der aber allein nicht ausreichen wird. Es zielt allerdings auch weniger auf Rettung des ÖPNV als auf Maßnahmen zum Erreichen der Klimaneutralität.
4) Durch moderne Technik die Kosten senken
Dazu gibt es viele Ideen. Einige Beispiele: „On-Demand-Verkehr“ (z.B. bedarfsgesteuerte Kleinbusse, überregionale Beispiele ioki der DB, Via, Clevershuttle) wird inzwischen auch zunehmend von Stadtwerken, besonders in ländlichen Gebieten, peripheren Stadtlagen und außerhalb der Hauptbedarfszeiten, eingesetzt. Kaum genutzte Regelfahrten können so eingespart werden, unterversorgte Gebiete kostengünstig bedient werden. +++ KI-analysierte Verkehrsflüsse können Takte und Routen optimieren. +++ Ticketverkauf per App kann Infrastruktur einsparen und Attraktivität steigern. +++ Kombinierte Mobilitätsangeboteverschiedener Verkehrsmittel können per gemeinsamer App gebündelt optimiert werden. +++ Neuerdings wird die Automatisierung von Fahrzeugen zunehmend diskutiert, was exemplarisch etwas näher betrachtet werden soll:
Ist die Zeit schon reif für autonome Fahrzeuge?
Der Presse ist derzeit zu entnehmen, dass Tesla sehr intensiv auf den Markt für autonome Beförderungsangebote (Fahrzeuge ganz ohne Fahrer) drängt. Das ist mit zwei Problemen verbunden: Da Tesla-Fahrzeuge die Umgebung nur optisch mit Kameras erfassen (andere Hersteller zusätzlich mit Radar und Laser – teurer, aber sicherer), wird der Sicherheitsaspekt stark diskutiert und spektakuläre Unfälle schüren Unsicherheit. Außerdem richtet sich die Initiative nur auf den Individualverkehr („Robotaxis“), was für das Klima vermutlich eher nachteilige Effekte haben könnte.
Ganz still und leise arbeiten aber auch viele andere Anbieter an autonomen Lösungen. In vielen Städten fahren schon mehr oder weniger experimentell autonome Fahrzeuge – zunehmend völlig ohne Fahrer. In Deutschland arbeiten vor allem VW und Mercedes-Benz an autonomen Techniken mit SAE-Level 4 (vollständig autonomes Fahren in begrenztem Bereich, z.B. einer Stadt). MAN bastelt an autonomen Stadtbussen (und LKWs). In vielen Städten laufen Pilotversuche mit Robotaxis oder Shuttles: Hamburg (MOIA und Projekt HEAT), München (Projekt MINGA), Darmstadt/Offenbach (Projekte KIRA), in Burgdorf bei Hannover fährt in Kürze der erste autonome Großbus, uva.. Hamburg baut sogar schon einen Betriebshof für autonome Shuttles (https://www.hochbahn.de/de/presse/pressemitteilungen/erster-betriebshof-fuer-autonome-shuttles-104552 ). VW hat soeben angekündigt, mit einem vollautonomen iBuzz in Serie zu gehen(https://www.moia.io/de-DE/news/moia-stellt-serienreifen-id-buzz-ad-und-schluesselfertige-komplettloesung-fuer-vollautonome-fahrdienste-vor ). Fahrerlose Bahnen sind in Hamburg (dadurch 100-Sekunden-Takt angestrebt), Berlin und Nürnberg geplant.
Die Technik gibt es also. Was ist mit den Rahmenbedingungen?
Das Bundesverkehrsministerium der Ampelkoalition (Volker Wissing) veröffentlichte im Dezember 2024 das Papier „Die Zukunft fährt autonom - Strategie der Bundesregierung für autonomes Fahren im Straßenverkehr“ (https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/die-zukunft-faehrt-autonom.pdf?__blob=publicationFile ). Diese soll Deutschland zu einem führenden Innovationsstandort machen. Besonderer Schwerpunkt soll, wie wiederholt betont wird, der öffentliche Personennahverkehr und der Güterverkehr sein. Dies soll die Straße entlasten, Akzeptanz fördern und die Mobilität besonders im ländlichen Raum erhalten. „Reboundeffekte“ (mehr Verkehr durch höheren Komfort des Individualverkehrs) sollen vermieden werden. Das Ministerium kündigte an, das autonome Fahren schon 2026 aus dem Erprobungs- in den Regelbetrieb zu überführen. 2028 sollte der größte zusammenhängende Betriebsbereich für autonome Fahrzeuge entstehen, 2030 sollte autonomes Fahren fester Bestandteil des vernetzten Mobilitätssystems werden. Man war aber guten Willens. Ich bin guter Hoffnung, dass dies auch von der neuen Regierung so gesehen wird, da ja auch der Koalitionsvertrag die „Voraussetzungen schaffen“ will, „dass autonomes Fahren in den Regelbetrieb kommt“ (Seite 8 oben). Das Fraunhofer-Institut hat eine Studie dazu erstellt, wie dies geschehen und zu einer Chance für Deutschland werden kann (https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/3ccc10dc-924a-441d-8866-2b11fe4b130e ).
Im März 2025 veröffentlichte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ein Positionspapier, welches die Notwendigkeit autonomer Mobilität für eine zukunftsfähige Transformation des ÖPNVintensiv unterstreicht (https://www.vdv.de/vdv-positionspapier-autonomes-fahren-im-oepnv-e.pdfx ). Dazu fordert der Verband im Juni 2025 auf seiner Jahrestagung nochmals intensiv die (auch finanzielle) Unterstützung der Bundesregierung ein (https://www.vdv.de/presse.aspx?id=f50aaec8-f330-48ff-99bc-326a184fa7f2&mode=detail ). Die Voraussetzungen für die Umsetzung seien gegeben.
Und in Krefeld?
Die SWK sind hier durchaus fortschrittlich. So bieten sie mit „Mein SWCAR“ schon seit einiger Zeit einen „On-Demand-Service“ mit elektrischen Minibussen an, die mit der SWK-App in bestimmten Zeitfenstern bestellt und bezahlt werden können (https://www.swk.de/privatkunden/de/mobilitaet/sharing-und-emobility/mein-swcar). Sie haben zwar (noch) einen Fahrer, sind aber ein Komfort-Angebot in nachfragearmen Zeiten und können bei geschickter Planung Leerfahrten im Liniennetz vermeiden.
In Bezug auf autonome Mobilität arbeiten SWK mobil und das SWK-E2-Institut der Hochschule Niederrhein schon seit 2020 in dem von Bundesforschungsministerium geförderten Projekt „MobilitätsWerkStadt 2025“mit (https://www.hs-niederrhein.com/swk-e2/detailed-view-news/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=21211&cHash=e184f3b663f5e210009cfc2fadb86cb1). Speziell für Krefeld fand eine Potenzialerfassung für autonome Fahrzeuge im ÖPNV und für den Aufbau eines multimodalen Verkehrsangebotes statt. Auch hier wurden also Voraussetzungen geschaffen. Vieleicht können wir also schon bald in die ersten autonomen Fahrzeuge steigen. Zur finanziellen Sanierung und damit der langfristigen Erhaltung des ÖPNV sind zwar noch viele weitere Maßnahmen notwendig. Es wäre aber vermutlich ein wichtiger Schritt.
(PS: Vier Tage nach Veröffentlichung dieses Blogs veröffentlichte auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV die Kurzfassung eines Gutachtens, das Wünsche zu diesem Thema an die Bundesregierung formuliert: https://www.vdv.de/kurzfassung-vdv-gutachten-zur-finanzierung-der-leistungskosten-im-oepnv-2024-2040.pdfx )

Die SWK planen einen Elektrolyseur (5 MW) auf ihrem Betriebsgelände zur Versorgung ihrer neuen, emissionsfreien Wasserstoffbusse. Die Bürger der angrenzenden Siedlung machen dagegen mobil (https://www.haltwasserstoff.de ). Am 7.3.2025 fand eine Diskussionsveranstaltung bei den Stadtwerken statt. Herr Schulte von der WZ hat die Inhalte sehr gut zusammengefasst (WZ vom 9.4.2025: https://www.wz.de/nrw/krefeld/anwohner-gegen-stadtwerke-krefeld-die-debatte-zum-wasserstoff_aid-126117135 - leider gebührenpflichtig, 99 Cent).
Ich bedauere den Streit, da neben den lokalen Interessen der Anwohner, die grundsätzlichen Fragen zur Sinnhaftigkeit des Elektrolyseurs meist zu kurz kommen bzw. verzerrt dargestellt werden. Deshalb hier ein paar Gedanken zur Einordnung. Zum Verständnis muss ich allerdings etwas ausholen:
Woher kommt Wasserstoff?
Wasserstoff wird derzeit i.d.R. aus Erdgas hergestellt (meist Dampfreformierung). Dabei entsteht aber klimaschädliches CO2. Dieses müsste aufgefangen und eingelagert werden, um Klimaneutralität zu erreichen. Das aber ist teuer, aufwändig und umstritten. Als klimaneutrales Verfahren bietet sich deshalb alternativ in erster Linie die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mit Hilfe von Strom an. Dies geschieht in Elektrolyseuren. Allerdings braucht man für Klimaneutralität dazu „grünen Strom“.
Wofür brauchen wir Wasserstoff?
Hauptsächlich wird der Wasserstoff in der Industrie gebraucht. Die Chemie braucht ihn als Grundstoff für zahlreiche Prozesse. Die Stahlindustrie und die Zementindustrie könnte damit ihre Prozesse dekarbonisieren. Er wird auch für Prozesswärme in verschiedensten anderen Produktionen gebraucht, wo jetzt i.d.R. Gas eingesetzt wird. Wasserstoff wird voraussichtlich auch im Transport eine Rolle spielen (Schiffe, Fernverkehr und Spezialanwendungen). Schließlich kann Wasserstoff auch in allen anderen Prozessen eingesetzt werden, in denen wir derzeit Erdgas benutzen. Dies könnte z.B. zum winterlichen Spitzenlastausgleich in Heizwerken zur Erzeugung von Fernwärme sinnvoll sein. Manche propagieren ihn auch zum Heizen, was aber vermutlich am Preis scheitern wird und auch energetisch ineffizient ist (vertiefend siehe auch Blog 14 und 26). Wasserstoff wird aber auch als wichtiges Bindeglied der Energiewende betrachtet. Dies sei kurz erläutert.
Die Energiewende stößt auf Hindernisse
Die Energiewende hat erfreuliche Fortschritte gemacht. Regenerative Energiequellen, vor allem Sonne und Wind, stellen schon über 50% unseres Stromes in Deutschland bereit (der Wärmebereich muss noch folgen). Angestrebt werden über 80%. Der Ausbau stößt aber jetzt auf Widerstände. An sonnigen oder/und windigen Tagen (vor allem an Wochenenden und Feiertagen) übersteigt das Angebot immer häufiger den Verbrauch. Der Strompreis stürzt dann ins Negative. Anlagen müssen immer häufiger zeitweise abgeschaltet werden. Das drückt auf die Wirtschaftlichkeit.
Andererseits gibt es die Stunden und Tage, an denen wenig Sonne scheint und kein Wind weht – die sogenannten „Dunkelflauten“. An diesen Tagen steht nicht genug regenerativer Strom zur Verfügung, Gas- und Kohlekraftwerke müssen einspringen.
Das Problem muss gelöst werden
Überbrückung ist zeitweise mit Batteriespeichern (sowohl im individuellen Haushalt als auch in Form von Großbatterien) möglich, die derzeit rasant im Preis fallen und massiv ausgebaut werden. Damit ist zumindest ein stundenweiser Ausgleich von Stromspitzen und – lücken möglich. Batterien können aber nicht das wachsende „Überangebot“ von Solarstrom im Sommer bis in den Winter speichern. Das können Pumpwasserspeicher, für die in Deutschland aber kaum noch Ausbaumöglichkeiten bestehen. Wir brauchen also noch andere Energiespeicher. Über unterirdische Wärmespeicherung (Aquiferspeicher) wurde bereits berichtet (Blog 57). Aber wie könnte Strom langfristig gespeichert werden? Es gibt diverse (mechanische) Technologien – für kleinere Anwendungen. Was könnte in großem Stil helfen?
Die „Wasserstoff-Wirtschaft“
Bereits 1993 bezeichnete der Visionär Hermann Scheer die „Wasserstoffwirtschaft“ als „Notwendigkeit“ (Hermann Scheer: „Sonnenstrategie“, Piper 1993, Seite 141). Seither wurde mit zunehmender Regelmäßigkeit Wasserstoff als Zukunftstechnologie propagiert. Mit Überschussstrom solle mit Elektrolyseuren Wasserstoff (und Sauerstoff) produziert werden, welcher gespeichert werden kann und bei Bedarf mit Brennstoffzellen wieder in Strom umgewandelt werden.
Hakt der „Hochlauf“ von Wasserstoff?
An einem Bedarf für Wasserstoff kann man zusammenfassend kaum zweifeln. Erdgas muss schließlich allenthalben ersetzt werden. Nun häufen sich im Moment die Pressemeldungen, die von einem „verzögerten Hochlauf“ der Wasserstoffwirtschaft berichten (siehe auch Blog 52). Es fehlt zwar nicht an potenziellen Interessenten und Produzenten. Konkrete Verträge aber kommen nicht zustande, da der Preis von „grünem Wasserstoff“ immer noch deutlich über dem von fossil erzeugtem Wasserstoff liegt und dann, mangels Abnahme, auch Großinvestitionen in Produktionsanlagen ausbleiben (überlegt werden auch Produktionsverlagerung, siehe Blog 49). Es gibt zwar viele Ankündigungen, konkrete Projekte nehmen zwar zu (https://h2-news.de/projekt-karte/ ), sind aber noch zu wenige bzw. zu klein. Auch das Ausland überbietet sich zwar mit Zukunftsvisionen. Sonnenreiche Länder in Nordafrika, mittlerem Osten und auch Australien sehen darin wichtige Einkommensquellen (Ersatz auch für das gefährdete Ölgeschäft). Viele Großprojekte sind in Planung. Transport und Abnahme aber bleiben noch unkonkret. (Siehe dazu auch Blog 45). Viele neue Technologien fangen aber so an. Anlaufprobleme sind kein Gegenargument:
Beispiel: Hochlaufprobleme gab es auch bei Solarenergie
Solche Probleme im Hochlauf gab es bei vielen Technologien – sie sprechen aber nicht dagegen, siehe Solarenergie: Auch die Photovoltaik trat zu Anfang mühsam auf den Plan. Bis Ende der 80er Jahre gab es nur Spezialanwendungen (z.B. abgelegene Messanlagen, Satelliten, Solaruhren etc.). Als ich 1991 die eine 6 kW-Anlage auf mein Dach baute, wurde ich schräg angesehen: „Rechnet sich das denn?“ Ich habe dann immer gegengefragt: „Rechnet sich denn ein Mercedes?“ (leider kostete die Anlage entsprechend viel). Ich glaubte aber, Zukunftstechnologie „um jeden Preis“ fördern zu müssen, denn dass der Schaden des Nichtstuns für zukünftige Generationen groß sein würde, hatte damals gerade der Enquetebericht des Bundestages zu den Klimaveränderungen (1987) eindrucksvoll zusammengestellt. Praktisch alle seine Prognosen sind inzwischen auch bestätigt und treten nach und nach ein. Photovoltaik fristete trotzdem noch 10 Jahre lang ein Nischendasein. Maximal 4% der Stromproduktion hielt man damals für möglich. Dann wurde, nach gedanklicher Vorarbeit des Solarenergie-Fördervereins Aachen seit 1989 sowie wiederum von Hermann Scheer, Michaele Hustedt und Hans-Josef Fell am 1. April 2000 bundesweit die „kostendeckende Einspeisevergütung“ gesetzlich verankert. Sie war nicht so „kostendeckend“ wie eigentlich gefordert, reichte aber zur Initialzündung von breitem bürgerschaftlichem Engagement. Dach-Solar wurde gesellschaftsfähig, die Preise für Anlagen purzelten, Deutschland baute eine weltweit führende Solarindustrie auf. Leider wurde die Vergütung des sauberen Stromes in den Folgejahren verwässert, die deutsche Solarindustrie brach zusammen, die Chinesen übernahmen; mit Erfolg! Heute produziert eine Solaranlage in einem sonnigen Land Strom für 1 Cent pro Kilowattstunde – in Deutschland für zwischen 4 Cent (Freiflächenanlagen) und 8-13 Cent (Dachanlagen). Das ist konkurrenzlos billig - und der Preis sinkt weiter.
Zweites Beispiel: Elektromobilität
Ein zweites Beispiel illustriert noch einen anderen Aspekt: In den 90er Jahren begann eine Diskussion, welche Technologie perspektivisch den Benzin- und Dieselmotor ersetzen würde. Die Meinungen gingen auseinander: BMW konstruierte damals das Modell eines Wasserstoff-Autos. Auch Toyota setzte frühzeitig auf diese Technologie (Toyota-Mirai). Andere favorisierten das Elektro-Auto. Elon Musk entschied das Rennen bekanntermaßen durch die Massenproduktion des Tesla. Staatliche Förderung kam hinzu. Die bessere Energieverwertung eines Elektroautos favorisiert auch theoretisch die Breitenanwendung dieses Antriebstyps (siehe auch mein kritischer Blog 19 zu Wasserstoffbussen). Dennoch setzen noch viele Hersteller (auch in China, dem Vorreiterland für Elektromobilität) parallel auch auf Wasserstoff – besonders für bestimmte Spezialanwendungen (LKWs, Langstreckentransport etc.).
Während also bei der Einführung der Solarenergie vorwiegend die Kosten hinderten, war es bei der Antriebsart für Autos auch die Unsicherheit, welche Technologie sich durchsetzen würde, die den Fortschritt bremste. In beiden Fällen aber führte letztlich eine Kombination aus Förderung, unternehmerischer Initiative, Klimaengagement der Bevölkerung und dadurch schließlich Kostendegression zu einem erfolgreichen Beginn des Hochlaufes.
Wo steht der Wasserstoff?
Die Wasserstoff-Technologie steht dem gegenüber noch am Anfang: Zweifel bremsen entschlossenes Handeln. „Zu teuer!“ heißt es, „zu wenig Grünstrom bei uns!“, „Falscher Weg!“ Zwar wird dem Wasserstoff in allen Energiewendeszenarien seit Jahren stets eine hohe Bedeutung für die Energiewende zugebilligt (für die frühen „Big-five“-Szenarien z.B. zusammenfassend im Prognos-Vergleich https://www.prognos.com/de/projekt/vergleich-der-big-5-klimaneutralitaetsszenarien ). Andererseits dämpfen auch wichtige Stimmen immer wieder die Hoffnungen (z.B. EON im März 2025 mit seinem „Playbook“ https://www.eon.com/content/dam/eon/eon-com/eon-com-assets/documents/politics/en/eon-the-energy-playbook.pdf ) und geplante Projekte werden abgeblasen (diese Tage z.B. in Ulm oder der Uckermark). Ein Tesla des Wasserstoffes, d.h. eine überzeugte Industrie, die einen Zukunftsgewinn sieht, plus überzeugte und entschlossene Regierungen, die dies (vorübergehend!) fördern, könnten aber vielleicht einen Turbo zünden.
Könnte speziell die Mobilität den Turbo zünden?
Angesichts der Probleme des Hochlaufes gibt es erste Stimmen, die der Mobilität eine wichtige zündende Rolle zubilligen. Im Transport könnte der Wasserstoff vielleicht am ehesten die Wirtschaftlichkeitsschwelle überschreiten und dann, durch Kostendegression wie bei der Solarenergie, die anderen Anwendungen mit Anlaufproblemen nachziehen. Dazu z.B. Prof Sterner Professor für Energiewirtschaft in Regensburg:
https://h2-news.de/h2-on-air/h2-on-air-folge-9-verkehrswende-wasserstoff-mobilitaet/ . Wasserstoff-Busse im ÖPNV, wie sie von vielen Stadtwerken derzeit eingeführt werden, können deshalb ein wichtiger Baustein sein - trotz aller Grundsatzkritik (Blog 19) (Wo z.B.: http://265071.93610.seu2.cleverreach.com/m/16033066/1096625-220021f7038ace666668d2cc802d7f0a127285265bd2ba2f456c3ca9a952fbc05cc6b176e26976ab809809de799ae88c). Es ist davon auszugehen, dass der Einsatz auch für Krefeld wirtschaftlich durchgerechnet wurde – Stadtwerke sind keine gemeinnützigen Organisationen. Dass es Förderungen gibt, ist im Hochlaufprozess sinnvoll und nicht verwerflich (siehe Solarenergie).
Der Streit um den Elektrolyseur der Stadtwerke
Jetzt komme ich endlich zu dem Elektrolyseur der Stadtwerke. Nach Ankündigung durch die SWK und einer Infoversammlung für die Anwohner im Herbst 2024 formierte sich eine Bürgerinitiative gegen den Elektrolyseur: „Zunächstmal-Halt-Wasserstoff!“, die inzwischen über eine gut gestaltete Internetseite verfügt (https://www.haltwasserstoff.de ). Der Widerstand wird mit Bannern, Infoveranstaltungen und Pressearbeit sehr öffentlichkeitswirksam vorgetragen – wenn auch ein kürzlich verteiltes Infoblatt für die Anwohner nach meinem Geschmack ein bisschen zu viel „Katastrophen-Optik“ enthielt. Auch hört man sehr viel grundsätzliches Misstrauen – gegenüber den Stadtwerken, der Stadt, der Industrie überhaupt usw..
Welche Argumente werden diskutiert?
In der Debatte kursieren sehr viele Argumente. Die Kritik richtet sich in erster Linie gegen den geplanten Standort, wie auch bei der Veranstaltung bei den SWK bestätigt wurde. Entsprechend steht die persönliche Betroffenheit im Vordergrund: z.B. Große Speichertanks könnten explodieren. Die Anlage werde (trotz Lärmschutz) sehr laut sein. Die hohe Lärmschutzwand sei hässlich und bedrückend. Abstände würden nicht eingehalten. Die Häuser verlören ihren Wert. Es wird aber auch erweitert argumentiert: Der Wasserschutz nicht gewährleistet. Wasserstoff sei ein Irrweg, ein Konstrukt der Gaslobby. Das Verfahren sei intransparent. Der Nutzen wird in Frage gestellt. Anlage und Busse seien nicht aufeinander abgestimmt. Wasserstoff müsse „importiert“ werden und die Lagerung sei kritisch. Wasserstoffbusse seien ineffizient (siehe dazu auch Blog 19). Die Fördergelder seien „verschwendet“. Und schließlich: Es soll „Überschussstrom“ aus regenerativen Anlagen gespeichert werden; einerseits ein kleiner Schritt in Richtung der Lösung des eingangs geschilderten Überschussdilemmas. Andererseits gibt es in Krefeld noch kaum für diesen Zweck verfügbaren regenerativen Strom (EEG-Anlagenstrom von den Dächern muss an der Börse vermarktet werden). Wohl aber wollen die SWK eine geeignete PV-Anlage bauen. Ob aber dann wirklich ein netzdienliches Konstrukt herauskommt, ist noch zu zeigen. Wirklichen regenerativen „Überschussstrom“ wird es zunächst erst selten geben – jedenfalls zu wenig, um die Busse zu speisen und einen wirtschaftlichen Betrieb es Elektrolyseurs zu ermöglichen. Vermutlich allerdings dann, wenn wir ein Dutzend große Windkraftanlagen in Krefeld haben und v.a. deutschlandweit der Überschussstrom zunimmt......
Wie geht es weiter?
Das Thema ist so komplex und in vielen Punkten umstritten bzw. standpunktabhängig, dass man argumentativ kaum mehr eine Lösung finden kann. Ein Versuch, die zugrunde liegenden bzw. geschürten Ängste zu relativieren wird scheitern. Hinweise auf die Gefahr der Gasleitungen in den meisten der Haushalte, das Risiko der Kraftfahrzeuge (Unfälle, Benzin, Batterien) in den Garagen aber auch die Explosionsgefahr von Tankstellen oder Unfälle im Schrottreaktor Tihange führen zwar zu Debatten, mindern aber nicht die inzwischen zunehmend verhärtete Angst und Gegenwehr. Gewinne für die Lebensqualität (weniger Dieselemissionen und -lärm, Lagerung von Brennstoffen etc.) werden unterbewertet. Auch der Hinweis, dass den Anliegern vielleicht in 10 Jahren preiswerter Wasserstoff für ihre Heizungen angeboten werden könnte (die SWK wollen ja, je nach Entwicklung, eventuell „günstig gelegene“ Siedlungen versorgen) und diese dann die Angst nochmals unter anderem Vorzeichen überdenken müssten, hilft jetzt nicht.
Es bleiben aus meiner Sicht drei aktuelle Wege: 1) Es wird ein anderer Standort gefunden. Schon jenseits des nächsten Gebäudes würde die Angst der Anwohner deutlich reduziert. 2) Die SWK führen das Projekt durch (mit möglichst vielen Sicherheitsmaßnahmen) und die Angst der Anwohner mindert sich im Betrieb. 3) Die SWK treten von dem Projekt zurück.
Subjektive Einschätzung
Für mich persönlich stehen die Klimaveränderungen mit ihren Folgen immer noch ganz oben auf der Gefahrenliste – vor allem für unsere Nachkommen. Deshalb habe ich alle Pioniertechnologien unterstützt und würde mir auch einen Elektrolyseur in Keller oder Garten stellen.
Wie begründet, spricht aus meiner Sicht alles dafür, dass wir Wasserstoff brauchen. Um Zukunftstechnologien durchzusetzen, brauchen wir Förderungen, Pioniere und Massenanwendung für den Hochlauf. Wenn Wasserstoffmobilität den Hochlauf unterstützt, ist dies für mich ein Argument, welches auch bei geringerer Energieeffizienz (vorübergehend) führend sein kann. Wir müssen zudem den Umgang mit Zukunftstechnologien erlernen. Wenn die Stadtwerke früh Erfahrungen sammeln, können sie frühzeitig auch neue Anwendungen erschließen, die Krefeld zugutekommen (z.B. der Industrie). Sie stehen dann auch bereit für die Welle von Überschussstrom, die es eines Tages mit höchster Wahrscheinlichkeit geben wird. Elektrolyseure werde dann Alltag sein, wie heute die Heizungen oder Kraftfahrzeuge, die derzeit (und noch für einige Jahre) ganz still und leise in unseren Kellern und Garagen mit Explosivstoffen arbeiten. Sogar für Privatanwendungen gibt es die Möglichkeit der Zwischenspeicherung von Solarstrom für den Winter mittels Elektrolyseuren. Der Hochlauf wird vieles ermöglichen – siehe Solarenergie. Wohin der Weg führt, wird Jahr für Jahr deutlicher werden (siehe Elektromobilität). Man folgt zunächst den bestbegründeten Hoffnungen. Die Begeisterung kommt in diesem speziellen Fall aber leider wieder zu kurz – wie so oft in der Energiewende.

Wien verfolgt zielstrebig und optimistisch den Plan 2040 klimaneutral zu werden. Bei rund zwei Millionen Einwohnern keine leichte Aufgabe. Aber die Planungen sind schon weit gediehen, detailgenau und sehr konkret, wie der Artikel „Mondlandung in Wien“ in der Oktoberausgabe 2024 der Zeitschrift „Neue Energie“, dem (immer sehr fundiert recherchierten) Magazin des „Bundesverband Windenergie“ beschreibt. Da der Artikel nicht kostenfrei zugänglich ist, hier eine Zusammenfassung:
Die Wiener sind motiviert für die große Aufgabe
Schon in 15 Jahren will Wien klimaneutral sein. Eine halbe Million Gasheizungen müssen ersetzt werden und halb so viele Gasherde. Die Fernwärmeversorgung basiert ebenfalls noch zum Großteil auf Gas. Deshalb sprechen die Akteure von einer „Mammutaufgabe“ bzw. einer „Mondlandung“. Die Regierung betont immer wieder, dass diese Aufgabe nur mit Hilfe der gesamten Stadtgesellschaft gelingen kann. „Ein gemeinsames Bild davon, wie der Weg zur Klimaneutralität von Gebäuden bis 2040 aussehen soll, ist Voraussetzung dafür, dass alle an einem Strang ziehen und mit Optimismus und einem positiven Blick in die Zukunft ihr Zuhause klimafit umgestalten“. Im Fokus stünden „die Chancen, nicht die Hindernisse: Neue Arbeitsplätze und eine auch bei steigenden Temperaturen attraktive Stadt, in der sich auch Leute ohne viel Geld die Miete leisten können. 2040 profitieren alle von geringeren und stabilen Energiekosten“. Eine gut gemachte Klimapolitik bringe die soziale Gerechtigkeit voran.
Die ersten Schritte im Wohnungsbestand
Nur 20% der Wiener leben in Eigentum. Der Gebäudebestand wurde in neun „Dekarbonisierungsgruppen“ unterteilt. Die mit Abstand größte Gruppe sind Etagenwohnungen, die energetisch unsaniert und mit dezentralen Gasheizungen ausgestattet sind. In allen Geschossbauten soll in den kommenden Jahren ein zentrales Leitungssystem für Wärmerohre eingebaut werden. Damit sollen die Häuser so rasch wie möglich an Fernwärme oder ein Netz im Stadtteil angeschlossen werden. Die neuen Rohre können vielfach durch Kamine, Licht- oder Aufzugschächte geführt werden, zur Not auch außerhalb der Fassaden. Dämmung und ggf. Heizungstausch sollen möglichst parallel erfolgen, damit der Energiebedarf sinkt.
Es wird mit Unterstützung der Stadt in 100 Pilothäusern begonnen, um Erfahrungen zu sammeln und Zweifelnde zu überzeugen. Ein Dutzend Beispielprojekte sind bereits fertig. Die Zentralisierung der Heizungen war meist billiger als der Austausch der Etagenheizungen. Bei einem Objekt wurden 85 m tiefe Erdsonden im Innenhof gebohrt, mit denen eine Kombination aus Luft- und Erdwärmepumpen betrieben werden kann, die im Sommer Kühle und im Winter Wärme liefen. Eine PV-Anlage auf dem Dach liefert zusätzlich billigen Strom.
Da die Umbauten nach österreichischem Recht nicht gegen den Willen der Mieter erfolgen kann, müssen diese motiviert werden. Bei der „Hauskunft“ können sich alle kostenlos beraten lassen. Es gibt in vielen Vierteln Unterstützungsstellen, die bei der konkreten Umsetzung behilflich sind. Für die Umstellung bei Kochen und Heizen wurde eine Dekarbonisierungsprämie eingeführt. Ein Leasingsystem für gebrauchte Gasthermen überbrückt, wenn eine Heizung vor Sanierung kaputt gehen sollte.
Ab 2026 sollen hundert Haushalte an jedem Werktag umgestellt werden. Das Investitionsvolumen liege bei jährlich 1,6 Mrd. Euro. Die Kosten verteilen sich grob zu je einem Drittel auf Stadt, Bund und Eigentümer (sehr hoher Anteil städtischer Wohnungen in Wien!). Allerdings sei zu berücksichtigen, dass auch bei Unterlassen der flächendeckenden Sanierung Kosten für Modernisierung, Reparatur und Haustechnik anfallen würden (ganz zu schweigen von steigenden fossilen Heizkosten und den Klimafolgekosten).
Umbau der Fernwärmeversorgung
Wie Krefeld hat auch Wien ein Fernwärmenetz. 1200 km Leitungen sind vorhanden, 40% der Wohnungen sind angeschlossen. 500 km sollen jetzt zusätzlich gebaut werden, um die Anschlussquote auf 56% zu erhöhen. Zusätzlich sind in vielen Stadtteilen Nahwärmenetze angedacht. Nur locker bebaute Wohngebiete sollen individuelle Lösungen finden.
Die Stadtwerke Wien betreiben bereits einen 3-MW-Elektrolyseur, der Linienbusse betankt. Ein Kraftwerk läuft bereits mit einer Wasserstoffbeimischung. Auch in Wien sind vier Müllverbrennungsanlagen wichtige Wärmequellen. Zusätzlich aber soll Abwärme aus Bürogebäuden, Supermärkten, Gewerbebetrieben, Serverfarmen und Abwasserleitungen ihre jeweilige Umgebung unterstützen. Tiefengeothermie soll erschlossen werden und rechnerisch rund 200.000 Haushalte versorgen. Für die Dekarbonisierung der Fernwärme werden Kosten von 2,2 Mrd. Euro veranschlagt. Die Eigenmittel werden überwiegend aus den Gewinnen des Unternehmens und seiner Beteiligungen finanziert.
Die Transformation schafft Arbeitsplätze
Die energetische Transformation wird auch den Wirtschaftsstandort Wien stärken. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifoso) rechnet, dass allein die Investitionen der Stadtwerke in den letzten fünf Jahren bereits 10.000 Arbeitsplätze generiert hätten. Andererseits muss auch dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegengetreten werden. Studien zum Bedarf wurden auf den Weg gebracht, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen werden geplant, die Lehrpläne für Berufsschulen überarbeitet. Eine Koordinationsstelle hilft, dass alles ineinandergreift. Das Motto: „Die ganze Stadt als Dream-Team Wien!“
Und wie sieht es in Krefeld aus?
Auch Krefeld ist, wie Wien, auf einem guten Weg. Stadtverwaltung und Stadtwerke sind motiviert und arbeiten an der Wärmeplanung als Grundlage für weitere Maßnahmen. Parallel aber werden schon diverse „no-regret“-Maßnahmen auf den Weg gebracht. Parallel werden von den Stadtwerken im Rahmen einer BEW-Studie (Bundesförderung für effiziente Wärmenetze) bereits Maßnahmen zur „Vergrünung“ der Krefelder Fernwärmeversorgung detailliert.
Wie Wien zeigt, brauchen wir für eine erfolgreiche Transformation sehr konkrete Pläne (Leuchturmprojekte, Strukturen, Verfahren, Regeln und Unterstützungen). Für Wien sind diese in dem Konzept “Raus aus Gas - Wiener Wärme und Kälte 2040” zusammengefasst (https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/pdf/waerme-und-kaelte-2040.pdf )
In Krefeld wirde es am 20.3.2025 wird es im KLIMA-Ausschuss einen weiteren Zwischenbericht zur Krefelder Wärmeplanung geben. Die Details werden immer konkreter und nähern sich der Umsetzungsreife. Es soll unter anderem auch der Beginn der Öffentlichkeitsarbeit besprochen werden, damit auch in Krefeld das Bewusstsein wächst, dass die Umstellung unseres Energiesystems von allen Krefeldern aktiv getragen werden muss. Dass diese uns letztlich aber auch allen nützen wird. „Dream-Team Krefeld?“
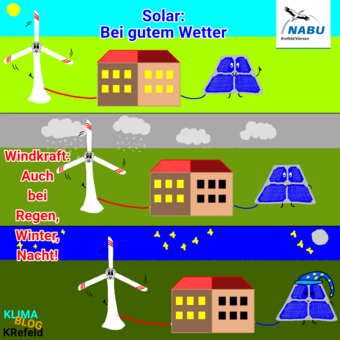
Blog 41 beschäftigte sich schon mit der Windkraft, dem „Arbeitspferd“ der Energiewende. Viele gute Gründe für Windkraftanlagen in Krefeld wurden aufgeführt - auch deren Beitrag zur lokalen Wertschöpfung und sogar zur Finanzierung lokaler sozialer Initiativen. Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Potenzialanalyse ermittelte im vergangenen Jahr über zwanzig theoretisch mögliche Standorte. Möglichst viele zu realisieren, würde die Klimabilanz von Krefeld beträchtlich verbessern. Der KLIMA-Ausschuss beauftragte die Stadtverwaltung am 31.10.2024 mit seltener Einmütigkeit, an 19 dieser Standorte die Möglichkeit der Errichtung von Anlagen konkret zu prüfen.
Bremsversuch im Hochsauerlandkreis
In anderen Bereichen von NRW scheint nicht so viel Einmütigkeit geherrscht zu haben. Das Sauerland fühlte sich überrannt von Voranfragen für die Errichtung von Windkraftanlagen. Diese beschränkten sich nicht auf die in der Landesregierung in Vorbereitung befindlichen Vorranggebiete für Windkraft, die in den Regionalplänen ausgewiesen werden sollen, sondern viele hundert lagen außerhalb der Gebiete. Damit beeinträchtigten sie die Planungen und erweckten die Sorge „ungeordneten“ Ausbaues. Ausgerechnet im Hochsauerlandkreis, dem Wahlkreis von Friedrich Merz, hatte die Ablehnung eines Antrages vor Gericht keinen Bestand. Die der Ablehnung zugrunde liegende Vorschrift im Landesplanungsgesetz (LPG) NRW wurde vom Oberlandesgericht gekippt. Im September 2024 bat die Landesregierung NRW deshalb die Bundesregierung eine Maßnahme zur „Übergangssteuerung“ des Ausbaues der Windenergie zu treffen (https://www.zfk.de/politik/deutschland/bremse-fuer-windausbau-habeck-kommt-merz-entgegen ).
Habeck kommt Merz entgegen – aber die CDU handelt parallel
Das Bundesministerium für Wirtschaft (BMWK) machte sich an die Arbeit. Gleichzeitig aber brachte die Bundes-CDU einen weitergehenden Antrag ein, der auch Änderungen in anderen Gesetzen umfasste. Der Bundestag überarbeitete den Antrag aber grundlegend und beließ es schließlich bei der Änderung des BImSchG §9 Abs. 1a, die am 31.1.2025 vom Bundestag angenommen wurde (https://dserver.bundestag.de/btd/20/147/2014777.pdf - noch unlektorierte Fassung vom 29.1.2025).
Der nach Satz 1 im §9 Abs. 1a des BImSchG neu eingefügte Satz soll die Privilegierung von Windkraft-Voranträgen für Gebiete außerhalb von in der Regionalplanung ausgewiesenen Vorranggebieten aushebeln. Die Gesetzesänderung muss noch durch den Bundesrat und kann voraussichtlich im Merz – nein: März – 2025 in Kraft treten. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) kommentiert das Ergebnis im Wesentlichen positiv (https://www.bdew.de/energie/steuerung-des-windenergieausbaus/ ). Da nur Voranträge betroffen seien, könnten laufende, komplett eingereichte Anträge weiter bearbeitet werden. Der Schaden für den Ausbau sei gering. Der Bundesverband Windenergie (BWE) ist auch nicht so sauer, da er Schlimmeres erwartet hätte: https://www.wind-energie.de/presse/pressemitteilungen/detail/geplante-bimschg-aenderung-schmerzhaft-aber-tragfaehig-um-windenergieausbau-zu-steuern/ .
Auch das Land NRW wird tätig
Der Landtag NRW verabschiedete praktisch gleichzeitig eine Änderung des §36 Landesplanungsgesetzes (LPG) NRW(https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD18-12683.pdf - Änderungsantrag vom 29.1.2025). Der neu eingefügte §36a verbietet den Behörden nun für sechs Monate Entscheidungen über Windkraft-Vorhaben, die außerhalb der vom Regionalplan vorgesehenen Vorranggebieten liegen. Es gilt nicht für Repowering oder Anlagen deren Antrag bereits vollständig vorliegt. Ausnahmen können unter bestimmten Bedingungen beantragt werden.
Das NRW-Wirtschaftsministerium begründet die Maßnahme auf seiner Homepage wie folgt: https://www.wirtschaft.nrw/uebergangssteuerung-windenergie-faq#:~:text=September%202024%20hat%20die%20Landesregierung,Planungs%2D%20und%20Investitionssicherheit%20zu%20garantieren.
Der Städte- und Gemeindebund kommentiert erfreut (https://www.kommunen.nrw/presse/pressemitteilungen/detail/dokument/nrw-schafft-wirksame-steuerungsregelung-fuer-windenergie.html ).
Was sagt der Regionalplan zu Windkraft in Krefeld?
Der gegenwärtige Regionalplan für Krefeld konsultiert besteht aus vier Blättern:
Krefeld Nordwest: https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2024-12/20241029_3_32_rpd_plan_teil4zd13_opti150maxbild.pdf
Krefeld Nordost: https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2024-12/20241029_3_32_rpd_plan_teil4zd14_opti150maxbild.pdf
Krefeld Südwest: https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2024-12/20241029_3_32_rpd_plan_teil4zd18_opti150maxbild.pdf
Krefeld Südost: https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2024-12/20241029_3_32_rpd_plan_teil4zd19_opti150maxbild.pdf
Windenergiegebiete sind diagonal schraffiert dargestellt (z.B. auf Blatt 18 ein kleines Gebiet nordwestlich von Willich-Münchheide). In Krefeld gibt es kein Vorranggebiet für Windkraft – nicht einmal auf der Kempener Platte.
Wird es also keine weiteren Windkraftanlagen in Krefeld geben?
Die in Krefeld bestehenden Windkraftanlagen sind schon in die Jahre gekommen und könnten durch neue, wesentlich ertragreichere Anlagen ersetzt werden, denn dieses „Repowering“ wird von den Gesetzen nicht ausgeschlossen. Aber was ist mit den anderen Standorten, die die Potenzialplanung identifiziert hat?
Aktuell wird der Regionalplan überarbeitet – offenbar nicht zuletzt wegen der angestrebten Ausweisung von Windkraft-Vorranggebieten. Kommen die Krefelder Potenzialgebiete hinein? Eher nicht: Da es sich ganz überwiegend um Einzelstandorte handelt, ist sehr unwahrscheinlich, dass sie in den Regionalplan aufgenommen werden. Dieser dient eher dazu, größere Windparks anzureizen, um die CO2-Minderungsziele zu erfüllen. Aber wir wollen in Krefeld doch auch einen Beitrag leisten? Das „Moratorium“ des Landesgesetzes kann nach §36a Abs 4 auf Antrag ausgesetzt werden, wenn dadurch die Regionalplanung nicht gestört wird, was in Krefeld nicht der Fall wäre. Aber hebelt das auch das Bundesgesetz aus?
Nun wird die Sache sehr kompliziert. Zu kompliziert, um sie hier detailliert zu erklären. Wer sich vertieft informieren will, kann z.B. die Stellungnahme von Rechtsanwalt Lahme auf der Homepage des Landesverbandes Erneuerbare Energien (LEE) lesen (https://www.lee-nrw.de/blog/ist-die-panik-berechtigt-ein-beschluss-des-ovg-nrw-sorgt-fuer-aufregun/ ). Auch dort wird nur ein Teil der Problematik diskutiert. Es ist eine Vielzahl von Gesetzen und Verfahren zu berücksichtigen. Es wird auch unterschiedliche Auffassungen zu Gewichtungen geben, so dass man trefflich streiten könnte. Es sieht aber so aus, als wenn die Novellierung der beiden Gesetze Krefeld nicht wirklich verbieten kann, Windkraftanlagen auf ihrem Gebiet zu genehmigen.
Krefeld sollte schnell handeln
Krefeld hätte also Chancen! Es könnte allerdings durchaus sein, dass zukünftige Regierungen der Windkraft noch entschlossener Grenzen setzen wollen. Dann könnten die bestehenden Wege für Krefeld eventuell verschlossen werden. Insofern ist rasche Klärung der tatsächlich möglichen Standorte und ein rascher Beginn von Genehmigungsverfahren dringend notwendig! Gut dass wir schon eine so schöne Potenzialanalyse als Grundlage haben.
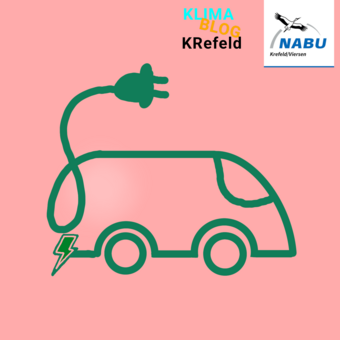
Dem Artikel „Die Zukunft ist Bidirektional“ von Krisztina André und Eric Boon in der Zeitschrift „Solarzeitalter“ (2-2024) von Eurosolar e.V. verdanke ich interessante Erkenntnisse über die Stadt Utrecht und das bidirektionale Laden der dortigen Elektrofahrzeuge. Hier einige Gesichtspunkte kurz zusammengefasst:
Folgende Daten seien vorausgeschickt
Einwohner: Utrecht 375.000 (Krefeld 228.500)
Elektrofahrzeuge: Utrecht 140.000 (Krefeld 5.200)
Zahl der öffentlichen Ladesäulen:
2022: Utrecht 1.200 (Kr 69); 2024: 3.900 (167); 2027 (geplant): 5.900 (510?)
Eindrucksvoll die Karte der Ladestationen in Utrecht: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/vervoer/elektrisch-vervoer/openbare-laadpalen
V2G - die Besonderheit in Utrecht:
Fast alle öffentlichen (und ein Großteil der privaten) Ladesäulen sind bidirektional ausgelegt. D.h. man kann die Batterie des Fahrzeuges darüber laden, aber auch Strom aus der Fahrzeugbatterie zurück ins Netz laden („V2G“ = vehicle to grid = Fahrzeug ins Netz; es gibt auch „V2H“ = Vehicle to home). Der Clou: Utrecht könnte darüber sein Stromnetz stabilisieren. Es gibt aktuell 1.200 Trafostationen. Für 100% erneuerbaren Strom wären 800 weitere notwendig. Diese würden aber großenteils nicht benötigt, wenn der Ausgleich des Stromnetzes von E-Autos übernommen würde. Ein konkreter Testlauf mit 500 Car-Sharing-Fahrzeugen wurde jetzt begonnen (https://media.renaultgroup.com/renault-group-we-drive-solar-and-mywheels-join-forces-with-the-city-of-utrecht-to-launch-europes-first-v2g-enabled-car-sharing-service/ ). Teurer Netzausbau würde eingespart. 150.000 m2 Baugrund für die Trafostationen würden für andere Zwecke frei.
Autobatterien als Netzstabilisatoren in Deutschland?
Auch in Deutschland wächst der Stromspeicherausbau zur Stabilisierung des Netzes erfreulicherweise exponentiell. Dies ist zur Stabilisierung des Netzes bei steigendem Anteil von Wind- und Sonnenstrom dringend notwendig. Wir haben schon 2GWh Kapazität in Großspeichern. Es wartet noch das mehr als Hundertfache (240 GWh) an Anträgen auf Bearbeitung. Es geht aber schleppend voran, da der Leitungsausbau hinterherhinkt. Private Speicher an heimischen Photovoltaikanlagen kommen aber auch schon auf 14 GWh. Da sie noch nicht gesteuert werden können und die dynamische Preisgestaltung erst langsam anläuft, verhalten sie sich noch nicht wirklich netzstabilisierend. 50mal die Kapazität der bestehenden Großspeicher aber steckt in unseren rund 1,5 Millionen Elektroautos, nämlich rund 100 GWh. Um diese zu nutzen, benötigt man bidirektional arbeitende Ladestationen (V2G) und Autos, die darauf ausgelegt sind. Welche dies sind, kann man auf der Webseite des Münchener „Mobility House“ (https://www.mobilityhouse.com/de_de/elektroautos.html ) aktuell nachlesen (u.a. der Hyundai Ioniq 5 und 6, der Kona SX2, der Kia EV6, der Polestar und neuerdings der Renault 4 und 5).
Leider wächst der E-Autobestand in Deutschland bei weitem nicht so rasant wie in den Niederlanden und speziell in Utrecht. Die Rahmenbedingungen für bidirektionales Laden sind noch nicht geregelt (z.B. https://nationale-leitstelle.de/bidirektionales-laden-flaechendeckend-ermoeglichen-beirat-der-nationalen-leitstelle-ladeinfrastruktur-praesentiert-handlungsempfehlungen-im-bmdv/ mit Link zu ausführlichen Handlungsempfehlungen), allerdings erkennt die Regierung dessen mögliche Bedeutung an (https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2022/08/Meldung/News1.html ). Es gibt auch schon einzelne Pilotprojekte (https://www.transnetbw.de/de/newsroom/pressemitteilungen/grosse-fortschritte-bei-kuenftiger-netzstabilisierung-durch-e-autos , https://www.eon.com/de/innovation/innovation-in-aktion/innovation-news/bi-clever-zeigt-revolutionaeres-potenzial-von-bidirektionalem-laden.html?__cf_chl_tk=13JmH_Lko_yI1E6rz.PR6X9F3rOgFfXzsmod8aeczj4-1738840721-1.0.1.1-rPApeK1DYxj.Rane78YHfLxaAv4XpOvgLw6fx4.sZDo , https://www.iwr.de/news/pilotprojekt-transnet-bw-und-octopus-wollen-e-auto-flexibilitaet-fuer-netzstabilisierung-nutzbar-machen-news38704 ). Dynamische Tarife die zeitlich optimiertes Laden ermöglichen und honorieren, werden gerade erst eingeführt (z.B. https://www.zfk.de/mobilitaet/e-mobilitaet/neuer-ladetarif-der-rheinenergie-verlagert-strombezug-in-guenstigen-zeiten ). Um so wichtiger, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen (in Deutschland, in Krefeld und privat).
Schadet bidirektionales Laden nicht der Batterie?
Da dies eine häufige Sorge ist, die E-Auto-Besitzer zögern lässt: Nein, Batterien leiden eher, wenn sie völlig statisch herumstehen. Laden und Entladen im mittleren Bereich ist eher lebensverlängernd (Studie Uni Warwick von 2017: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544217306825?via%3Dihub#! , von RWTH Aachen bestätigt https://www.pv-magazine.de/2024/04/12/vehicle-to-grid-verlaengert-die-lebensdauer-von-batterien-in-elektroautos/ ). Für weitere Informationen zu V2G siehe z.B. die Links in https://www.hivepower.tech/de//blog/beeinträchtigen-v2g-aktivitäten-die-lebensdauer-der-evs-batterie .
Wie sieht es denn mit E-Mobilität in Krefeld aus?
Wie oben ersichtlich, hinken wir in Krefeld den Niederlanden (und erst recht den Norwegern) noch mehr hinterher als manche anderen deutschen Städte. Am 27. August 2024 wurde im Planungsausschuss immerhin mit breiter Mehrheit ein 112-seitiges Elektromobilitätskonzept verabschiedet (https://ris.krefeld.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWWTl1Md1lZAnrMcT4t7aEmwW-uRrLUydBokvUT3rw-5/Abschlussbericht_EMK_Krefeld.pdf ), welches darlegt, wie Elektromobilität in Krefeld gefördert werden soll. Es enthält, relativ zu Utrecht, bescheidene Ziele:
2024 lag Krefeld mit rund 5.200 zugelassenen E-PKW (rein und Hybrid) mit 4,2% unter dem NRW-Schnitt (4,9%). Vor allem aber schnitt Krefeld mit 167 Ladepunkten und damit 31 PKW pro Ladepunkt unterdurchschnittlich ab (NRW: 19 E-PKW pro Ladepunkt). Prognostiziert werden bis 2030 35.500 E-PKW, die 2.430 öffentliche Ladesäulen benötigen würden. 2035 sollen es 66.600 PKW sein und 4.743 benötigte Ladesäulen.
Ladesäulen wurden im öffentlichen Raum bisher nur von den Stadtwerken installiert. Es soll noch Anfang 2025 ein erstes Bündel von erwünschten Standorten auf der Basis von Bedarfsprognosen und Umfragen veröffentlicht werden, auf die sich auch andere Betreiber bewerben können. Im Laufe des Gesamtjahres 2025sollen sechs Bündel veröffentlicht werden mit 157 Standorten und insgesamt 510 Ladestationen. An 86 der potenziellen Standorte ist eine Verknüpfung mit weiteren Mobilitätsangeboten möglich (Carsharing, E-Tretroller-Sharing, Bikesharing, Radabstellanlagen). Im Rahmen des Elektromobilitätskonzeptes ist auch die sukzessive Umstellung des Fuhrparkes der Stadt auf E-Fahrzeuge geplant und eine Kommunikationsstrategie wird vorgeschlagen. Insgesamt sind es 21 konkrete Maßnahmen.
Was muss also in Krefeld geschehen, um Utrecht nachzueifern?
Neben der Verlagerung des Verkehres auf andere Verkehrsträger (Rad, ÖPNV etc.), ist die Umstellung auf Elektromobilität ein zentrales Erfordernis der Energiewende. Alternative Antriebe (Wasserstoff, Synfuels) werden wegen ihrer energetischen Ineffizienz allenfalls ein Nischendasein erreichen.
Finanzielle Förderung hilft der E-Mobilität. Die Niederlande haben eine hohe Förderung (https://ecomento.de/2023/03/07/niederlande-foerdern-e-autos-am-ueppigsten-gefolgt-von-frankreich-und-deutschland/ ). Nach der Ende 2024 unglücklich ausgestoppten E-Auto-Förderung in Deutschland, verlangsamte sich bei uns die Zulassung von E-Mobilen. Entsprechende Förderprogramme können allenfalls von der Bundesregierung wieder eingesetzt werden, sind aber, bei weiterer Verbesserung des Fahrzeugangebotes möglicherweise immer weniger vordringlich. Entscheidender Flaschenhals bleibt dann die Ladeinfrastruktur. Jeder auf öffentliche Lademöglichkeiten angewiesener „Elektroautopionier“ kann davon ein Lied singen – besonders in Krefeld. Das fördert die „Reichweitenangst“ und bremst die Lust auf E-Autos.
Einfamilienhausbesitzer können eine eigene Wallbox installieren und sind dann nur bei längeren Reisen auf die E-Mobilitätsfreundlichkeit anderer Städte angewiesen. Alle anderen Krefelder sind auf Unterstützung angewiesen. Mehrfamilienhäuser müssen ab einer gewissen Parkplatzzahl Lademöglichkeiten vorsehen – allerdings nur im Neubau bzw. bei Renovierung. „Private“ Ladesäulen entstehen auch auf Firmenparkplätzen für die Mitarbeiter oder für Kunden an Supermärkten, Schnellrestaurants, Tankstellen etc.. Das Mobilitätskonzept schätzt, dass 60% des Ladebedarfes solchermaßen „privat“ abgedeckt werden wird. Es bleiben 40% des Ladebedarfes, der an öffentlichen Ladesäulen gedeckt werden muss. Hier sind Stadt, SWK und andere Anbieter gefragt.
Krefeld kann hier etwas bewirken. Notwendig sind unter anderem (siehe auch Konzept):
- Positive Grundeinstellung zur Mobilitätswende inklusive E-Mobilität, aktive Kommunikation, Anreizsysteme etc.
- rascher Ausbau der Ladeinfrastruktur in Krefeld (inkl. notwendiger Verwaltungsstruktur)
- Optimierung der Ladefreundlichkeit (Findbarkeit, Zugänglichkeit, Falschparker etc.)
- Einrichtung von Mobilitätsstationen
- Beratungsangebote für Firmen
- Berücksichtigung auch von Nutzfahrzeugen
- Vorbildliche Elektrifizierung der Fuhrparke der Stadt und städtischer Betriebe
- synchroner Ausbau des Stromnetzes.
Die Landesregierung NRW stellt Fördermittel im Rahmen von „progres.nrw“ bereit: https://www.wirtschaft.nrw/nordrhein-westfalen-wird-klimaneutral-land-unterstuetzt-ambulante-soziale-dienste-carsharing.
Zukunftsmusik V2G?
In Utrecht deutet sich schon an, dass die Zusatznutzung der Autobatterien als Netzstabilisator den Preis für das Tanken beträchtlich reduzieren kann. Zukunftsvision wäre dann: „Tankstrom zum Nulltarif!“
Ob für Krefeld auch V2G sinnvoll sein könnte, sollte frühzeitig geprüft werden, um den Ausbau von Ladesäulen und Netz ggf. darauf auszurichten. Im Elektromobilitätskonzept ist V2G nicht erwähnt. Die SWK haben bieten zwar einen „Autostrom-Tarif“ an, aber bisher undynamisch und natürlich ohne V2G, da ja noch der regulatorische Rahmen fehlt. Ich gehe aber davon aus, dass der gesetzliche Rahmen früher oder später kommen wird, denn die dynamische Netzsteuerung ist ein wichtiges Zukunftsthema. Es gibt sogar schon Software für Energieversorger (z.B. von Mobility House https://www.zfk.de/mobilitaet/e-mobilitaet/mit-400-euro-ersparnis-gewinnst-du-alle-e-auto-fahrenden#:~:text=The%20Mobility%20House%20bietet%20Energieversorgern,und%20worauf%20er%20noch%20wartet.&text=Energieversorger%20können%20ihren%20Kunden%20einen%20intelligenten%20Ladetarif%20anbieten. ), womit Mobil-Stromkunden zukünftig hunderte von Euro im Jahr sparen könnten. Vielleicht doch jetzt schon mal nach Utrecht gucken?
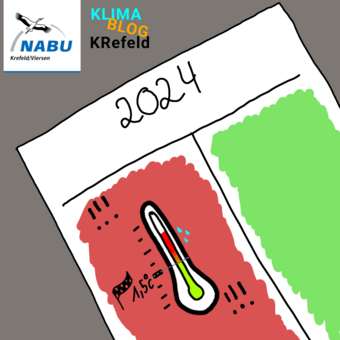
Der Jahresanfang lädt ein, zu bilanzieren. Was hat 2024 für den Klimaschutz gebracht? Weltweit, in Deutschland und in Krefeld. Dazu ein paar ausgewählte Schlaglichter (mit über 60 Links, die leider das Textverständnis erschweren aber vielleicht hie und da zum Weiterlesen animieren):
Weltweit
Minus: 2024 ist es passiert: Die globale Jahres-Durchschnittstemperatur hat für 2024 erstmalig die Grenze von 1,5 Grad durchbrochen (https://wmo.int/media/news/climate-change-impacts-grip-globe-2024 ) – und zwar deutlich: 1,6 Grad, 0,12 Grad über dem Vorjahresmittel!!! (https://climate.copernicus.eu/copernicus-2024-first-year-exceed-15degc-above-pre-industrial-level ). Mancherorts wird das Überleben schwierig (https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-delhi-hitze-100.html ). Das Klimaziel von Paris betrachtet man allgemein zwar erst als gescheitert, wenn dies mehrfach in Folge passiert (20 Jahre im Durchschnitt) und man hofft darauf, dass 2024 noch das El-Nino-Phänomen zum Temperaturanstieg beitrug und es 2025 wieder kühler wird. Die Vorzeichen stehen aber nicht gut. Zu deutlich scheint der Temperaturanstieg der letzten beiden Jahre, zu deutlich ist der Anstieg der globalen Meerestemperatur. Die Senken nehmen immer weniger CO2-auf oder werden zu Emittenten (z.B. Brasiliens Regenwald https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/amazonas-regenwald-auf-der-kippe-waldverlust-verstaerkt-den-klimawandel , der deutsche Wald https://www.thuenen.de/de/newsroom/presse/aktuelle-pressemitteilungen/detailansicht/aelter-vielfaeltiger-weniger-speicher-so-steht-es-um-deutschlands-waelder , die Meere https://www.tagesschau.de/wissen/klima/co2-meer-klimawandel-101.html , die Tundra https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2024/tauende-tundra-wird-zur-kohlenstoff-quelle/ , https://www.nature.com/articles/s41467-024-54990-9 ), der Temperaturanstieg wird immer schneller (https://www.tagesschau.de/wissen/erderwaermung-beschleunigung-100.html ).
Minus: Die „Global Climate Highlights” des europäischen Wetterdienstes Copernicus führt noch eine Reihe weitere „Rekorde“ für 2024 auf: Jedes der letzten 10 Jahre war eines der 10 wärmsten; 11 Monate des Jahres 2024 lagen 1,5 Grad über dem vorindustriellen Mittel; 2024 war das wärmste Jahr für alle Kontinente außer Australien und Antarktis; die Meeresoberflächentemperatur lag 0,51 Grad oberhalb des Durchschnittes 1991-2000; die Menge des in der Luft gelösten Wassers erreichte 2024 eine Rekordmenge; entsprechend gab es in der Nordhemisphäre eine Rekordzahl an „Hitzestresstagen“, am 10. Juli waren 44% der Erde von Hitzestress betroffen; die Ausdehnung des Meereises um die Antarktis erreichte 2024 ein Rekordminimum (https://climate.copernicus.eu/copernicus-2024-first-year-exceed-15degc-above-pre-industrial-level ).
Minus: Auch in 2024 hat kein Land der Welt ausreichende Maßnahmen ergriffen, seinen Beitrag zum Einhalten des Temperaturanstieges von 1,5 Grad (Paris-Ziel) zu realisieren, nur 10 Länder „fast ausreichende“ (https://climateactiontracker.org/countries/ ). Das Climate Action Tracker Thermometer zeigt, mit welchen Temperaturanstiegen (1,9 bis 2,7 Grad), abhängig von umgesetzten Maßnahmen, jetzt zu rechnen ist (https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/ ). Leider drohen mit höherer Temperatur immer drastischere Kipp-Punkte im globalen Klima (siehe Blog 53).
Minus: Die IRENA (International Renewable Energy Agency) rechnet in ihrem „World Transition Outlook“ vor, dass mit den gegenwärtigen Politikmaßnahmen nicht die in Dubai vereinbarte Verdreifachung der Solarleistung bis 2030 weltweit erreicht wird (https://www.cleanthinking.de/copy29-world-energy-transitions-outlook-2024/ )
Minus: Drei wichtige internationale Umweltkonventionen „scheiterten“ 2024: Biodiversität, Plastikverschmutzung und Wüstenbildung. Die Klimakonvention rettete sich nur knapp über die Hürde der letzten Vertragsstaatenkonferenz. Die zugesagten Mittel für Klimafolgenbekämpfung reichten nur sehr knapp aus, ein Scheitern zu vermeiden. Die Notwendigkeit des Ausschleichens von Öl wurde, im Gegensatz zur Vorkonferenz, jedoch nicht mehr bekräftigt (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-27/climate-diplomacy-in-2024-cop29-cop16-plastic-treaty-talks ).
Minus: An die vielen Extremwetterereignisse (z.B. Fluten in Südspanien, Hurricane-Duo in Florida, Taifun in Vietnam, Dürren im Amazonasbecken und Namibia, Überschwemmungen in Afghanistan, Ost- und Westafrika, Südbrasilien und auch Zentraleuropa) sei nur kurz erinnert. 2024 kamen 8700 Menschen bei wasserbedingten Katastrophen ums Leben, 40 Millionen wurden vertrieben. Der jährlich erscheinende Global Water Monitor kommt zu dem Ergebnis, dass der globale Wasserkreislauf durch die Klimaveränderungen aus dem Gleichgewicht gekommen sei. Niederschlags-Rekordtage seien 2024 um 52 Prozent häufiger gewesen als zu Beginn des Jahrhunderts (https://www.n-tv.de/wissen/Wasserkreislauf-geraet-aus-dem-Gleichgewicht-article25469691.html und https://www.globalwater.online/globalwater/report/index.html ). Und mit Trockenheit kommen Feuer:
Minus: In Brasilien brannte 2024 Wald von der Größe Italiens nieder (https://www.wwf.de/2024/dezember/waldbrand-jahresrueckblick-2024#:~:text=Über%2014%20Millionen%20Hektar%20Fläche,sich%20hier%20auf%20139%20Prozent. ). Auch in Chile gab es 2024 die tödlichsten Waldbrände seit Aufzeichnungsbeginn; 14.000 Häuser niedergebrannt (https://www.ctif.org/de/news/wildfeuer-chile-2024-wurden-tot-geschlagen-rekord ) - man hörte hier kaum davon, da so viel brennt. Wohl aber von Kalifornien, als Jahresauftakt 2025: Feuer mit an Endzeitfilme erinnernder Heftigkeit (200.000 Menschen evakuiert) ausgerechnet um Hollywood (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-08/los-angeles-under-siege-as-wind-driven-wildfires-upend-city ). Die Meereserwärmung wirkte mit (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-08/los-angeles-fires-and-winter-drought-likely-linked-to-ocean-heat ). Es ist mit Abstand die teuerste Feuerkatastrophe der USA und wird die kalifornische Notversicherung an ihre Grenzen bringen (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-08/los-angeles-fires-become-existential-test-for-california-s-stopgap-insurer ).
Minus: Die zahlreichen Naturkatastrophen trieben auch weltweit die Versicherungen 2024 wieder zu den höchsten Ausgaben seit 2017 (Hurrikane Harvey, Irma und Maria). (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-09/extreme-weather-drives-insured-losses-to-highest-since-2017 ).
Minus: Wissenschaftlichen Ergebnissen wird aber zunehmend einfach widersprochen oder sie werden ignoriert. Beispielsweise wurde trotz gegenteiliger Studien (https://www.climameter.org/20241029-south-east-spain-floods ) oft behauptet, die Fluten in Spanien im Herbst 2024 hätten mit dem Klimawandel nichts zu tun. Dass die Kosten des Klimawandels ungleich höher als dessen Bekämpfung sein werden wurde 2024 erneut berechnet (https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/38-billionen-dollar-schaeden-pro-jahr-19-einkommensverlust-weltweit-durch-klimawandel ). Dennoch nimmt Klima-Desinformation – besonders in den sozialen Netzwerken – eher zu (Beispiel aus 2024: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/klimawandel-desinformation-102.html ). Gezielte Fehlinformation wird von interessierter Seite seit Jahren gefördert (https://de.wikipedia.org/wiki/Klimawandelleugnung ), fällt aber in Zeiten der Unsicherheit und Veränderungsüberdruss auf fruchtbaren Boden und wird von populistischen Politikern immer häufiger ausgeschlachtet. Überall sind klimaskeptische Parteien auf dem Vormarsch und gewinnen sogar Wahlen (aktuell USA und Österreich).
Minus: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi-Group und andere amerikanische Großbanken verließen die UN-unterstützte „Net-Zero-Banking-Group“, die sich dem 1,5-Grad-Ziel verpflichtet hatten (https://nypost.com/2025/01/02/business/morgan-stanley-joins-goldman-sachs-citi-in-exodus-from-climate-alliance/ ). Die Allianz hat damit immer noch 140 Mitglieder in 44 Ländern; die US-Banken aber hatten mit gut 13 Billionen Dollar Bilanzsumme großes Gewicht. Entsprechende Absetzbewegungen von Klimaverpflichtungen gibt es auch in anderen Bereichen der Wirtschaft (z.B. https://www.wiwo.de/unternehmen/banken/finanzmarkt-desiree-fixler-war-eine-ikone-der-gruenen-bewegung-jetzt-schimpft-sie-auf-nachhaltigkeit/30158918.html ) und in ganzen Ländern. Zuletzt kündigte der neue US-Präsident Donald Trump an, aus der Klimakonvention austreten zu wollen. Zum Glück aber haben immerhin noch 94 Prozent der Fortune Global 500 Firmen Klimaschutz-Selbstverpflichtungen irgendeiner Art.
Gemischt: Großbritannien stellte am 1.10.2024 sein letztes Kohlekraftwerk ab und will sein Stromnetz bis 2030 komplett dekarbonisieren (https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-12-17/keir-starmer-shoots-for-the-moon-on-clean-energy-finally ). Damit haben zusammen mit Belgien, Österreich, Schweden und Portugal fünf europäische Staaten den Kohleausstieg abgeschlossen (weitere wollen 2025 folgen, z.B. Italien, Ungarn). Allerdings zeigt eine neue Studie der Internationalen Energieagentur (IEA), dass der weltweite Kohleverbrauch bis ca. 2027 weiter steigen wird (https://www.iea.org/news/global-coal-demand-is-set-to-plateau-through-2027 )
Gemischt: Immer häufiger werden große Wasserstoffprojekte verkündet. Allerdings sind es oft nur Ankündigungen. Viele Projekte „wackeln“ anschließend (https://www.zeit.de/news/2025-01/02/wasserstoffprojekte-in-sachsen-anhalt-wackeln ). Erfreulicherweise werden aber auch immer häufiger „Finale Investitionsentscheidungen“ (FID) getroffen – in Deutschland zuletzt für einen Großelektrolyseur in Lingen (https://www.bp.com/de_de/germany/home/presse/pressemeldungen/pm-2024-12-18-bp-verkuendet-investitionsentscheidung-fuer-projekt-lingen-green-hydrogen.html ). Um die globalen Wasserstoffziele zu erfüllen, müssen sich die Projekte aber noch mehr als vertausendfachen. Dagegen spricht, dass die Wasserstoffpreise für Jahrzehnte hartnäckig hoch bleiben sollen (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-23/green-hydrogen-prices-will-remain-stubbornly-high-for-decades ). Die EU unterstützt unzureichend (https://www.efuel-alliance.eu/fileadmin/Downloads/Pressemitteilungen_2024/20241121_PM_H2_Ziele_verfehlt.pdf ). Dennoch konkretisieren sich auch die einzuschlagenden Wege hin zu einer Wasserstoffwirtschaft. Eine umfassende Analyse veröffentlichte Ende 2024 das Projekt „HYPAT – H2-Potentialatlas“(Fraunhofer-Institut u.a.) im Auftrag des Forschungsministeriums (Abschlussbericht unter https://hypat.de/hypat-wAssets/docs/new/publikationen/HYPAT-Abschlussbericht.pdf ).
Plus: Der Zubau von Solaranlagen weltweit schlug alle Rekorde: Neben großen Märkten wie China, Indien und Deutschland legten auch „neue“ Aspiranten wie Saudi Arabien und Pakistan mächtig zu. China liegt uneinholbar an der Spitze und baute erneut in Rekordtempo zu (https://www.iwr.de/news/china-treibt-ausbau-der-wind-und-solarenergie-2024-auf-neues-rekordniveau-ein-neues-atomkraftwerk-in-betrieb-news38796#:~:text=Solarenergie%3A%20China%20steigert%20Solarleistung%20bis,05%20GW%20(21.050%20MW). Es übertraf seine eigenen Ausbauziele für 2030 sechs Jahre zu früh. Aber auch in den USA zeigt der Inflation Reduction Act Wirkung. Vor allem in Florida und Texas boomt der Solarausbau (https://www.iwr.de/news/usa-erwarten-2024-ueber-40-gw-neue-solarleistung-us-solarindustrie-profitiert-vom-inflation-reduction-act-news38693 ).Generell zeigt sich: Immer wieder schlägt die Realität des Solarausbaues die Prognosen. Eine eindrucksvolle Grafik aus dem renommierten Economist fand ich leider nur hier (https://www.cleantech.ing/p/solar-exponentiell-warum-so-viele-sch-tzungen-daneben-liegen ) frei einsehbar. Auch für den Zubau von Batteriespeichern scheint dies zuzutreffen.
Plus: Auch wenn sich die Erhebung auf 2023 bezieht aber erst 2024 veröffentlicht wurde, sei folgende erfreuliche Zahl nicht verschwiegen: Die Treibhausgasemissionen der EU sanken 2023 um 8,3% gegenüber dem Vorjahr (https://commission.europa.eu/news/climate-report-shows-largest-annual-drop-eu-greenhouse-gas-emissions-decades-2024-11-05_de ).
Plus: Europas größter Windkraftanlagenhersteller Vestas glänzte Ende 2024 mit starkem Auftragseingang, v.a. aus Europa und USA. Da freuen sich nicht nur die Aktionäre (https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/vestas-auftraege-ohne-ende-20346646.html ). Nach vorübergehender Stagnation durch inflationsbedingte Preissteigerungen zieht der Zubau wieder an (Trumps Äußerungen bremsen allerdings auch wieder etwas).
Plus: Während der Absatz von Elektroautos in Deutschland stagnierte, nahm er weltweit deutlich zu. Größter Markt ist China; es folgen die USA (https://de.statista.com/themen/8175/elektromobilitaet-weltweit/#editorsPicks ). Prozentualer Spitzenreiter aber ist Norwegen. Das Land schickt sich an, ab 2025 keine Verbrenner-PKW mehr zu verkaufen. 25% der bestehenden Flotte sind bereits Elektroautos (https://mobilitree.net/norwegen-auf-kurs-elektromobilitaet/ ). Der öffentliche Verkehr in Oslo ist praktisch komplett elektrifiziert – und das bei deutlich kälteren Temperaturen als im Rest der Welt. Vorübergehende Probleme betrafen mehr die Steuerung der Ladestationen als die Fahrzeuge und konnten gelöst werden.
Plus: Die Abholzungsrate in Brasiliens Regenwald ist unter Präsident Lula auf den niedrigsten Wert seit neun Jahren gefallen (nicht die Brände, s.o.) (https://www.wwf.de/2024/november/pressestatement-zum-rueckgang-abholzung-brasilianischer-amazonas ).
Plus: In Industrie und größeren Wirtschaftsbetrieben wird – auch durch diverse Berichtspflichten – die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten in Planung und Handeln immer wichtiger. So gehört in Deutschland inzwischen die Industrie zu den Hauptadvokaten einer raschen und einplanbaren Energiewende und eines massiven Ausbaues der regenerativen Energiequellen. Auch die „großen“ Beratungsfirmen betrachten Nachhaltigkeit schon länger als zentralen Bestandteil ihres Selbstverständnisses und ihrer Beratungstätigkeit (z.B. https://www.mckinsey.com/about-us/environmental-sustainability , https://www.mckinsey.com/about-us/overview/sustainable-and-inclusive-growth ). Das ganze Jahr 2024 hindurch hat McKinsey Informationsschriften mit Grundlageninformationen und Detailanalysen zur Klimaproblematik erstellt (z.B. https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/the-hard-stuff-navigating-the-physical-realities-of-the-energy-transition ).
Plus: Nach 2021 überstieg der Verkauf von Nachhaltigkeitsanleihen 2024 weltweit zum zweiten Mal den Rekordwert von 1 Trillion Dollar (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-03/global-sustainable-bond-sales-reach-1-trillion-for-second-time ).
Deutschland
Minus: Auch Deutschland erlebte das heißeste Jahr seit Beginn der Klimaaufzeichnungen. Erschreckend war, dass es gleich 0,3 Grad wärmer war als das bisher wärmste 2023. Gleichzeitig war es auch sehr feucht (warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen). Die Kombination aus Hitze und Feuchtigkeit ist eine typische Erscheinung des fortschreitenden Klimawandels, der dadurch auch häufiger zu Extremwetterereignissen führt (https://www.zdf.de/nachrichten/wissen/wetter-bilanz-deutschland-unwetter-hitze-2024-100.html ).
Minus: Am 1.1.2024 trat das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) in Kraft. Bei Beschluss Ende 2023 war es nach einer einwöchigen täglichen Desinformationskampagne der BILD (z.B. „Heizhammer ist eine Atombombe für unser Land“), die von der Opposition gerne aufgegriffen wurde, bereits in Verruf geraten (https://www.deutschlandfunk.de/heizungsgesetz-medien-heizhammer-bild-spiegel-100.html ). Die inhaltliche Diskussion verlief dann nur noch polemisch, was dem Gesetz nicht gerecht wurde. Das hätte man sich anders gewünscht. Hinzu kamen wegen der Haushaltskrise Unsicherheiten bezüglich der Förderung. Entsprechend groß war 2024 die Verunsicherung bei den Bürgern. Der Verkauf von Wärmepumpen brach ein (https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energie-warum-der-absatz-von-waermepumpen-um-die-haelfte-einbricht/100036598.html ). Viele bauten sich lieber (vor)schnell noch eine Gasheizung ein – was voraussichtlich ungünstige Folgen für die Betroffenen haben wird (siehe Blog 29).
Minus: Nachdem die Ampelregierung Ende 2023, aufgrund der Haushaltskrise nach der Verfassungsklage der Opposition, die E-Auto-Kaufprämie von maximal 4.500 Euro abrupt aufheben musste, wurden 2024 nur noch 380.609 Elektroautos zugelassen (nach 524.000 in 2023). Großbritannien überholte daraufhin Deutschland als größter europäischer Markt mit 381.970 Elektroautos (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-06/uk-overtakes-germany-to-become-europe-s-top-electric-car-market ). Neue Wege der Förderung sind jetzt Wahlkampfthema (https://www.zfk.de/politik/deutschland/e-autos-und-ladestrom-werden-zum-wahlkampfthema). Erfreulicherweise wurden jedoch in Deutschland 2024 über 1,3 Mio. Elektrofahrzeuge hergestellt – mehr als 2023.
Minus: Auch in Deutschland kippte die Berichterstattung mehr ins Klimakritische. Die FAZ titelt zum Jahreswechsel: „Die Einheizer der Transformation treiben uns in den Ruin“ (https://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/bundestagswahl-die-einheizer-der-transformation-treiben-uns-in-den-ruin-110214568.html?premium=0x6defa40c8a63cdfe491f4ae827126340815a26d76fb91e229e0624ea07ba2533 ). Auch in der Politik werden Stimmen hörbar, die die Transformationsgesetze zurückdrehen oder abschwächen wollen (z.B. https://www.focus.de/earth/report/gruenes-oel-spahn-sorgt-mit-rede-vor-waermepumpen-branche-fuer-fassungslosigkeit_id_260519648.html , https://www.zfk.de/politik/deutschland/jens-spahn-energie-kurs-cdu-kanzler-merz ). Mehrheitlich aber scheinen Bevölkerung, Medien und Politik noch hinter den Zielen der Transformation zu stehen – allerdings mit abnehmender Intensität (https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/umweltbewusstsein-in-deutschland#:~:text=Der%20Schutz%20von%20Umwelt%20und%20%E2%81%A0Klima%E2%81%A0%20ist%20für,allerdings%20ein%20leichter%20Rückgang%20ab).
Gemischt: Die Emissionen von CO2-Äquivalenten in Deutschland sanken 2024 um weitere 3% und sind damit gegenüber 1990 fast halbiert. Sie sind damit das dritte Jahr in Folge gesunken. Das Klimaziel der EU hat Deutschland damit allerdings trotzdem gerissen, zentraler Grund: Der „Mangel an strukturellem Klimaschutz in den Sektoren Industrie, Gebäude und Verkehr“, laut Simon Müller, Agora Energiewende. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-nachhaltigkeit/agora-energiewende-deutsche-co-emissionen-gegenueber-1990-fast-halbiert-110215398.html
Gemischt: Die DENA berichtet in ihrem “Gebäudereport 2024” (https://www.dena.de/infocenter/dena-gebaeudereport-2024/ ), dass 2024 in Deutschland noch 79% der knapp 20 Millionen Wohngebäude noch mit Öl und Gas geheizt wurden. Der Verkauf von Biomasse-Anlagen sei im ersten Halbjahr 2024 um 74% zurückgegangen, Wärmepumpen um 54%. Positiver aber seien die Entwicklungen im Neubau: Hier überwögen klimafreundliche Technologien. Auch der Gesantwärmebedarf in Wohngebäuden sei seit 2021 leicht zurückgegangen. Das Interesse an Beratungen sei zudem hoch. Die Anträge auf Energieberatungen für Wohngebäude stieg im ersten Halbjahr 2024 um 9% gegenüber dem Vorjahr.
Plus: 2024 ist der Anteil der regenerativen Energien an der Stromerzeugung weiter gestiegen. In den ersten drei Quartalen deckten Windkraft, Sonnenenergie, Biomasse und Wasserkraft 56 Prozent des Stromverbrauches. 2023 waren es noch 52 Prozent. Dabei deckten sie in jedem einzelnen Monat zwischen 53 und 59 Prozent, d.h. mehr als die Hälfte des Verbrauches. Kohle und Erdgas gingen um 10,5 Prozent zurück (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/iea-prognose-erneuerbare-energien-100.html ).
Plus: Insbesondere die Sonnenergie stellte auch in Deutschland neue Rekorde auf. Wie schon im Vorjahr gingen über eine Million neue Anlagen ans Netz. Mit einer Leistung von knapp 17 GW sogar noch etwas mehr als 2023. Die Gesamtzahl der Anlagen in Betrieb überstieg damit schließlich erstmals die historische Grenze von 100 GW – das ist bereits fast die Hälfte des Ausbauzieles der Bundesregierung für 2030 (215 GW) (https://www.iwr.de/news/photovoltaik-boom-in-deutschland-haelt-2024-an-eine-million-neue-solaranlagen-und-neue-rekordleistung-news38985 ). Die Zahl der Balkonkraftwerke verdoppelte sich 2024 gegenüber 2023 (Bundesverband Solarwirtschaft). Der Windenergiezubau blieb noch konstant (https://www.windbranche.de/windenergie-ausbau/bundeslaender ). Angesichts deutlich erhöhter Ausschreibungen und Genehmigungen in 2024 ist 2025/2026 mit deutlicher Zunahme zu rechnen (https://w3.windmesse.de/windenergie/pm/46216-zubau-statistik-2023-windenergie-bwe-vdma ).
Plus: Auch der Gesamtenergieverbrauch ging 2024 zurück. Das beruhte allerdings teilweise auf Sondereffekten. Beim Gesamtenergieverbrauch dominieren weiterhin Öl und Gas. Regenerative Energiequellen stellen 20% (https://ag-energiebilanzen.de/erneuerbare-decken-ein-fuenftel-des-energieverbrauchs/ ).
Plus: Die Börsenstrompreise fielen 2024 wieder auf das Vorkriegsniveau ab (https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/ ), vor allem durch geringere Beschaffungskosten (erste Wirkung der Regenerativen?). Und trotz der viel kommentierten „Dunkelflauten“ im November nahm die Zahl der „Hochpreisstunden“ 2024 eher ab (https://www.zfk.de/energie/strom/so-viele-negativpreise-wie-nie-strom-guenstiger-trotz-dunkelflauten ). Die Erdgaspreise sanken 2024 um gut 20% (https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-gaspreisanalyse/ ).
Plus: Der CO2-Emissionshandel in Deutschland erzielte 2024 Rekordeinnahmen (https://www.iwr.de/ticker/bdew-analyse-kommunale-waermeplanung-kommt-gut-voran-waermepaket-gefordert-artikel7172 ).
Plus: Die Bundesnetzagentur verdoppelte 2024 die Genehmigungen von neuen Stromleitungen gegenüber 2023 und verbessert damit die Voraussetzung für eine weitere Erhöhung des Anteiles regenerativen Stromes im deutschen Stromnetz https://www.iwr.de/ticker/verdoppelung-gegenueber-vorjahr-bundesnetzagentur-genehmigt-2024-so-viele-stromleitungen-wie-noch-nie-artikel7162#:~:text=Wie%20die%20Bundesbehörde%20mitteilt%2C%20wurden,Verfahren%20zu%20beschleunigen%2C%20sind%20erfolgreich).
Plus: Auch der Bundesverband Deutscher Energiewirtschaft (BDEW) bestätigt abnehmenden Energieverbrauch und Emissionen in 2024 und berichtet in seinem Jahresbericht 2024 (Seiten 14-16) zudem, dass die Investitionen der Stromverbraucher und Wärme-/Kältedienstleister 2024 deutlich zugenommen hätten, die der Gasversorger aber eher abgenommen hätten (https://www.bdew.de/media/documents/2024_12_18_Die_Energieversorgung_2024_Final.pdf ). Eine wichtige Trendwende!
Plus: Die Bundesregierung Deutschland verabschiedete einen Plan für den Aufbau eine Wasserstoff-Kernnetzes (https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2024/02/07-wasserstoffnetze-energiewende.html ) welches im Oktober von der Bundesnetzagentur genehmigte wurde (https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/20241022_H2Kernnetz.html ) Mit dem Aufbau wurde stellenweise bereits begonnen (https://hydrogeit.de/blog/2024/12/18/keine-zweifel-am-kernnetz/ ); die überregionale Vernetzung in Europa hapert aber noch. Auch begann MAN den Aufbau eines “Gigahub” für die Serienproduktion von Elektrolyseuren auf (https://www.man-es.com/docs/default-source/press-releases-new/man_es_pm_quest-one-gigahub_ger.pdf?sfvrsn=2e28a2ef_1 ).
Plus: Jede dritte Kommune in Deutschland beschäftigt sich bereits konkret mit der Wärmeplanung. Bei den großen Kommunen sind es fast 100 %. Vor allem in Baden-Württemberg sind viele auch schon fertig (https://www.kww-halle.de/praxis-kommunale-waermewende/status-quo-der-kwp/bearbeitungsstand-der-kwp#c925 , https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/KWW-Kommunenbefragung2024_Präsentation-gesamt_final.pdf , https://www.iwr.de/ticker/bdew-analyse-kommunale-waermeplanung-kommt-gut-voran-waermepaket-gefordert-artikel7172 ).
Plus: Der Kölner Energieversorger Rheinenergie hat den Auftrag für die größte Flusswasserwärmepumpe Europas vergeben, die 50.000 Haushalte mit Wärme versorgen soll (https://www.rheinenergie.com/de/unternehmen/newsroom/nachrichten/news_72986.html ).
Krefeld
Minus: Die Stadt hat im September einen „Qualitativen Monitoringbericht“ für die Umsetzung von „KrefeldKlima 2030“ vorgelegt (Auszug: https://ris.krefeld.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdU_ybT4yfjtEm35t3WMhplWzUTjt74j3likJ0Qf-hyK/KrK_2030_qualitativer_Statusbericht_2407.pdf ). Es bestanden noch strukturelle Mängel, die Erhebung und Auswertung schwer machten. Diese sollen aber in Zukunft behoben werden. Zudem bestehen widersprüchliche Überschneidungen mit KrefeldKlimaNeutral 2035, die wiederholt diskutiert aber noch nicht befriedigend geklärt werden konnten. Auch wurden nicht alle Maßnahmen erfasst (z.B. viele der SWK). Bei Durchsicht ist aber erschreckend, wie viele Maßnahmen ausgesetzt, aufgeschoben oder schleppend umgesetzt werden, da Personal und Finanzmittel fehlen. Positive Beispiele gibt es in der Liste durchaus (z.B.: Homepage und Newsletter, Infoveranstaltungen, Energiemanagement der ZGM, LED-Einführung, Aufbau Dienstradpool. Auch sonst arbeiten Stadtverwaltung und SWK im Stillen an vielen positiven Projekten. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Ziele von KrefeldKlima 2030 und vor allem KrefeldKlimaNeutral 2035 mit dieser Knappheit an Mitteln und Personal nicht erreicht werden können. Die schlechte Haushaltslage mag hier als Grund angeführt werden. Es ist aber auch eine Frage der Priorisierung: Ist Klimaschutz nicht existenzieller und zeitsensibler als manche anderen Projekte?
Minus: Die Wärmeplanung ist für Kommunen einer der Haupthebel der Energiewende. Stadt, SWK, NGN und weitere Akteure sind sich dieser Verantwortung bewusst und haben den Prozess sehr motiviert, dynamisch und kooperativ angeschoben (siehe unten bei „positiv“). Schon 2025 soll es Ergebnisse geben! Um so trauriger, dass sowohl die CDU als auch die FDP – anscheinend aufgrund einer Intervention von „Haus und Grund“, wie in der Presse zu lesen war – öffentlich für eine Verzögerung der Planungen eintraten (RP 20.9.2024 und 26.9.2024). Das wird vor allem die vielen Hausbesitzer ärgern, die endlich wissen wollen, ob z.B. bei Ihnen Fernwärmeanschlüsse zu erwarten sind.
Gemischt: Freiflächenphotovoltaik in Krefeld machte Fortschritte, erfuhr aber auch Hindernisse: Es wurde im Juni eine „Flächenpotenzialanalyse geeigneter Flächen“ im Klimaausschuss vorgestellt (https://ris.krefeld.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQ-969S5MLWeYt_IavRZyuP5BhQo_PwufOUWgj65tMSE/Verwaltungsvorlage_6358-24_-.pdf ). Unabhängig davon wurde in 2024 auch der erste Antrag für eine konkrete Freiflächenanlage gestellt (Solarpark Voosenhof: https://ris.krefeld.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfJPxJQ_K07z8TMQCysRZM4 ). Dieser allerdings stieß auf diverse Widerstände, so dass das Befreiungsverfahren bis zum Jahresende nicht abgeschlossen werden konnte, was wiederum das Projekt möglicherweise ganz in Frage stellt (siehe Blog 58).
Gemischt: Seit 2021 hat sich die installierte Solarenergiefläche pro Einwohner in Krefeld bis 2024 mehr als verdoppelt. Krefeld rangiert damit im Städteranking laut „Wattbewerb“ weiter im Mittelfeld beim Solarzubau (https://plattform.wattbewerb.de/ranking ).
Gemischt: Sowohl das Initiativprojekt „Salvea – Lust auf grüne Energie“ (seit 2011 keine Google-Treffer mehr, aber gerade in 2024 sehr aktiv), als auch der Geologische Dienst bemühen sich aktiv um ein Vorantreiben der Geothermienutzung in Krefeld. Auch Stadt und SWK betonen deren Wichtigkeit. Leider konnte auch in 2024 noch keine Einigung aller Beteiligten auf eine konkrete Erschließungsstrategie erfolgen. Der Geologische Dienst begann allerdings mit den Vorbereitungen zu einer Probebohrung (WZ und RP vom 28.6.2024).
Gemischt: Man sieht zwar in Krefelds Straße häufiger zu verkaufende Häuser und es folgen häufig Neubauprojekte, die (hoffentlich) energetisch günstig gebaut werden. Von einer „Sanierungsoffensive“ ist Krefeld aber sowohl im Einfamilien- als auch im Mehrfamilienhausbereich weit entfernt. Die häufigere Erwähnung der Notwendigkeit von Sanierung in den Medien scheint sich noch nicht stärker in reale Projekte umzusetzen. Die einmal angestrebte 4%ige Sanierungsrate liegt in weiter Ferne.
Plus: Eine Arbeitsgruppe aus Stadtverwaltung, SWK, NGN und dem Planungsbüro Drees&Sommer (Projektlenkungsgruppe) sowie ZGM, KBK, Wohnstätte und relevanten Fachbereichen arbeitet seit Anfang 2024 konzentriert und zielorientiert an der Krefelder Wärmeplanung. Über die Fortschritte wurde im Klimaausschuss regelmäßig berichtet (z.B. https://ris.krefeld.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZVu52R7gTWsrsimLu9LF4uzfw5zztvIja922RqzQpRhy/Verwaltungsvorlage_6362-24_-.pdf ). Auch wurden erste Ergebnisse vorgestellt (Zusammenfassung in Blog 54).
Plus: Im Oktober wurden im Klimaausschuss die Fortschritte der Flächenpotentialanalyse für Windkraftnutzung vorgestellt (https://ris.krefeld.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYkGQMUzBJsvAuMoiILtapf4jldRp8Pplw0Ismd8sdXN/Verwaltungsvorlage_6791-24_-.pdf ). 19 Flächen sollen weiterverfolgt werden. Eine Umsetzung möglichst vieler Anlagen wäre sehr wichtig (siehe Blog 41). Erfreulicherweise (und für Krefeld ungewöhnlich) waren sich darin im Umweltausschuss auch praktisch alle Parteien einig!!!. Allerdings ist von Seiten konkreter Planer zu hören, dass von den 19 Flächen in der Praxis kaum eine umsetzbar sein dürfte. Die weiteren Entwicklungen bleiben abzuwarten.
Plus: Auch in 2024 wurden durch Ratsbeschluss Fördermittel für Klimaprojekte bereitgestellt (https://ris.krefeld.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWO5M5beMeQZuM7AYpz4jbJx2DT6OL180Rs-SXROJu--/Verwaltungsvorlage_6410-24_-.pdf ). Allerdings waren die entsprechenden Fördertöpfe erneut bereits nach wenigen Tagen ausgeschöpft. Eine soziale Förderung für einkommensschwächere Haushalte für Balkonkraftwerke und einen für Teilnehmer kostenlosen Stromspar-Check durch die Caritas steht aber weiter zur Verfügung.
Plus: Im August wurde ein Elektromobilitätskonzept im Planungsausschuss beschlossen und die Stadtverwaltung mit dessen Umsetzung beauftragt (die allerdings ebenfalls an Personalmangel kranken wird) (https://ris.krefeld.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWWTl1Md1lZAnrMcT4t7aEmwW-uRrLUydBokvUT3rw-5/Abschlussbericht_EMK_Krefeld.pdf ).
Plus: Die WZ titelt am 8. Juli zur Wohnstätte Krefeld: „Ein Vorbild für alle“ (https://www.wz.de/nrw/krefeld/krefeld-wohnstaette-ist-vorbild-beim-klimaschutz_aid-72613175 ). 854 Millionen Euro wolle diese in die Hand nehmen, um bis 2045 ihre knapp 9000 Wohnungen klimaneutral zu bekommen. Zoo und ZGM wurden bereits in Blogs 15 und 24 erwähnt und arbeiteten 2024, wie auch weitere städtische Institutionen, weiter an ihrer Klimaneutralität (zahlreiche PV-Anlagen wurden gebaut und geplant). Dies auch im Rahmen des Quartiersmanagements (https://www.krefeld.de/de/umwelt/quartiersmanagement/ ). Die ZGM trieb auch die Planungen für breites Energiecontracting städtischer Gebäude weiter voran (WZ 1.7.2024).
Plus: 20 zusätzliche Klimasensoren wurden dem Messnetz zur Überwachung des Stadtklimas hinzugefügt (https://www.krefeld.de/c1257cbd001f275f/files/krefeldklimaneutral_-_newsletter_2024_07.pdf/$file/krefeldklimaneutral_-_newsletter_2024_07.pdf?openelement ).
Plus: Die SWK haben 10 Wasserstoffbusse von Solaris bestellt (und in Empfang genommen). Ferner ist der Bau einer Wasserstoff-Tankstelle auf dem SWK-Gelände geplant (WZ vom 1.7.2024). Zudem wurde das Fernwärmenetz hydraulisch optimiert, um einen beschleunigten Netzausbau vorzubereiten, und es wurden m Rahmen der Überarbeitung der Konzessionsverträge mit der Stadt Beschleunigungsmöglichkeiten für Genehmigungsverfahren im Fernwärmebereich vereinbart.
Plus: Auf dem Lefkeshof in Krefeld ging im Sommer eine Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff aus Bioabfällen (Gülle und Mist) in Betrieb (RP 1.6.2024).
Fazit:
Das Glas ist halbvoll – oder halbleer! Das ist Ansichtssache und jeder kann selbst urteilen. Unzweifelhaft aber zeigte uns die Natur 2024 wieder, wie sehr die Zeit drängt. Das Motto „Möglichst viele Emissionsreduktionen möglichst schnell!“ muss auf allen politischen Ebenen und im Privaten die tägliche Maxime sein.
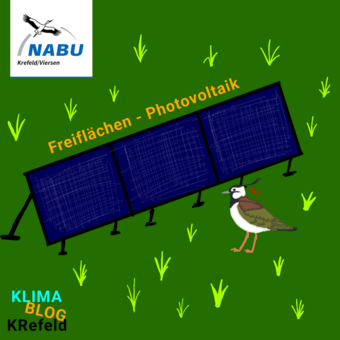
Blogs 51 und 56 haben sich mit grundsätzlichen Aspekten der Freiflächen-Photovoltaik auseinandergesetzt. Jetzt steht Krefeld vor einer Premiere: Erstmals liegt ein konkreter Antrag auf Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einer landwirtschaftlichen Fläche in Benrad vor. Das Projekt, initiiert von der „Solarpark Voosenhof GmbH&Co KG“, ist derzeit Gegenstand von Diskussionen in verschiedenen Gremien der Stadt und in der Presse. Dabei geht es um eine umfassende Abwägung von Vor- und Nachteilen des Vorhabens.
Im Gegensatz zu anderen Großprojekten, steht hinter dem geplanten Solarpark kein „großer Investor“. Stattdessen handelt es sich um eine private Initiative. Ziel der Gesellschaft ist es, den erzeugten Strom möglichst in der Region zu vermarkten und so zur lokalen und nachhaltigen Energieversorgung beizutragen. Die Initiatoren betonen, dass sie eine soziale und ökologische Integration des Vorhabens anstreben. Dabei spielen wirtschaftliche Faktoren natürlich eine Rolle, insbesondere da keine finanziellen Mittel von Großinvestoren zur Verfügung stehen. Dennoch zeigen sich die Antragsteller offen für Vorschläge und sind bereit, Biodiversitätsmaßnahmen nach Möglichkeit umzusetzen, sofern diese tragbar und realisierbar sind.
Wie wird die Anlage aussehen?
Die Anlage soll auf 200 m Breite nördlich entlang der Bahnlinie von Krefeld nach Viersen östlich der Oberbenrader Straße Nr. 189 entstehen. Sie soll 6 MWp Spitzenleistung haben und im Jahr ca. 6.000 MWh erzeugen, rechnerisch genug Strom für 1.700 durchschnittliche Haushalte. Es werden jährlich etwa 2.400 Tonnen CO2 eingespart. Die Paneele werden in neun bis zehn Reihen (die 10. Reihe hat nur die halbe Länge) von rund 7 m Breite entlang der Bahnlinie aufgeständert. Sie hat damit eine leicht nach Westen gewandte Südausrichtung. Sie wird mit Rammpfosten fundamentlos im Boden verankert und ist rückstandsfrei rückbaubar. Die Kabel werden im Boden verlegt. Die minimale freie Höhe unter den Reihen ist 80 cm, so dass auch Beweidung möglich ist. Der Abstand zwischen den Reihen beträgt rund 2,75 m, so dass die Sonne in den Sommermonaten auch zwischen den Reihen direkt auf den Boden fallen kann. Zwischen den Einzelpaneelen einer Reihe bleibt ein kleiner Abstand, so dass Wasser auch unter den Reihen auf den Boden fällt und Bewuchs stattfinden kann. Eingesät werden heimische Pflanzenarten mit hohem Anteil an Blütenpflanzen. Diese sollen extensiv gepflegt (kein Dünger, keine Chemikalien) und nach Schema gemäht oder beweidet werden. Die Gesamtanlage wird eingezäunt, wobei unter dem Zaun ein Durchtritt von Igeln, Hasen, Kaninchen und anderen Kleinsäugern möglich sein soll. Am südlichen Rand soll zu dem vorhandenen Rad- und Gehweg eine Hecke gepflanzt werden. (Da das Verfahren noch läuft und noch „artenschutzrechtliche Nachbesserungen“ diskutiert werden, können noch Detailänderungen erfolgen).
Welche Kritikpunkte sind aufgetaucht?
Nach Bekanntwerden des Vorhabens und Vorstellung im Naturschutzbeirat am 24.9.2024 tauchten in den Diskussionen (u.a. auch in Pressemeldungen in WZ 26.9. und 27.9.2024 und RP 24.9. und 26.9.2024) hauptsächlich vier thematische Kritikfelder auf, die im Folgenden der Reihe nach diskutiert werden sollen:
Einwirkung auf die Natur: Wie bereits in Blog 56 dargelegt, ist eine Photovoltaikanlage in der freien Landschaft zweifellos ein Eingriff. Es gibt jedoch zahlreiche Untersuchungen (siehe Blog 56), die einer auf extensiver (ggf. beweideter) Wiese betriebenen Photovoltaikanlage einen Biodiversitätsgewinn gegenüber einer intensiv bewirtschafteten Ackerfläche (am Voosenhof i.d.R. Kartoffelanbau) bescheinigen (siehe Blog 56). In jedem Fall wird es auf der Fläche einen größeren Insektenreichtum, dadurch Nahrung für Vögel, Amphibien und ggf. Reptilien im Umfeld, keinen Chemikalieneintrag, verminderte Erosion im Winter sowie erhöhte CO2-Bindung im Boden geben. Dem Vorhaben wird in der Vorlage zum Naturschutzbeirat entsprechend ein Plus von 173.330 Ökopunkten bescheinigt.
Eine kritische Stellungnahme zum „artenschutzrechtlichen Fachbeitrag“ führt allerdings an, dass durch „die Anlage des Solarparks.....ein potenzielles größeres Brutgebiet für den stark vom Rückgang betroffenen Kiebitz zerschnitten bzw. entwertet“ würde. Der Kiebitz brütet aktuell in Krefeld vorwiegend im Bereich der Kempener Platte. Durch bewundernswerten persönlichen Einsatz einiger OrnithologInnen konnte die Population dort in den letzten 10 Jahren verzehnfacht (!) werden. Die Stellungnahme führt aus, es habe 2021 und 2022 auch einzelne Bruten unmittelbar nördlich der geplanten PV-Anlage gegeben, dann aber nicht mehr. Durch die PV-Anlage würde, laut Stellungnahme, das südlich gelegene Gebiet als „potenzielles“ Brutgebiet ausfallen. Nördlich der A44 im Bereich Anrather Straße hätten vor Jahren noch 15 Paare gebrütet. Da Kiebitze ihre Brutplätze von Jahr zu Jahr (je nach Bodenbearbeitung etc.) variierten, wäre es wichtig, freie Flächen im südlichen Bereich der wachsenden Population im Norden als Ausweichfläche zu erhalten. Da Kiebitze „Vertikalstrukturen“ als Bedrohung empfänden (darunter könnten Fressfeinde lauern), meiden sie diese (in Nestnähe und beim Überflug).
Hinzuzufügen ist: Jahrelang hatte die Stadtverwaltung versucht, durch finanzielle Vergütung landwirtschaftlicher Fördermaßnahmen, eine Wiederansiedelung des Kiebitzes im Süden zu erreichen. Dies gelang damals leider nicht, die Programme wurden eingestellt.
Es geht also bei den Artenschutzbedenken nicht in erster Linie um Bruten auf der Fläche des Solarparks selbst, die so nah an der Bahnlinie ohnehin sehr unwahrscheinlich wären, sondern um die Auswirkung der Anlage auf die gesamten südlich gelegenen Agrarflächen als potenzielles Brutgebiet. Dem kann man entgegenhalten, dass der Kiebitz, um sich vom Norden nach dort auszubreiten, auch die Enge zwischen St. Tönis und Krefeld überwinden muss. Dort befinden sich die doppelspurige St.-Töniser-Straße, mehrere Gebäude, ein Großparkplatz auf ganzer Breite und langgestreckte Rundbogenzelte der Landwirtschaft (bei Google Maps zu sehen), die den Überflug vergleichbar „behindern“, wie die PV-Anlage. Dennoch hat der Kiebitz diese „Hindernisse“ 2021 und 2022 offenbar überwunden – dann aber nicht mehr. Sicherlich wäre die Anlage ein weiteres Hindernis – auch noch mitten in der Fläche. Falls der Kiebitz wirklich dort nach Quartieren suchen sollte, wäre dies eindeutig eine Verschlechterung. Es wäre für ihn von der Kempener Platte aber wesentlich leichter nach Nordwesten auszuweichen, wo er noch ungleich mehr freie Feldflur ohne Überflughindernisse fände. (Leider hätte er dort, aufgrund der großen Fläche, aber nicht so viele engagierte OrnithologInnen, die ihn vor den Gefahren der landwirtschaftlichen Nutzung schützen würden).
Landnutzungskonkurrenz: In Blog 51 habe ich mich schon mit dem Argument auseinandergesetzt, dass durch PV-Anlagen wertvolle Ackerflächen für die Nahrungsproduktion ausfielen. Ich habe dort bereits erklärt, dass ich die 1,7% der bundesweit für Flächen-PV notwendigen Agrarflächen lieber in Konkurrenz mit der derzeit von Energiepflanzen (Raps etc.) blockierten Fläche sehen würde, die 14% der Agrarfläche ausmacht. In punkto Energieertrag pro Hektar ist die Photovoltaik nämlich gegenüber den Energiepflanzen klar im Vorteil (2,4fach - siehe Blog 51). Darüber hinaus ist die Anlage ja jederzeit kurzfristig entfernbar, womit der Boden wieder der Nahrungsmittelproduktion zugeführt werden könnte, sollte eine Notlage eintreten. Der „gute Boden“ sollte durch die Zwischennutzung nicht schlechter geworden sein. Er unterlag dann sozusagen einer modernen Form der Fruchtfolge.
„Run“ auf jede freie Fläche: Langjährige Erfahrungen mit Investoren haben die Sorge vor finanzstarken Zugriffen auf die freie Landschaft wachsen lassen. Die tägliche bundesweite Versiegelung von Flächen in der Größe von 72 Fußballfeldern spricht für sich. Nun handelt es sich bei PV-Anlagen ja nicht um eine Vollversiegelung. Zudem ist die Photovoltaik ja „nur“ auf einem Streifen von 200 m entlang von mehrspurigen Straßen und Gleisen privilegiert und damit dort ohne Bauleitplanung „ausbreitungsfähig“. Auf dem Rest der Flächen gilt weiterhin die politisch gesteuerte Bauleitplanung. Schließlich sollen PV-Anlagen nur auf Grenzertragsböden errichtet werden. Innerhalb der privilegierten Flächen entlang der Verkehrslinien können aber auch gute Böden betroffen sein – wie hier am Voosenhof.
Für die Ausbreitung der Photovoltaik entlang der Verkehrswege speziell in Krefeld stellen sich aber ganz andere Hindernisse: Derzeit werden von der Stadtverwaltung potenziell geeignete Flächen für Freiflächenanlagen identifiziert. Im Juni war im Umweltausschuss von 52 Potenzialflächen die Rede. Ob es einen „Run“ auf diese Flächen geben wird, ist aber fraglich. Dagegen spricht:
- Es handelt sich, wegen der kleinräumigen Verhältnisse im Krefelder Außenbereich, nur um „kleine“ Flächen(am Voosenhof 4,4 ha). Für größere Investoren sind eigentlich erst Flächen über 10 ha interessant. Entsprechend sind die Antragsteller des Solarparks Voosenhof ja auch eine Privatinitiative, wo günstige Momente zusammenkommen.
- Die Krefelder Flächen befinden sich oft im Besitz mehrerer Eigentümer, so dass die Hürden für eine geschlossene Entwicklung höher sind.
- Es muss ein Netzanschluss möglich sein. Dies ist in den nächsten Jahren lediglich auf einzelnen der 52 identifizierten Flächen möglich. Erst der Ausbau des Krefelder Stromnetzes wird mehr Möglichkeiten schaffen. Dieser dürfte sich aber bis in die 30er Jahren ziehen, wo sich die Rahmenbedingungen für PV in der Fläche komplett geändert haben können.
- Denn es zeigt sich schon heute, dass PV-Investitionen immer unwirtschaftlicher werden, je mehr zugebaut wird („Selbstkannibalisierung“), v.a. da durch den hohen Angebotsüberschuss bei Sonnenschein die Abschaltzeiten steigen und damit die Wirtschaftlichkeit sinkt. Dies gilt natürlich um so mehr auf kleinen Flächen. Zudem soll in Kürze das Einspeisungsgesetz überarbeitet werden, so dass ausreichender Ertrag unsicherer wird.
Es ist eine Tatsache, dass in Krefeld Anfragen für weitere Anlagen im Raum stehen (deutlich mehr im Umland). Eine kurzfristige Realisierung vieler Anlagen erwarte ich allerdings eher nicht.
Verdrängung von Landwirten: Sorgen wegen des PV-Zubaus in Krefeld wurde in den letzten Monaten sehr stark auch von Landwirten geäußert. Das ist sehr verständlich! In Krefeld wirtschaftet ein hoher Prozentsatz der Landwirte als Pächter, also nicht auf eigenen Böden. Deren Betriebe können mit den von Solaranlagenbetreibern gezahlten Pachten nicht mithalten. Und vier Hektar Verlust sind bei einem Betrieb von 50 ha schon ein großer Prozentsatz, der im schlimmsten Fall über die Existenz entscheiden kann. Da hilft nur wenig, dass es schon immer Konkurrenz um landwirtschaftliche Flächen gegeben hat, aber auch jedes Jahr Landwirte ihren Betrieb aufgaben, so dass durch Umverteilung der Flächen oft Härten vermieden werden konnten. Ob ein langsamerer Ausbau der Photovoltaik das auch jetzt ermöglichen könnte, ist unklar. Ein sehr rascher Ausbau von Flächen-PV in Krefeld allerdings wäre tatsächlich ein großes Problem. Wie geschildert halte ich diesen allerdings für unwahrscheinlich (und bundesweit geht es, wie gesagt, um 1,7% der Agrarfläche). Die Anlage Voosenhof selbst wird sogar nur 0,1% der insgesamt 3886 ha landwirtschaftlicher Fläche in Krefeld beanspruchen. Für den jeweils Betroffenen aber kein Trost.
Abwägung der Argumente
Vorausgeschickt sei: In jedem Fall sollte die Nutzung versiegelter Flächen für PV-Anlagen maximiert werden. Wie aber kürzlich wieder einem Artikel in der WZ (30.10.2024: „Stadt findet kaum Dächer, die für eine Photovoltaikanlage geeignet sind“) entnommen werden kann, stößt der Ausbau auf versiegelten Flächen geschwindigkeitsmäßig an Grenzen. Deshalb halte ich - wie auch die Bundesregierung - den parallelen Ausbau der Flächen-PV zur Beschleunigung der CO2-Minderung für dringend erforderlich (es werden ja „nur“ knapp 2% der Agrarfläche benötigt). Wie in mehreren Blogs geschildert, läuft dem Klimaschutz die Zeit davon und frühe CO2-Minderung ist lebensrettend. Wir verfehlen sonst die Klimaziele noch weiter, was auch der Biodiversität erheblich schaden wird.
Sollten wir in 20 Jahren ausreichend PV-Anlagen auf Versiegelungsflächen errichtet haben, können wir die Agrarflächen ja wieder freigeben, wobei ich für möglich halte, dass es dann Stimmen geben wird, die die entstandenen Biotope erhalten und nicht wieder in intensive Landwirtschaftsflächen überführen wollen. Aber im Fall von existenzieller Nahrungsmittelknappheit wäre dies jederzeit möglich (vordringlich sollten dann allerdings die Bioenergiepflanzen ersetzt werden, da die PV-Flächen eine bessere Energiebilanz haben). Dass speziell die landwirtschaftlichen Pächter zusätzlich aufgrund der oben aufgeführten wirtschaftlichen Konkurrenzgesichtspunkte kritisch eingestellt sind, ist sehr verständlich.
Es bleibt abzuwarten, ob wir in den nächsten Jahren wirklich sehr viel mehr Anträge auf Flächen-PV in Krefeld sehen werden. Es könnte bei einigen wenigen Anlagen bleiben. Um trotzdem durch lokale Ökostromerzeugung unseren Beitrag als Stadt zur CO2-Minderung zu schaffen und unsere hohen Emissionswerte zu vermindern, schätze ich die Bedeutung der Anlage am Voosenhof deshalb eher hoch ein. Sie ermöglicht uns auch Erfahrungen zu sammeln, um ggf. später mit mehr Überzeugung für oder gegen weitere Anlagen stimmen zu können.
Insofern würde ich die Anlage persönlich in der Abwägung klar befürworten. Dies tue ich aufgrund meiner persönlichen Präferenzen und meiner sehr ausgeprägten Sorge bezüglich der Klimaveränderungen, aufgrund meiner intensiven Beschäftigung damit. Dies ist mein persönliches Abwägungsergebnis. Eine Position des NABU Krefeld müsste noch ermittelt werden (bundesweit ist der NABU PV-Anlagen gegenüber positiv, wenn bestimmte Gesichtspunkte beachtet werden https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/energie/erneuerbare-energien-energiewende/solarenergie/29906.html ).
Der Betreiber der Anlage Voosenhof ist erfreulicherweise zu ökologischer Optimierung bereit. Nur speziell für den Kiebitz kann man wenig tun. Deshalb kann man auch berechtigt der Auffassung sein, dass der Kiebitz vielleicht doch den Süden von Krefeld gegenüber der Ausbreitung nach Westen bevorzugen könnte und seine mögliche Brut in diesem Bereich nicht durch ein weiteres Hindernis erschwert werden sollte. Auch kann man grundsätzlich gegen Photovoltaikanlagen in Krefelds Außenbereich sein. Diese persönliche Abwägung wird im Rahmen des Genehmigungsprozesses jedes Gremiumsmitglied für sich selbst vornehmen müssen.
Nachbemerkung 1
Sollte die Anlage genehmigt und gebaut werden, habe ich mir vorgenommen, im Gespräch mit den BetreiberInnen und den Behörden die Optimierung für die Biodiversität intensiv zu begleiten und zu befördern sowie den Erfolg im Rahmen eines Monitorings zu überwachen (und auch darüber zu berichten). Ich bin der festen Überzeugung, dass Klimaschutz und Biodiversität untrennbar verbunden sind und gemeinsam berücksichtigt werden müssen, auch wenn es im Einzelnen, wie hier, gelegentlich zu Abwägungskonflikten kommen kann.
Nachbemerkung 2: Oder scheitert das Projekt?
Es kann aber auch sein, dass die Anlage zwar genehmigt aber nicht gebaut wird: Für einen wirtschaftlichen Betrieb ist eine Vergütung nach EEG (Energie-Einspeise-Gesetz) unerlässlich. Anträge für eine Aufnahme in das Programm können Ende November 2024 und dann wieder im April 2025 gestellt werden. Dezember ist wegen der Verzögerungen der Genehmigung (u.a. durch die Patt-Situation im Naturschutzbeirat am 24.9.2024, die erneute Prüfungen und Nacharbeiten erforderlich machten) nicht mehr zu schaffen. Im Februar wird eine neue Bundesregierung gewählt. Schon die derzeitige Regierung hatte Pläne, die EEG-Förderung zu überarbeiten. Noch mehr so die Opposition. Ob also im April 2025 noch die gleiche Förderung erhältlich sein wird, die solch eine „Kleinanlage“ realisierbar erscheinen ließ, oder ob ein Moratorium eintritt oder die Förderung gravierend gekürzt wird, ist derzeit unklar. Die Chancen für eine Realisierung des Projektes „Voosenhof“ schwinden. Aus meiner Sicht: Leider!
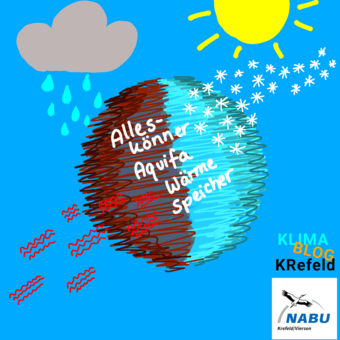
Ein Ärgernis der Wärmeversorgung ist, dass es im Sommer Wärme im Überfluss gibt, sie im Winter aber fehlt. Auch sind manche Wärmesysteme nicht wirtschaftlich, wenn sie nur einige Monate im Jahr betrieben werden. Eine Lösung für beide Probleme könnte die Aquifer-Wärmespeicherung sein, die Wärme aus dem Sommer in den Winter bringen kann. Zudem ist der Untergrund in Krefeld besonders gut geeignet dafür! Aber der Reihe nach:
Was ist Aquifer-Wärmespeicherung (ATES)?
Der Bundesverband Geothermie erklärt: Aquiferspeicherung (Aquifer Thermal Energy Storage, ATES) ist die Speicherung und Rückgewinnung von Wärmeenergie in Aquiferen, d.h. durchlässigen Schichten, die Grundwasser enthalten (https://www.geothermie.de/aktuelles/nachrichten/news-anzeigen/ates?tx_news_pi1%5BactbackPid%5D=137&cHash=45cea28bc5612327cf7aba755f33c620 ).
ATES kann angewendet werden, um Gebäude zu heizen und zu kühlen. Im Sommer gefördertes kaltes Grundwasser wird zur Kühlung verwendet, indem Wärme aus dem Gebäude über einen Wärmetauscher an das Grundwasser abgegeben wird. Dieses heizt sich auf und wird wieder in den Boden zurückgeleitet. Im Winter wird die Fließrichtung umgekehrt: Das im Sommer erwärmte Grundwasser aus dem Boden wird entnommen und zum Heizen verwendet. Dazu muss i.d.R. noch mit einer Wärmepumpe nachgeheizt werden – allerdings viel weniger als bei dem kalten Vorlauf-Wasser einer normalen Wasser-Wasser-Wärmepumpe. 80-90% der Sommerwärme kann so im Winter zurückgewonnen werden.
Voraussetzung sind zwei Bohrungen (Dublette), die „bidirektional“ genutzt werden. Diese müssen bis in poröse Sandschichten reichen – in der Regel zwischen 30 und 150 Metern Tiefe. Die Eignung des Bodens muss geologisch geklärt werden (zu Krefeld siehe unten). Eine wasserrechtliche Genehmigung ist erforderlich. Trinkwasserschutzzonen sind bis auf Zone III B ausgeschlossen, obwohl keine direkte Nutzung von Trinkwasser führenden Schichten stattfindet.
Man unterscheidet LT-ATES und HT-ATES (“Low Temperature” and “High Temperature”). LT-ATES ist die Regel bei kombinierter Bereitstellung von Kälte im Sommer und Wärme im Winter. Bei Temperaturen über 50 Grad kann es, je nach chemischer Grundwasserbeschaffenheit zu Problemen beim Betrieb kommen. So geschehen bei einer 1999 gebauten Anlage unter dem Reichstagsareal in Berlin, wo 70 Grad warmes Speicherwasser zum Pumpenverschleiß führte.
Gibt es schon Erfahrungen?
Das Grundwasser darf im Untergrund nur wenige Zentimeter pro Tag fließen, sonst fließt auch die Wärme weg. Diese Bedingungen sind besonders in den Niederlanden erfüllt. Deshalb gibt es dort schon zehntausende solcher Anlagen, vor allem für größere Bürobauten und Gebäudeanlagen. So nutzen fast alle Krankenhäuser dort Aquiferspeicherung. Bei „doppelter Nutzung“ durch Kühlung und Heizung kann sich die Anlage schon nach drei Jahren amortisieren. Insgesamt sparen die Niederlande durch Aquiferspeicherung geschätzte 11% ihres CO2-Ausstoßes.
Und wie ist es in Deutschland?
In einer Studie von Ruben Stemmle et al. von der Uni Karlsruhe (https://geothermal-energy-journal.springeropen.com/articles/10.1186/s40517-022-00234-2 ) wurden die Potentiale für Deutschland eingeschätzt. Sie sind beträchtlich. 54% der Fläche wären geeignet. Bis Ende des Jahrhunderts wird die Fläche sogar durch die allgemeine Erwärmung und damit erhöhte Notwendigkeit der Kühlung bis auf 71% zunehmen. Neben der Geologie ist auch das Verhältnis von Kälte- und Wärmebedarf ein relevanter Faktor: In einer weiteren Studie kommen Stemmle et al. bei einer Gesamtbetrachtung der Stadt Freiburg zu sehr positiven Ergebnissen: Es ließen sich viele Straßenblöcke oder ganze Quartiere ermitteln, in denen sich Kälte- und Wärmebedarf die Waage hielten – ideale Bedingungen für wirtschaftliche Aquifer-Speicherung.
Dennoch ist die Aquiferspeicherung in Deutschland noch nicht in der Breite angekommen. Vielleicht haben die Probleme des Berliner Projektes verschreckt. Nur einzelne weitere Anlagen sind schon in Betrieb, obwohl die Technik ausgereift ist. Weitere sind aber in Planung und Bau. Erfahrung wäre in den Niederlanden zuhauf abgreifbar.
Krefeld hat hervorragende Bedingungen!
Wegen seiner Nähe zu den Niederlanden überrascht es nicht, dass auch in Krefeld gute bis sehr gute Bedingungen für die Speicherung von Wärme im Boden bestehen. Ein Leser der bundesweiten Studie von Stemmle hat dessen Eignungskarte zur Besserung Orientierung mit Google Maps hinterlegt: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Dc8rP96oR6jicjfHFdktAQeym3hnvbs&ll=51.32369801182666%2C10.455786999999997&z=6 . Bei Heranzoomen kann man sehen, dass der Untergrund in Krefeld für ATES überall „gut geeignet“ ist, im Norden und Osten von Krefeld sowie östlich von Fischeln sogar „sehr gut geeignet“. Der Geologische Dienst bestätigt dies im Grundsatz, ergänzt aber, dass jeweils im Detail noch die Tonschichtungen überprüft werden müssten.
Gerade im Osten von Krefeld gibt es viele Gewerbegebiete, wo sicherlich auch zunehmend Kühlungsbedarf besteht. Ein Teil davon sind sogar Fernwärmeerweiterungsgebiete. Dies bietet die Chance über das Jahr verteilte Kälte und Wärme effektiver zu nutzen und Primärenergie zu sparen. Gerade für die Gewerbegebiete könnten hier EU-Mittel (Kreislaufwirtschaft) verfügbar sein. Gleichzeitig könnte man dadurch evtl. „unzuverlässig“ anfallende (und damit bisher schwer nutzbare) Industrieabwärme mitspeichern. Wenn Krefeld durch LT-ATES für Einzelgebäude und Gebäudekomplexe ebenso viel Energie sparen kann wie die Niederlande (s.o.), hätten wir 11% mehr „grüne Wärme“ für den Fernwärmeausbau!
Die TU-Delft hat noch eine Idee
Auf der 19. NRW-Geothermiekonferenz am 9. Oktober 2024 in Bochum trug die Technische Universität Delft ein aktuelles Projekt vor: Geothermisch durch Tiefenbohrung gewonnene Wärme soll im Sommer in Aquiferen gespeichert werden. Damit wird im Sommer keine ungenutzte Wärme mehr gepumpt und im Winter wird wesentlich weniger Zuheizung durch Spitzenlastkessel benötigt, da man die im Sommer eingespeicherte Wärme zusätzlich nutzen kann. Wirtschaftlichkeitsberechnungen hätten ergeben, dass dieses System die Unigebäude wirtschaftlich heizen könnte und doppelt so viel CO2 einsparen würde, wie eine reine Geothermiequelle (https://www.dggv.de/e-publikationen/high-temperature-aquifer-thermal-energy-storage-ht-ates-in-combination-with-geothermal-heat-production-on-the-tu-delft-campus-feasibility-study-and-next-steps/ ). Unsicherheit besteht lediglich noch wegen des weniger erprobten „High-Temperature“-Systems (HT-ATES). Hier erfolgen noch weitere Voruntersuchungen des Wassers, um „Berliner“ Zustände zu vermeiden.
Chance für eine Fernwärmeversorgung von Hüls-Zentrum?
Unter Hüls liegen zwei durchlässige Schichten (Kohlekalk und Massekalk), die zur Tiefenwärmegewinnunggeeignet sein könnten (zur Tiefengeothermie siehe Blog 9). Weitere Informationen werden Probebohrungen des Geologischen Dienstes in Krefeld (geplant für den Winter 24/25 am Stadthaus) und der Stadtwerke Düsseldorf (vermutlich 2025 am Flughafen) ergeben. Möglicherweise sind dann noch weitere Erkundungen (Seismik und ggf. Probebohrung) erforderlich. In jedem Fall aber liegen die Schichten nicht tief genug (nur ca. 1600 m) für ausreichend warmes Wasser für direkte Fernwärmenutzung (vielleicht nur 50 Grad). Mit Großwärmepumpen aber könnte es auf ausreichende Temperatur gebracht werden. Mit Aquiferspeicherung wäre ein Betrieb rund um das Jahr möglich, was die Wirtschaftlichkeit der teuren Tiefenbohrung und der Wärmepumpen deutlich erhöhen würde. Ob ein rundum wirtschaftlicher Betrieb real möglich wäre, müsste von Fachleuten durchgerechnet werden. Es gibt noch keine Vorbildanlage. Krefeld wäre Pionier!

In Blog 51, „Freiflächenphotovoltaik – Fluch oder Rettung“, hatte ich das allgemeine Für und Wider von Solar-Freiflächenanlagen diskutiert. Anlässlich des ersten Antrags für die Errichtung einer Freiflächenanlage in Krefeld („Solarpark Voosenhof“; siehe RP vom 24.9.2024 und WZ vom 26.9.2024), soll nun konkreter auf die Möglichkeiten der Optimierung des Zusammenspiels von Klimaschutz und Biodiversität eingegangen werden:
Sind Freiflächen-Solaranlagen schädlich für die Natur?
Obwohl sie durch die Verminderung von CO2-Emissionen und damit die Abschwächung des Klimawandels, eine positive Wirkung auf die Natur im Allgemeinen haben, sind Freiflächenanlagen vor Ort zweifelsohne ein erheblicher Eingriff in die Natur. Viele Hektar Landschaft werden mit Solarmodulen bestückt. Optisch eindrucksvoll und für manche sicher störend. Das Landschaftsbild wird deutlich verändert – so wie Strommasten in den 50er Jahren auch schon das Landschaftsbild veränderten, damals aber als Fortschritt galten - dazu aber sei auf Blog 51 verwiesen.
Was ist nun speziell mit der Biodiversität?
Die Antwort ist: „Kommt drauf an wo und wie!“ Auf Flächen, die eine spezielle Naturschutzbedeutung haben (z.B. auf dem Egelsberg, der Herbstzeitlosen-Wiese oder der Wiesenknopf-Populationen im Latumer Bruch etc.) wäre die Wirkung in der Summe wohl eher als schädlich zu bezeichnen, da sehr seltene Arten verdrängt würden. Auch Wälder sollten für Solaranlagen nicht abgeholzt werden und intakte Moore nicht beschattet werden. Auf einer ausgeräumten Ackerfläche jedoch, die unter den Modulen als extensive Wiese entwickelt wird, fallen nicht nur Dünger und Pestizide weg. Es wird sich eine Vielzahl von Insekten ansiedeln, die vorher in diesem Raum selten oder gar nicht vorkamen. Diese dienen wiederum als Futter für andere Tiere. Vögel und ggf. Amphibien und sogar Reptilien kommen mit der Zeit hinzu. Kleinsäuger finden einen Schutzraum. Entsprechende Beispiele sind bundesweit zahlreich dokumentiert (z.B. Übersichtsarbeit: https://www.bne-online.de/wp-content/uploads/20191119_bne_Studie_Solarparks_Gewinne_fuer_die_Biodiversitaet_online.pdf, wird derzeit von 2023 bis 2025 im Rahmen eines größeren Forschungsprojektes aktualisiert; konkretes Anlagen-Beispiel: https://www.lbv.de/files/user_upload/Dokumente/LBV-Forschungsbericht/2020/Solarfeld%20Gänsdorf%202018%20Endbericht.pdf ). Vorteile für die Natur sind in vielen Fällen erreichbar. Kleinere Anlagen können als Trittsteinbiotope nützlich sein, große auch als eigenes Habitat für bestimmte Arten. Man muss aber schon bei der Standortwahl in jedem Fall einzeln abwägen und ggf. Kompromisse suchen.
Möglichkeiten der Optimierung für den Artenschutz
Wenn ein Ort gefunden wurde, an dem eine Freiflächen-Solaranlage sich nicht aus Naturschutzgründen verbietet, gibt weitere Möglichkeiten der Optimierung der Naturverträglichkeit. Es versteht sich von selbst, dass z.B. eine Asphaltierung der Flächen unter den Solaranlagen nachteilhaft wäre. Umgekehrt ist aber auch völlig freie Natursukzession ungünstig, da Bäume wachsen und die Anlagen verschatten würden. Eine gewisse Pflege muss festgelegt werden. Schon im Energie-Einspeisungsgesetz sind fünf Mindestkriterien für die Gestaltung und Pflege hinterlegt (von denen jeweils nur drei eingehalten werden müssen). Viele weitere Möglichkeiten wurden von fachlicher Seite formuliert. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens kann mit den Antragstellern eine Optimierung versucht werden. Hier eine kurze Auflistung von möglichen Naturschutzanforderungen, die nach Möglichkeit bei Genehmigung rechtlich abgesichert werden sollten (z.B. städtebaulicher Vertrag):
Gesamtversiegelung: Der Gesamtversiegelungsgrad inklusive aller Gebäudeteile sollte 5% nicht überschreiten (wobei die Aufständerungen i.d.R. einfach in den Boden gerammt werden und insgesamt maximal 0,5% der Flächenversiegelung ausmachen). Die Gesamtheit der von den Modulen beschirmten Bereiche soll 50% der Fläche nicht übersteigen.
Versickerung: Niederschläge sollten in der Fläche verbleiben. Ausreichender Reihenabstand und nicht zu breite Modulreihen (max. 5-6 m) ermöglichen eine Versickerung vor Ort. Bei Modulreihentiefen über 3 m sind evtl. Versickerungsrinnen und -einrichtungen notwendig. Lücken von 2 cm zwischen den einzelnen Modulen helfen, den Niederschlag gleichmäßiger zu verteilen; dadurch werden "Wüsten" unter den Modulreihen und Tropfschäden im Ablaufbereich vermindert. Ggf. hilft die Anlage eines Feuchtbiotopes. Fahrwege sollten nicht versiegelt werden.
Reihenabstand und Höhe: Der Reihenabstand sollte mindestens 3,5 m, besser 5 m und mehr betragen, damit dauerhaft besonnte Zwischenzonen entstehen (je höher die Modulhinterkante um so breiter der Abstand, dazu gibt es Formeln, z.B. Peschel und Peschel 2023). Diese sind für die Entwicklung von Artenreichtum erfahrungsgemäß besonders wichtig. Der Abstand ermöglicht auch eine problemlosere Pflege mit landwirtschaftlichen Maschinen (Arbeitsbreite 6 m), die Selbstbeschattung ist minimal und der Wasserabfluss ist besser. Die Module sind hoch genug (mindestens 80 cm) aufzuständern, damit Weidetiere darunter weiden können (das mindert auch die Beschattungsgefahr durch Aufwuchs).
Einzäunung: Alle 500 m (max. 1 km) ausreichend breite (ca. 20-50 m) Korridore für Großsäuger; sollten nicht direkt an Schienen oder Straße enden. Die Zäune sollten keine Barrierewirkung für Kleinsäuger und Amphibien entfalten; dazu Bodenabstand von 15-20 cm oder entsprechend große Maschen in Bodennähe (dort auch kein Stacheldraht). Bei Beweidung ist evtl. ein zusätzlicher Weidezaun mit entsprechenden Kriterien notwendig.
Module: Nach Möglichkeit sind wenig reflektierende Module zu verwenden, um Insekten nicht irrtümlich anzulocken. Ggf. weiße Raster vorsehen. Sicheres Kabelmanagement, um Verbissschäden zu mindern.
Abgrenzung: Entlang der Einzäunung sollte ein standortabhängiger ca. 3 m breiter Grünstreifen mit Heckenwuchs aus einheimischen Arten als Biotop und Sichtschutz vorgesehen werden, falls nicht besondere Anforderungen geschützter Tierarten entgegenstehen (z.B. Feldlerche).
Bewuchs: Extensiver Bewuchs von Spontanvegetation oder Einsaat heimischer standortgerechter Arten. Sofern nicht Natursukzession erfolgt, sollte, Pflanzungen und Aussaat ausschließlich mit zertifiziertem Material (Wiesenblumen, Kräuter, Stauden, Sträucher, Bäume) erfolgen.
Strukturelemente: Generell sollte Raum für anreichernde Strukturelemente und ggf. Offenbereiche vorgesehen werden, je nach Größe der Anlage und zu erwartender Fauna. Zudem sollten vorbestehende wertvolle Strukturelemente möglichst erhalten werden. Möglichkeiten der Anreicherung sind Steinhaufen, Rohbodenstellen, Totholzhaufen, spezielle Blühstreifen, Bruthilfen für Vögel und Fledermäuse, ggf. auch Feuchtbiotope und Kleingewässer. Erfahrungsgemäß sind v.a. Randbereiche von Anlagen wertvoller Lebensraum von Vögeln, wo mit Sitzwarten und Brutmöglichkeiten unterstützt werden kann. In den Innenbereichen helfen, bei großen Anlagen, am ehesten offene Inseln.
Bau: Minderung der Eingriffsintensität durch Abstände von Lagerplätzen zu Gewässern und sensiblen Bereichen, separate Lagerung von Aushub, Minimierung von Versiegelung. Ausweis von Befahrungstrassen. Leitungen möglichst verrohrt als Erdleitungen.
Betrieb: Das Pflegekonzept sollte fachlich auf den Bedarf abgestimmt sein (ggf. gezielt auf bestimmte Arten wie z.B. Bodenbrüter), wobei die initiale Aufbaupflege nach ca. drei Jahren in Dauerpflege übergeht. Keine Anwendung von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngern. Bei der Reinigung der Module muss auf Chemikalien verzichtet werden. Mahd (Balkenmäher min. 10 cm) ist notwendig, um Verschattung zu vermeiden, sollte aber maximal zweimal im Jahr erfolgen, möglichst zeitlich gestaffelt, die erste Mahd frühestens im Juni. Das Mahdgut muss abgeräumt werden. Keine Mähroboter! Beweidung z.B. durch Tiere (z.B. Schafe) wäre optimal. Die Entwicklung sollte mit einem geeigneten standortangepasstenLangzeitmonitoring überprüft werden. Die Kriterien dafür sollten detailliert festgelegt werden.
Rückbau: Es wird mit Betriebsdauern von 20 bis über 30 Jahren gerechnet. Der Rückbau sollte aber problemlos möglich sein und die Modalitäten schon in der Genehmigung festgelegt werden – mit Berücksichtigung der im Projekt geschaffenen Ausgleichsmaßnahmen.
Vision für Krefeld
Wie oben erwähnt, befindet sich in Krefeld derzeit die erste Freiflächen-Photovoltaikanlage im Genehmigungsverfahren. Dieses ist noch nicht abgeschlossen, deshalb ist noch nicht abzusehen, wie viele der oben aufgelisteten Chancen für den Naturschutz genutzt werden werden. Ein Gewinn für den Klimaschutz wird in jedem Fall erreicht. Dennoch wäre es wichtig, in Krefeld einen Standard für zukünftige Genehmigungen zu schaffen. Es wird nicht unendlich viele Anträge geben. Bundesweit wird geschätzt, dass letztlich für den Ausbau bis 2045 ein Prozent der landwirtschaftlichen Fläche benötigt wird. Heruntergerechnet dürfte es damit in Krefeld bis dahin etwa 10 bis 20 Freiflächenanlagen geben (unseren viel höheren solaren Strombedarf werden wir in Krefeld schwerpunktmäßig über Gebäudeanlagen, Parkplätze etc. decken müssen!!!) – viele entlang von Autobahnen oder Schienen (wie Voosenhof), wo es weniger Konflikte gibt. Angesichts unserer begrenzten Freiflächenressourcen für die Natur aber sollten die Freiflächenanlagen optimiert für den Biodiversitätsschutz geplant werden. Dann können die Interessen von Naturschutz und Klimaschutz weitgehend versöhnt werden und es wird auch Akzeptanz geben. Gerade Krefeld, von wo aus der Entomologische Verein mit seiner berühmten „Krefeld Studie“ weltweit Aufsehen erregte, die den furchtbaren Insektenverlust über die letzten 25 Jahre dokumentierte, ist verpflichtet, etwas für die Insektenwelt zu tun. Und gerade Insekten können in Freiflächen-Solaranlagen von allen Tierarten meist am besten gefördert werden.
Literaturliste:
TH-Bingen: Leitfaden für naturverträgliche und biodiversitätsfreundliche Solarparks (sehr ausführlich!): https://www.th-bingen.de/fileadmin/projekte/Solarparks_Biodiversitaet/Leitfaden_Massnahmensteckbriefe.pdf
NABU/BSW: Kriterien für naturverträgliche Freiflächen-Solaranlagen: https://www.solarwirtschaft.de/wp-content/uploads/2021/04/210428_NABU-BSW-Papier-1.pdf
NABU-Info Photovoltaik: https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/solarenergie/210421-nabu-infopapier-photovoltaik.pdf
Allgemein: Photovoltaik und Biodiversität – Integration statt Segregation, Peschel und Peschel 2023 : https://wattmanufactur.de/download/presse/NuL_PVundBioDiv%20-Integration-statt-Segregation_Februar2023.pdf

Immer wieder werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse angezweifelt. Diese seien zu unsicher und es werde nicht so schlimm kommen. Das Gegenteil ist richtig: Es kommt in der Regel schlimmer, schneller und es kommen noch unerkannte Probleme hinzu. Ich habe mir eigens noch einmal die erste Zusammenfassung des Enqueteberichtes des Bundestages zum „Schutze der Erdatmosphäre“ von 1988 angesehen (der mich damals zum Aktivwerden motivierte): Keine Vorhersage war übertrieben, alle vorhergesagten Folgen treten inzwischen deutlich erkennbar ein. Erschreckenderweise sind aber noch viele hinzugekommen, die damals noch gar nicht bedacht wurden. Einige ganz frische Beispiele von präzisierten oder neuen Erkenntnissen will ich hier, erneut zum Handeln motivierend, zusammenfassen:
Wenn AMOC abbricht wird es kalt bei uns im Norden
Die Atlantische Umwälzströmung (Atlantic Meridional Overturning Circulation – AMOC) transportiert warmes Wasser aus den Tropen an der Meeresoberfläche nach Norden, wo es abkühlt, dadurch schwerer wird und als kaltes Wasser am Meeresboden nach Süden zurückfließt (optische Darstellung siehe: https://www.youtube.com/watch?v=U9cal-dFjx0 ). Deshalb haben wir hier mildes Wetter. Nun gelangt durch die Eisschmelze (v.a. in Grönland) mehr Süßwasser in den Nordatlantik, welches leichter als Salzwasser ist und das Absinken des abgekühlten Oberflächenwassers bei Grönland bremst. Die Folge: AMOC nimmt seit 150 Jahren ab und ist derzeit so schwach wie seit tausenden von Jahren nicht mehr. Da AMOC auch natürlicherweise in der Stärke schwankt, war die Wissenschaft bisher vorsichtig, Prognosen zum weiteren Verlauf abzugeben. Leistungsfähigere Computer und neue Simulationsmodelle ermöglichen nun konkretere Aussagen. Eine Studie von Anfang 2024 (van Westen et al. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adk1189 ) stellt fest, AMOC ist auf dem Weg zu versiegen – und dies noch vor dem Ende dieses Jahrhunderts. Der deutsche Klimaforscher Stefan Rahmstorf, der seit Jahrzehnten zu AMOC bestätigt dies im September 2024 nochmals mit warnenden Worten (https://tos.org/oceanography/assets/docs/37-rahmstorf.pdf ); ebenso ein aufrüttelnder Report zahlreicher Wissenschaftler um den ehemaligen Chef der NASA, James E. Hansen von Anfang 2025, der eine krasse Unterschätzung der Temperaturanstiegsdynamik durch Unterschätzung des bremsenden Einflusses von Aerosolen befürchtet (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00139157.2025.2434494 ).
Im Norden Europas fallen dann die Temperaturen etwa 3 Grad pro Dekade ab, um insgesamt bis zu 15 Grad (Durchschnittstemperatur!). Die Folge wäre ein schrittweises Vorrücken des derzeit noch rückläufigen Polareises nach Süden bis etwa Südengland und Norddeutschland (ähnlich der Eiszeit). Gleichzeitig wird die Südhalbkugel heißer und das Amazonasbecken wird zur Trockensavanne (auch jetzt schon herrscht erschreckende Dürre, https://www.bloomberg.com/news/features/2023-11-30/amazon-rainforest-suffers-historic-drought-as-rivers-lakes-evaporate ,https://www.bloomberg.com/news/features/2024-10-04/worst-drought-in-brazil-s-history-hits-gdp-global-food-prices - zum Pantanal siehe nächster Absatz). Zwischen nördlichem Eis und Hitze im Mittelmeerraum wird sich eine höchst ungemütliche Zone mit Starkwinden und Niederschlagsextremen erstrecken – da versuchen wir dann mit extrem teuren Anpassungsmaßnahmen zu überleben.
Unsichtbare Moorbrände haben ein erschreckendes Ausmaß
Feuchtgebiete in Brasilien, indonesische Moore und die arktische Tundra haben gemeinsam, dass in ihrem Boden riesige Kohlenstoffreserven gespeichert sind. Was gut für das Klima wäre, wenn Moore gesund wären und CO2 weiter einspeicherten, kehrt sich unter den Bedingungen des Klimawandels ins Negative: Besonders offensichtlich sind die Änderungen im Norden. 2024 war die extremste Waldbrandsaison Kanadas und Sibiriens und die extremen Temperaturanstiege im hohen Norden füllten ebenfalls die Schlagzeilen. Die Wärme taut den Permafrostboden (geschätzt ein Drittel davon bis 2050), der seit Jahrtausenden gefroren war und trocknet ihn aus. Allein schon dadurch werden riesige Mengen CO2 (sowie Lachgas und Methan) frei, weil dann Sauerstoff eindringen kann. Vor allem aber kann auch er nun Feuer fangen. Im Gegensatz zu den Waldbränden, die gut sichtbar und oft auch löschbar sind, brennen die Untergrundfeuer langsam, unsichtbar, sind kaum löschbar und emittieren massive Mengen Treibhausgase. Sie emittieren außerdem Feinstäube (black carbon), die sich auf Eisschichten legen und deren Tauen beschleunigen. Auf den verbrannten Flächen kann sich Wald schwer erholen und wird durch Grasland ersetzt, das noch leichter brennt. Ähnliche Prozesse spielen sich ab im Pantanal Brasiliens (ebenfalls Emissionsspitze in 2024, https://www.worldweatherattribution.org/hot-dry-and-windy-conditions-that-drove-devastating-pantanal-wildfires-40-more-intense-due-to-climate-change/#:~:text=So%20far%20this%20year%2C%20wildfires,and%20a%20hotspot%20of%20biodiversity. ) und in Indonesien. Zum Vergleich: Die Emissionen der Feuer allein in Kanada 2023 waren höher als die Emissionen aus Verbrennung fossiler Brennstoffe jeden Landes außer China, den USA und Indien (https://www.nature.com/articles/s41586-024-07878-z ).
Die Meerestemperatur steigt überraschend sprunghaft
Es ist eines der größten Rätsel der gegenwärtigen Klimaforschung: Seit März 2023 sind die Weltmeere so warm wie nie zuvor – und das mit großem Abstand. Die Temperatur stieg plötzlich ein halbes Grad (im Nordatlantik sogar ein ganzes Grad)! Es scheint, als würde die Erde seit 2023 unerwartet viel Sonnenenergie aufnehmen. Zudem scheint sich das warme Oberflächenwasser weniger mit tiefen Schichten zu vermengen. Dies erklärt allerdings immer noch nicht ausreichend, warum im Frühjahr 2023 zwischen März und Mai die Temperatur plötzlich massiv anstieg – und seither blieben die Temperaturen so hoch. Auch Oberflächentemperatur des Mittelmeeres stieg auf 28,75 Grad. Die Meere verdunsten seither deutlich mehr Wasser, was sich in der wärmeren Luft besser löst und bekanntermaßen seit Ende 2023 bei uns (und auch in anderen Ländern) als Regen ankommt. Es gibt eine Reihe von Hypothesen, wie der Temperaturanstieg zustande gekommen ist, aber keine reicht bisher als Erklärung aus. Forscher befürchten, dass es auch im Meer Kipp-Punkte geben könnte, die jetzt vielleicht zu irreversiblen Veränderungen geführt haben. Dadurch könnte auch die bisherige Aufnahmefähigkeit des Ozeans für CO2 beeinträchtigt werden (Spektrum der Wissenschaften 7/2024). Durch die erhöhte Meerestemperatur wird auch das Korallensterben sprunghaft ansteigen und Hurrikane werden häufiger und größer - wie aktuell erschreckend erkennbar am Schadensausmaß des Hurrikans "Helene" (über 230 Tote, 250 Milliarden Dollar Schaden) und Tage später "Milton" (16 Tote, 50 Milliarden Schaden). Die Stimmen werden lauter, dass die USA - und es gilt überall auf der Welt - auf die zunehmenden Katastropen durch Klimaveränderungen nicht vorbereitet sind (https://www.bloomberg.com/news/features/2024-10-03/helene-reveals-how-us-is-not-prepared-for-billion-dollar-disasters ).
Klimaflucht überlastet ohnehin gestresste Mega-Cities
Ein Zusammenschluss von Bürgermeistern aus aller Welt hat einen Bericht herausgebracht, der die Auswirkung von Klimaflucht auf 10 Großstädte analysiert (https://c40.my.salesforce.com/sfc/p/#36000001Enhz/a/Vo000000Ecev/s2aMWA.1OlkzPhbL_rQQvcJJi3eaSu_E2OWDPpb6xSo). Beispiel: Als 2022 Pakistan von Regen überflutet wurden, mussten innerhalb von Wochen über eine Million Menschen ihrem Lebensraum verlassen. Viele flohen nach Karachi, wo sie sich Unterkunft und Auskommen erhofften. Wenige kehrten in die zerstörten Gebiete zurück. Entsprechend rechnet der Bericht in den zehn betrachteten Großstädten (Accra, Freetown, Amman, Karachi, Dhaka, Bogota, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba) mit 8 Millionen Klimaflüchtlingen bis 2050 (mit einer Spanne von 200.000 in Curitiba und 3 Millionen in Dhaka) – zusätzlich zu den noch zahlreicheren Flüchtlingen aus anderen Gründen. Dabei ändern sich die Risiken für die Betroffenen kaum. Auch in den Städten erwarten sie Klimarisiken – allerdings urbane. Gleichzeitig verschlimmern sie dort ohnehin bestehende Ressourcenknappheiten. Der Bericht listet Hilfen auf, die die Städte leisten, appelliert aber auch dringend an die Weltgemeinschaft, Emissionen ausreichend zu mindern, Forschung zu unterstützen sowie Daten, Ressourcen und finanzielle Hilfen bereitzustellen.
Und dennoch gibt es in Krefeld Stimmen, die verzögern wollen?
Die Beispiele zeigen, dass mit fortschreitender wissenschaftlicher Erkenntnis die Dringlichkeit entschlossener Emissionsminderung eher steigt als nachlässt – insbesondere da die derzeit geplanten Politikmaßnahmen, weltweit und lokal, definitiv noch nicht ausreichen, die Klimaziele einzuhalten und die schlimmsten Auswirkungen der Klimaveränderungen abzuwenden. Unabhängig von der fragwürdigen Debatte, ob Klimaneutralität nun 2035 oder 2045 erreicht werden soll, ist das Emissionsbudget für Krefeld begrenzt(für nähere Erläuterungen zu Jahreszielen, 1,5-Grad-Ziel und Emissions-Restbudget siehe Blog 43) und praktisch aufgebraucht. Jeder Tag zählt. Wir müssen „möglichst viel möglichst rasch reduzieren“. Um damit beginnen zu können, brauchen wir einen Rahmenplan. Diesen bietet die Wärmeplanung. Ein geeigneter Entwurf liegt bald vor (siehe Blog 54). Die Zielrichtung stimmt, einige Informationen fehlen noch, Detailverbesserungen können im Verlauf erfolgen. Laut Arbeitsgruppe soll der Plan um die Jahreswende 2024/2025 politisch beschlossen werden können.
Die Betroffenen stehen in den Startlöchern
Die SWK müssen wissen, wo Fernwärme geplant werden soll, um in Energiebereitstellung, Leitungen und Regelungen investieren zu können und künftige Kosten zu kalkulieren. Vor allem brauchen sie einen Plan, um Förderanträge zu stellen. Je früher sie dies tun, um so eher bekommen sie einen Zuschlag – ein wichtiger Grund noch zur Zeit der derzeit gültigen Förderrichtlinien (d.h vor der nächsten Bundestagswahl) fertig zu werden.
Die Privatleute müssen wissen, auf welches Heizungssystem sie setzen sollen, wenn ihre Heizung kaputt geht (wichtigste Frage: Bekommen sie Fernwärme?). Je länger wir warten, um so mehr Unglückliche laufen in die Kostenfalle einer neuen Gas- oder Ölheizung (siehe Blog 29). Auch können sie jetzt die Übergangsregelungen des GEG nicht mehr vermeiden (steigender Anteil emissionsfreier Brennstoffe). Gleichartiges gilt für die Krefelder Betriebe.
Damit alle planen können, muss der Wärmeplan rasch beschlossen werden. Alles andere ist unnötige Stagnation. Wir müssen endlich ins Handeln kommen! Der Wärmeplan ist kein Vorhaben wie eine städtische Baumaßnahme, die man machen oder lassen kann, sondern eher eine Art Medizin, die vielleicht manchem ein bisschen bitter schmeckt, die man aber zur Gesundung zügig einnehmen sollte.
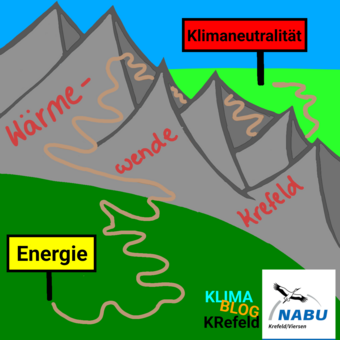
Am 4. September wurden im KLIMA-Ausschuss im Rathaus einige erste Folien zum „Erstentwurf einer Wärmewendestrategie für die Stadt Krefeld“ vorgestellt. Mitglieder der Arbeitsgruppe aus Stadt, SWK, NGN und Gutachterbüro Drees&Sommer, die diesen erarbeitet hatte, trugen die Ergebnisse vor.
Über die allgemeinen Ziele und den Aufbau einer Wärmeplanung wurde schon in mehreren Blogs berichtet (allgemein Blog 8, München Blog 38, Krefeld Blog 48). Die Arbeitsgruppe stellte fest, dass Krefeld sehr früh mit der Erarbeitung begonnen habe und auch den Ehrgeiz habe, sehr früh fertig zu sein. Laut Gesetz müsste der Wärmeplan bis 2026 vorliegen. Krefeld will diesen spätestens Anfang 2025 vorlegen. Damit wäre Krefeld eine der ersten Städte in NRW. Das ist sehr zu begrüßen! Denn erst wenn damit die angestrebten Wärmequellen gebäudescharf festgelegt sind, können Stadtwerke, Betriebe und Privatpersonen beginnen, in die Sanierung ihrer Gebäude und Anlagen zu investieren. Ziel ist, laut Bundesgesetz, die vollständige Klimaneutralität der Wärmeversorgung bis 2045. Krefeld hat sich dabei allerdings vorgenommen, schon 2035 so weit zu sein (Blog 33).
Die Ergebnisse der Bestandsanalyse wurden im Ausschuss nur kurz erwähnt. 80% der Gebäude dienen Wohnzwecken, davon 51% Einfamilienhäuser, 32% Reihenhäuser, 17% Mehrfamilienhäuser. Als bedeutsam wurde festgehalten, dass Krefeld einen recht alten Gebäudebestand hat: Die überwiegende Zahl der Gebäude wurde 1919 bis 1948 und vor allem von 1958 bis 1978 gebaut – also als Dämmmaßnahmen noch nicht hoch auf der Tagesordnung standen. Entsprechend hoch ist der Heizbedarf (n Krefeld durchschnittlich 182 kWh/m2a, bundesweit 160-170 kWh/m2a).
Wie wird derzeit geheizt?
75% der Gebäude werden mit Erdgas versorgt, ca. 7% mit Fernwärme, weniger als 1% mit Strom (Wärmepumpe, Nachtspeicher).
Fossile Brennstoffe nutzen in Krefeld 32.760 Erdgasanschlüsse (davon 17.909 Brennwertkessel), 7.821 Ölheizungen (davon 1.029 Brennwert), 561 Flüssiggasheizungen.
Wie soll es künftig aussehen?
Alle fossilen Heizquellen (d.h. über 92% der Heizungen) müssen nun nach und nach ersetzt werden. Mit Spannung wurde natürlich die Karte erwartet, die die räumliche Verteilung der zukünftigen Vorranggebiete (Fernwärme etc.) zeigt. Es wird dabei sechs verschiedene Gebiete geben:
Auf den ersten Blick enthält der anschließend gezeigte erste Kartenentwurf keine Überraschungen. Die Nachverdichtungsgebiete (in Dunkelblau) entsprechen naturgemäß dem aktuellen Fernwärmeversorgungsgebiet. Hier soll also nachverdichtet werden.
Wärmenetzausbaugebiete (hellblau) finden sich vor allem entlang und südlich der Berliner Straße, wo eine neue Hauptleitung die bisherige Hauptleitung auf Uerdinger Straße/Friedrich-Ebert-Straße ergänzen soll und damit auch einen Fernwärmeringschluss in der Innenstadt ermöglichen würde. Damit wird sowohl eine höhere Sicherheit erreicht als auch ein höheres Wärmeangebot im Westteil der Stadt (bei fortbestehender Haupt-Wärmeerzeugung im Bereich der MKVA). Ferner sollen Bereiche in Stahldorf und Lehmheide Ost; Uerdingen Nord, West und Süd; Linn sowie auch im Bereich Inrath/Kempener Feld erschlossen werden.
Es gibt ein einziges Prüfgebiet für den Wärmenetzausbau (türkis): Das DB-Werk in Oppum mit einigen angrenzenden Häuserreihen.
Dezentrale Wärmeversorgung bleibt für den Großteil der Stadt außerhalb des Fernwärmegebietes, wobei noch zwischen dezentraler Versorgung mit Gasanschluss (hellgrün) im zentraleren Ring sowie ohne Gasanschluss (dunkelgrün) in den Randbereichen unterschieden wird.
Weitere Inhalte des Entwurfes
Auf rund einem Dutzend Folien lässt sich nur ein Bruchteil des Gesamtinhaltes darstellen. Die Ersteller erwähnen aber noch die Kriterien, die für die Auslegung der Fernwärmenetze angelegt wurden: Wärmedichte, Wärmeliniendichte, Technische Herausforderungen (Bäume, Straßenverhältnisse, Hindernisse wie Bahntrassen etc.), Verfügbarkeit von Wärmequellen, Netzkapazitäten, Verfügbarkeit von (Technik-)Flächen, Abnehmerstrukturen.
Sie stellen ferner dar, dass sich im Rahmen der Transformationsplanung der SWK bisher folgende Rahmenbedingungen ergäben: Die aktuelle Erzeugerleistung könne von 190 MWth auf maximal 300 MWthausgeweitet werden. Der Wärmeabsatz steige dadurch von 300 MW/a auf 800 MW/a. Eine weitere Steigerung sei wegen begrenzter Erzeugungs- und Netzkapazitäten nicht möglich. Damit könne durchschnittlich 60% des aktuellen Wärmebedarfes der Fernwärmegebiete gedeckt werden. Es wird festgestellt: „Fernwärme in Krefeld ist ein begrenztes Gut“.
Festgehalten wurde auch, dass das Gasnetz zunächst erhalten werden soll für verschiedenste mögliche Nachnutzungen. Es sollen aber „doppelte Energieinfrastrukturen“ vermieden werden (ein Gebiet, ein Heizträger!).
Schließlich wird auf den letzten beiden inhaltlichen Folien der Vorstellung die „Herausforderung für die Wärmewende in Krefeld am Beispiel Innenstadt-West“ dargestellt. Dieser Bereich wurde ja bereits in mehreren Blogs als problematisch erkannt (Blogs 47,48,53). Charakteristika sind: Dichte Bebauungsstruktur mit teils denkmalgeschützem Mehretagen-Gebäudebestand, besonderes Erfordernis „sozialverträglicher Wärmewende“, bisher praktisch nur Erdgas. Alles spricht für Wärmenetzausbau. Dieser ist aber schwierigwegen: Enger Straßenführung, Baumbestand, begrenzte Erzeugungs- und Netzkapazitäten, blockierende Bahntrassen. Einige Versorgungsalternativen werden andiskutiert: Pelletkessel oder Luft/Wasser-Wärmepumpen werden wegen ungünstigen Rahmenbedingungen für schwierig gehalten; Versorgung mit „grünen Gasen“ sei nur vorbehaltlich der „Verfügbarkeit und wirtschaftlicher Bezugspreise“ realisierbar.
Schließlich wird noch der Belastungsausgleich des Landes NRW für Kommunen dargestellt, der Kostenunterstützung ermöglicht, dann wird das weitere Vorgehen kurz skizziert: Zunächst Vorstellung des Erstentwurfes in verschiedenen Gremien, dann Beteiligung der Öffentlichkeit. Das Feedback soll eingearbeitet werden und die „Finale Wärmewendestrategie“ spätestens Anfang 2025 vorgestellt werden.
Ist das der große Wurf?
Der Entwurf fand im Ausschuss eine überwiegend positive Aufnahme. Es wurde von fast allen Rednern gelobt, wie rasch die Beteiligten der Arbeitsgruppe eine Einigung gefunden hätten. Auch inhaltlich hielt man sich mit Grundsatzkritik weitgehend zurück. Es gab einige Detailfragen, die beantwortet wurden.
Für eine umfassende Einschätzung des Entwurfes sind die dargestellten Aspekte noch zu unvollständig. Im großen Ganzen aber wurde sicherlich ein guter Aufschlag gemacht, der eine gute Grundlage für ein positives Endergebnis ist.
Welche wichtigen Inhalte stehen noch aus?
Es wurden, wie gesagt, nur rund 12 Folien gezeigt. Der komplette Entwurf dürfte an die hundert Seiten umfassen. Viele Aspekte blieben deshalb naturgemäß unerwähnt.
Zunächst fehlt ganz wesentlich die Potenzialanalyse, um beurteilen zu können, wie viel Wärme realistisch in Krefeld erschließbar ist. Das aber wäre sehr wichtig, um zu wissen, ob begrenzte Wärme einem stärkeren Ausbau der Fernwärme entgegensteht oder nicht. Dabei wäre die Einschätzung des Geothermiepotenzials und des Potenzials von Großwärmepumpen wichtig zu erfahren (und ggf. zu diskutieren). Die Einschätzung des zukünftigen Müllaufkommens ist zu beleuchten. Entsprechend hätte auch die Einschätzung der zukünftigen Sanierungsraten Einfluss auf die verteilbare Wärmemenge und Möglichkeiten der Temperaturabsenkung im System.
Mehr Informationen zur Kapazität der Fernwärmeleitungen wären wichtig: Z.B. wird nicht die zweite (neue) Hauptleitung das Argument verminderter Wärmeverfügbarkeit im Bereich „Innenstadt-West“ entkräften?
Die großen „Dezentralen Versorgungsgebiete“ sind noch völlig unstrukturiert. Im endgültigen Entwurf werden sich hoffentlich detailliertere Aussagen zu Zielvorstellungen finden, vor allem auch zum Konzept der Nahwärmenetze, die bisher nur in der Begriffserklärung aufblitzten.
Hat der NABU noch Ideen?
Ideen gibt es viele: Z.B. Annahme von mehr „grüner Wärme“ (v.a. mehr Geothermie und Großwärmepumpen) für mehr Fernwärme; Anschluss von (noch) mehr Wohnbereichen (die Erweiterungsgebiet umfassen aktuell großenteils Gewerbegebiete); Ausweisung der Innenstadt-West als „Fernwärme-Prüfgebiet“, damit mehr Zeit für eine Lösungsfindung bleibt, die m.E. sehr dringend ist; Fernwärmeerschließung von Hüls-Zentrum auf der Basis von Geothermie plus Biomasse (dazu Abwarten der bevorstehenden Probe-Bohrungen, d.h. im Plan Ausweisung als „Fernwärme-Prüfgebiet“) – um nur einige Gedanken zu nennen.
Es gibt aber etwas Wichtigeres als viele Ideen:
Vordringlich ist, dass der Wärmeplan rasch beschlossen wird!!! Die Reaktion im Ausschuss war positiv, so dass ich hoffe, dass ein unseliges Zerreden wie beim Klimakonzept KrKN2035 im November 2023 vermieden werden kann. Vor allem aber benötigen alle Akteure - Versorger, Stadt, Betriebe und Privatpersonen - baldestmögliche Investitionssicherheit. Dann kann Klimaschutz in Krefeld endlich real werden. Dann gilt der Grundsatz: „Möglichst viel möglichst schnell“, um unser Klimabudget nicht länger zu überlasten (Blog 43). Es können viele Bürger vor der „Kostenfalle“ bewahrt werden (siehe Blog 29).
Wir werden Hebel finden, den Fernwärmeausbau zu beschleunigen (z.B. Verkürzung von Genehmigungsverfahren, Aufstockung der Bautrupps) und vor allem Motivations- und Unterstützungsprogramme für die privaten Sanierungs-Investitionen schaffen. Mehr Bundesförderung ist unerlässlich (zukünftige Regierungen werden Druck von den Kommunen bekommen, die jetzt zunehmend ihre Pläne konkretisieren), aber wir können auch lokal Programme entwerfen. Die Sparkassen könnten helfen uva. - Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Der Vortrag im Umweltausschuss endete mit dem Bild des Apfelbaumes, welches Herr Liedtke, Vorstand der Stadtwerke eingebracht hat: Wir müssen mit der Ernte der „tief hängenden Früchte“ beginnen – so rasch wie möglich! Und uns parallel nach oben vorarbeiten.
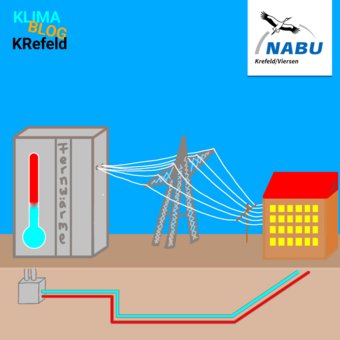
Aktuell wird über den Krefelder Wärmeplan verhandelt. Darin wird festgelegt werden, in welchen Gebieten welche Heizformen Vorrang haben sollen. Eine wichtige Frage ist dabei die Ausdehnung der sogenannten Fernwärmevorranggebiete.
In den Einfamilienhausgebieten der Außenbezirke wird es keine Fernwärme geben, da die Wärmeabnahme zu gering ist und allein schon die langen Zuleitungen (zu den Gebieten und den einzelnen Häusern) die Versorgung unwirtschaftlich macht (eine Fernwärmeleitung kostet zwischen 2.500 und 5.000 Euro pro Meter!). Allenfalls sehr große Objekte mit hohen Abnahmemengen könnten etwas abgelegenere Erschließungen in Einzelfällen sinnvoll machen, was einigen kleineren Objekten „zufällig“ eine Leitung vor der Haustüre bescheren könnte.
Generell haben die SWK auch die Faustregel, dass sich die Erschließung von Mehrfamilienhäusern erst mit mehr als sechs Wohnung lohnt. Damit – besonders bei isolierter Lage - bleiben auch die meisten Mehrfamilienhaussiedlungen außen vor.
Umgekehrt sieht es im Innenstadtbereich aus. Dort gibt es mehrstöckige Häuser dicht an dicht, die einen hohen Wärmebedarf pro Meter Straßenzug haben und sich gut für eine wirtschaftliche Fernwärmeversorgung eignen (siehe Energieatlas NRW, „Raumwärmebedarf“: https://www.energieatlas.nrw.de/site/planungskarte_waerme ). Besonders günstig ist, wenn es in den jeweiligen Bereichen große Objekte (Schulen, Behörden etc.) gibt, die eine hohe Wärmeabnahme garantieren (sogenannte „Ankerobjekte“).
Innerhalb der Wälle und im östlichen Innenstadtbereich beispielsweise (aber auch in anderen Stadtbereichen) besteht bereits eine dichte Erschließung durch Fernwärmeleitungen (aktuelle Karte – vor Wärmeplan - siehe https://www.swk.de/geschaeftskunden/waerme/fernwaerme-in-krefeld ). In diesen, schon erschlossenen Bereichen können zusätzliche Häuser ohne großen Aufwand angebunden werden. Man nennt diese Bereiche „Fernwärme-Verdichtungsbereiche“.
In weiteren baulich verdichteten Bereichen kann das Netz durch geringen Aufwand ausgebaut werden – sogenannte „Fernwärme-Erweiterungsgebiete“. Welche Gebiete dies sind, wird im Rahmen der Wärmeplanung festgelegt werden müssen.
Gibt es schon Anhaltspunkte, wo Fernwärme kommen wird?
Es gibt seitens der SWK Andeutungen wie und wo sie sich eine Fernwärmeerweiterung vorstellen könnten. Einem „Positionspapier“ von November 2023 (siehe Blog 44) und einem Vortrag von Herrn Liedtke im Umweltausschuss von April 2024 waren Hinweise zu entnehmen. Die SWK streben danach eine Verdoppelung der Länge des Fernwärmenetzes von 97 km auf knapp 200 km an. Die notwendige Erzeugungskapazität steigt um 150 MW von 95 MW auf 245 MW. Es sollen dabei mindestens 2.500 neue Anschlüsse ermöglicht werden (aktuell 1.700), bzw. die Anschlussrate in Krefeld soll von 3% auf 10% steigen (was sogar eine Verdreifachung wäre). Erweiterungen finden in der Regel angrenzend an bestehende Versorgungsgebiete statt (z.B. Nord-Uerdingen, Süd-Dießem, Südwest-Inrath).
Anmerkung: Eine Verdreifachung der Anschlussrate ist erfreulich ehrgeizig! Allerdings liegen wir im Städtevergleich damit leider immer noch eher niedrig. (Spitzenreiter ist Flensburg mit 95% Anschlussrate, viele Städte liegen zwischen 20 und 40%).
In welchen Gebieten bestehen aus Sicht des NABU besondere Herausforderungen?
Beispielhaft seien (wie schon in Blogs 47 und 48 angedeutet) zwei große Gebiete genannt, in denen nach den ersten Verlautbarungen der SWK nicht an Fernwärmeerweiterung gedacht wird. Auf der aktuellen Karte der bestehenden Leitungen (Link s.o.) kann man sehr gut die „flächigen Lücken“ der Versorgung im Westen der Innenstadt und im Bereich Cracau erkennen. Dort denken die SWK zunächst nicht an eine Fernwärmeversorgung. Es besteht aber eine hoch verdichtete Bebauung mit hohem Wärmebedarf, hohem Sanierungsbedarf - aber problematischer Investitionsbereitschaft (s.u.) und schwierigen Bedingungen für Wärmepumpen. Fernwärme könnte hier helfen.
Warum die SWK das Netz mutig verdoppeln wollen, aber nicht vervierfachen?
Einige Gründe seien schlagwortartig erwähnt: Zu wenig Zeit, zu wenig Fachkräfte, zu viele Baustellen, zu langsame Genehmigungsprozesse. Am häufigsten aber wird genannt: Es gebe zu wenige „grüne Wärmequellen“ (zu den gegenwärtigen Wärmequellen siehe Blog 25). Alle Gründe haben ihre Berechtigung. Zu allen lassen sich aber auch Abhilfemöglichkeiten formulieren. Sogar zu den Wärmequellen wird die Potentialanalyse des Wärmeplanes, die in diesen Tagen fertiggestellt wird, vermutlich Vorschläge machen. Unbestritten ist aber, dass die meisten Steigerungsmaßnahmen, insbesondere Investition in „grüne Technologie“, Geld kosten werden. Die SWK fürchten, dass ein sehr forcierter Ausbau hohe Kosten machen würde und damit die Fernwärmepreise deutlich in die Höhe treiben würde. Eine Optimierung der gegenwärtigen Erzeugung ist noch möglich, dann aber sind neue Technologien gefordert, die teuer sind.
Ein Beispiel: Um die (im Prinzip kostenlos vorhandene) tiefe Erdwärme zu nutzen (siehe Blog 9), sind sowohl teure Tiefenbohrungen (mehrere Millionen Euro pro Bohrung) und teure Großwärmepumpen (hunderttausende Euro) notwendig. Die Kosten müssen auf die Fernwärmepreise verteilt werden müssen – wenn auch über viele Jahre. Ebenso bei der Wärmegewinnung aus dem Rhein (Blog 16) oder großen Solarwärme-Kollektorfeldern (für die zudem der Platz strittig wäre).
Umgekehrt muss man im Blick behalten, dass die Fernwärmepreise in Krefeld im Bundesvergleich sehr günstig sind (https://waermepreise.info ). Das liegt an der günstigen Wärmeproduktion der Müllverbrennungsanlage (MKVA), die uns noch lange (aber nicht unbegrenzt) erhalten bleiben wird. Andererseits gibt es klare Grenzen nach oben: Wenn die Preise zu sehr steigen, geht der Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Energieträgern verloren und der Ausbau wird unwirtschaftlich (wenn der unpopuläre Anschlusszwang vermieden werden soll).
Zudem liegen wir auch mit der angedachten Ausbaurate von 10% noch deutlich unter vergleichbaren Städten. (Es müssen ja nicht gleich 95% wie Flensburg sein).
Wer sind die Kostenträger der Energiewende?
Dass die Transformation des Energiesystems notwendig ist, wird nur noch von Randgruppen bestritten. Dass diese viel kostet, ist unbestritten. Dass Nichtstun die Gesellschaft ungleich mehr kosten würde, ist vielfach berechnet worden. Irgendjemand aber muss zahlen! Für Krefeld hat das Gutachten „KrefeldKlimaNeutral 2035“ einen mehrstelligen Milliardenbetrag errechnet, den die Transformation in Krefeld bis 2035 kosten soll. Auch wenn dieser aus Sicht des NABU viel zu hoch gegriffen ist (siehe Blog 40) werden es mehrstellige Millionenbeträge sein (dazu mehr in Blog 35). Privatleute tragen mit Dämmmaßnahmen und Austausch ihrer Heizungen den größten Anteil (und mindern damit ihre zukünftigen Heizkosten). Die SWKtragen vor allem die Investitionskosten für die Erweiterung des Fernwärmenetzes und die Ertüchtigung des Stromnetzes, können diese Kosten aber langfristig auf die Verbraucher umlegen. Weitere Investoren sind Wirtschaftsbetriebe und die Stadt Krefeld. Bund und Land helfen mit diversen Zuschüssen.
Fernwärmeausbau – und die gesellschaftliche Verteilung der Energiewendekosten
Ein Beispiel soll nun die Verteilungsfrage illustrieren: Ein Hausbesitzer in Cracau hat zwölf Mieter. Das Haus hat eine Gas-Zentralheizung. Mit steigendem CO2-Preis steigen die Heizkosten (siehe dazu auch Blog 29 „Kostenfalle“). Den Großteil dieser Kostensteigerung tragen die Mieter – auch wenn ein Teil neuerdings auf den Vermieter umgelegt wird. Der Vermieter könnte den Anstieg der Heizkosten durch kleinere Maßnahmen bremsen (Fenstertausch etc.). Aufhalten könnte er ihn aber lediglich durch eine umfassende Sanierung(Außenwanddämmung, Heizungstausch). Er kann Zuschüsse beantragen, dennoch trägt er einen Großteil der Investitionskosten selbst. Nach Sanierung kann er durch eine (gedeckelte) Mieterhöhung nach und nach einen Teil der Kosten wieder einholen. In jedem Fall hat er eine hohe individuelle Investition zu tätigen, womit viele Vermieter ad hoc überfordert sein werden. Zudem steht der Vermieter unter Zeitdruck durch die Kostensteigerung und die gesetzlichen Anforderungen. Noch komplexer werden Lösungen bei Eigentümergemeinschaften oder Etagenheizungen.
Bekommt das Haus einen Fernwärmeanschluss, sieht die Verteilung anders aus: Der Anschluss an die Fernwärme in verdichtetem Gebiet erfordert keine lange Zuleitung. Die Umbaumaßnahmen im Haus halten sich (bei Zentralheizung) finanziell und aufwandmäßig in Grenzen. Danach ist die Heizung mit „grüner Wärme“ im Sinne der Gesetze zunächst einmal geregelt. Eine Dämmung der Außenwände wäre zwar immer noch wünschenswert – ökologisch und da dadurch die Heizkosten für die Mieter beträchtlich sinken. Die Investition kann aber in aller Ruhe geplant und durchgeführt werden. Sie ist auch kleiner, da ein Teil der Investitionen von den SWK getragen wird (Tausch des Wärmeerzeugers). Diese Investition, sowie eine mögliche Preissteigerung durch die vermehrte „grüne Wärme“, werden allerdings anschließend über die Fernwärmepreise auf alle Fernwärmeabnehmer verteilt.
(Hier wird nur das Preisgefüge betrachtet: Sonstige Vorteile der Fernwärme wurden schon angedeutet in Blog 25: Weitere Fördermittel, lange Abschreibungszeiten, leichtere Kredite, Skalengewinne durch größere Investitionen - eine Großwärmepumpe kostet weniger als 100 kleine, Einbindungsmöglichkeit verschiedenster Wärmequellen usw.).
Wieviel Fernwärme wäre also optimal?
Wie man an diesem einen Beispiel sieht, führen unterschiedliche Ausbaustufen zu unterschiedlicher Verteilung der Kosten. Ein optimales System ist schwer zu berechnen. Einerseits wegen der vielen Einflussfaktoren – andererseits wegen des Abwägens sehr unterschiedlicher Interessen. Der Stadtrat wird den Plan beschließen müssen. Es würde dabei vielleicht helfen, verschiedene Pfade kostenmäßig abzuschätzen. Beispielsweise: Welche Ausbaustufe des Fernwärmenetzes führt zu welchen Steigerungen des Fernwärmepreises? Die Politik muss am Ende entscheiden, zu welchen Anteilen der Einzelne und zu welchen Anteilen die Gemeinschaft die Preissteigerungen tragen sollen. Es müssen alle an einem Strang ziehen, um die schlimmsten Schäden der Klimaveränderungen abzuwenden. Die Verteilung der Kosten jedoch kann in Grenzen beeinflusst werden.
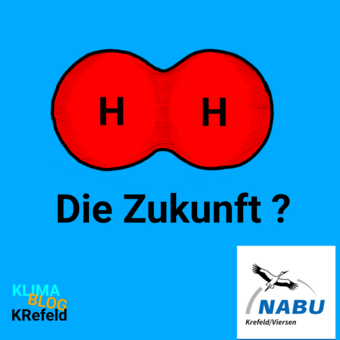
Wir haben uns in Deutschland viel vorgenommen. Noch vor fünf Jahren redeten nur Fachleute von Wasserstoff. Heute ist er „die Zukunft“, unerlässlich für die Klimaziele und soll unsere Industrie vor der Abwanderung retten. Unzweifelhaft wird er eine zentrale Rolle in der zukünftigen Energiewirtschaft spielen. Die Bedeutung ist klar und man weiß auch in etwa welche Mengen gebraucht werden (laut Nationalem Wasserstoffrat: 2030: 94-125 TWh; 2045: 620 bis 1288 TWh – die Zahlen wurden zwischen Februar 2023 und Mai 2024 um 68% nach oben revidiert https://www.wasserstoffrat.de/fileadmin/wasserstoffrat/media/Dokumente/2024/2024-05-03_NWR-Grundlagenpapier_Update_2024_Wasserstoffbedarfe.pdf ). Aber auf dem Weg dahin gibt es noch viele Hindernisse.
Nach Jahren der Stagnation beeilt sich die Regierung, alle Rahmenbedingungen zu schaffen. Es sind aber sehr viele Baustellen auf einmal, optimale Lösungen sind im Geflecht komplexer Probleme schwer zu finden und zunehmend viele Menschen sind von den Änderungen persönlich betroffen. Das verunsichert auch. Entsprechend wachsen auch die Widerstände. Das macht es nicht einfacher, die notwendige grundlegende Transformation nun im Eiltempo durch die noch friedlich auf dem zweifelhaften Ruhekissen billigen russischen Gases ruhende Bevölkerung zu treiben.
Die sorgenvollen Stimmen werden lauter
Umgekehrt aber wird der Bedarf in der Industrie immer deutlicher gesehen. Entsprechend mehren sich sorgenvolle Stimmen von Industrievertretern. Die Presse veröffentlicht zunehmend warnende Artikel (Handelsblatt, Spiegel, Deutsche Wirtschaftsnachrichten). Es betrifft dies Bundesebene und Landesebene gleichermaßen. In NRW mahnt eine Studie der IHK Tempo an (https://www.ihk.de/lippe-detmold/hauptnavigation/beraten-und-informieren/energie/aktuelles/mittelstand-beim-wasserstoffhochlauf-nicht-abhaengen-6163342 ) der WDR stimmt ein („Scheitert die Wasserstoffstrategie?“ vom 16.6.2024: https://www1.wdr.de/fernsehen/westpol/videos/scheitert-die-wasserstoffstrategie--100.html ).
Sogar der Nationale Wasserstoffrat äußert sich
Besonders ernst zu nehmen ist eine aktuelle Stellungnahme des „Nationalen Wasserstoffrates (NWR)“ vom 21.6.2024: „Wasserstoffhochlauf in Gefahr – Sofortmaßnahmen dringend erforderlich“, denn der Wasserstoffrat ist das führende beratende Experten-Gremium der Bundesregierung (https://www.wasserstoffrat.de/fileadmin/wasserstoffrat/media/Dokumente/2024/2024-06-21_NWR-Stellungnahme_H2-Hochlauf_in_Gefahr.pdf ).
In der achtseitigen Stellungnahme wird deutlich, an wie vielen Stellen der Wasserstoffhochlauf noch hakt. Es sind zu viele Punkte, um sie hier detailliert zu erklären (es lohnt sich die gut lesbare Stellungnahme selbst zu lesen). Die Vielfalt kann nur angedeutet werden: Eine Haupthürde ist, dass die Preisdifferenz zwischen Angebotsseite (Preisgrenze für Investitionsentscheidung) und der Zahlungsbereitschaft auf der Abnahmeseite zu groß ist. Lösungen sind zwar angedacht aber mit zu wenig Mitteln ausgestattet, um Vertrauen zu erwecken. Es braucht langfristige und verlässliche Rahmenbedingungen und Anreize – und das in unserer turbulenten Zeit. Für die in Deutschland geplante Wasserstofferzeugungsleistung von 10 GW in 2030 liegen entsprechende Investitionsentscheidungen für nur 0,3 GW vor. Für die 2030 benötigten Mengen würden insgesamt sogar 29 bis 52 GW Elektrolyseleistung benötigt, d.h. man rechnet sehr mit dem Ausland. Auch im Ausland aber stagnieren die Projekte durch fehlende Abnahmegarantien; dazu bedürfte es außerdem noch einer Importstrategie der Bundesregierung, einer leistungsfähigen Hafenstruktur, einer Cracker-Struktur (z.B. Ammoniak) und eines langfristigen Engagements der Durchleitungsländer. Auch Kernnetze und Verteilnetze kommen langsam voran. Es fehlt noch eine Speicherstrategie sowie die Anreize für deren Aufbau und der gesetzliche Rahmen für die Umwidmung der Gasleitungen. Es fehlen Strukturen/Anbieter, die Angebot und Nachfrage verbinden. Es fehlen Regulierungsrahmen. Definitionen und Normen sind noch nicht vorhanden oder praxistauglich. Gleichzeitig sind die vorhandenen schon so komplex, dass viele Betriebe überfordert sind. Es fehlt an Elektrolyseuren, da Stromnetznutzungsentgelte und Genehmigungsstau bremsen. Die Ausschreibung der „Important Projects of Common European Interest (IPCEI) läuft schleppend; der Preisverfall der THG-Quoten durch „offensichtlich betrügerische Aktivitäten“ im Ausland bremst. In der Kraftwerksstrategie wurde Wasserstoff ausgespart. Im Verkehrsbereich fehlt die Tankstellenstruktur.
Politische Rahmenbedingungen zunehmend unsicher
Wie man sieht, müssen die vielen Glieder der Wasserstoffproduktions- und Lieferkette alle gleichzeitig vorangebracht werden. Und da die Zeit denkbar knapp ist, muss dies sehr schnell geschehen. Erfreulicherweise zieht die Industrie – zumindest im Bereich Wasserstoff – am gleichen Strang. Die politischen Rahmenbedingungen aber werden angesichts klimakritischer Wahlen im Ausland und im Inland nicht einfacher. Leicht können damit Glieder der Kette wegbrechen. Dann kommt Wasserstoff später oder/und wird teurer.
Was bedeutet das für Krefeld?
Dass auch Krefeld klimaneutrale Energieträger/Gase einplant, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, ist sinnvoll. Zum Beispiel könnten die Heizwerke für die Fernwärme damit betrieben werden. Wenn diese nur in Spitzenlastzeiten eingesetzt werden, spielt der Preis des Energieträgers eine geringere Rolle. Hier könnte also ggf. auch Wasserstoff zum Einsatz kommen. Ob man allerdings Privatpersonen, die den ganzen Winter ihre Wohnung heizen müssen, das Risiko eines möglicherweise ziemlich teuren Energieträgers zumuten will, steht auf einem anderen Blatt. Die meisten anderen Städte, die schon Wärmepläne haben, nutzen deshalb keine Ausweisung von „Wasserstoff-Vorranggebieten“.
Ein aktuelles Beispiel ist z.B. die Stadt Hannover, die kürzlich beim Land Niedersachsen ihren Wärmeplan zur Genehmigung eingereicht hat (https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Klimaschutz-Energie/Klimaschutz-konkret/Wärmewende-Hannover/Wärmeplanung-Hannover ). Dieser ist erneut ein gutes Modell dafür, wie Wärmeplanung in einer Stadt mit mehreren hunderttausend Einwohnern aussehen kann. Die Rahmenbedingungen sind in vieler Hinsicht vergleichbar mit Krefeld, und auch Hannover wird an einer Hauptversorgungsleitung für Wasserstoff liegen. Trotzdem wird bezüglich Wasserstoffs auf Seite 37 des Erläuterungsberichtes mitgeteilt: „Es ist davon auszugehen, dass Wasserstoff ein knappes Gut sein wird und daher fast ausschließlich für den Einsatz in Kraft- und Heizwerken mit eng begrenzter Betriebsstundenzahl zur Deckung der winterlichen (Strom- und) Wärmelastspitzen zum Einsatz kommen wird, nicht hingegen flächig in der dezentralen Wärmeversorgung von Gebäuden.“
(Zu Wasserstoff siehe auch Blogs 10, 14, 19, 26 und 46).
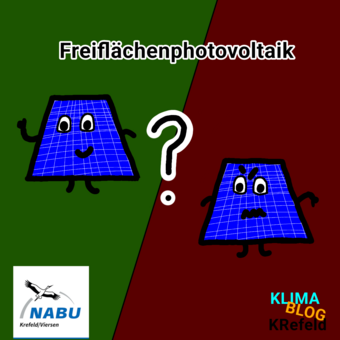
Zum 31.12.2023 waren in Deutschland 81,9 GW Photovoltaik installiert, davon 29% Freiflächenanlagen. Im Rahmen des EEG 2023 wird eine hälftige Aufteilung des weiteren Zubaus auf Dach- und Freiflächenanlagen vorgesehen – je 200 GW bis 2040. Die Ausschreibungen für Freiflächenanlagen sollen ab dem Jahr 2025 9.9 GW pro Jahr betragen. In der Diskussion um die Orte, wo Freiflächenanlagen genehmigt werden könnten, fallen bundesweit und in Krefeld viele Gegenargumente, von denen einige in der Folge kurz beleuchtet werden sollen.
Flächenkonkurrenz mit Nahrungsmitteln?
Diese wird oft angeführt. Allerdings liegt die benötigte Gesamtfläche für den oben genannten Zubau von 200 GW bis 2040 nur bei 1,7% der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächen (280.000 ha von 16,6 Millionen ha). Ein Zusammenbruch der Nahrungsversorgung ist also nicht zu befürchten (eher durch ungebremste Klimaveränderungen).
Zudem werden bereits etwa 14% der gesamten Anbaufläche für Energiepflanzenanbau (für Biogas und Biodiesel) genutzt – eine achtfach größere Flächenkonkurrenz. Wenn man (als Denkmodell) für den Bau der Solaranalagen nur auf diese mit Energiepflanzen bebauten Flächen zugriffe, benötigte man davon nur ein Achtel, würde aber aufgrund des wesentlich höheren Energieertrages von Photovoltaik, den Gesamtenergieertrag der Energie-Produktionsflächen um das 2,4fache steigern. Ein Hektar PV erzeugt 28mal mehr Strom und 54mal mehr Wärme als ein Hektar Energiepflanzen (Thünen-Institut https://www.thuenen.de/media/ti/Newsroom/Faktencheck/Energie_vom_Acker/emsbache__Boehm__462_UEB_2_17.3.14h_mit_DECKBLATT.pdf ).
Nachteil für Biodiversität?
Beim Bau von PV-Freiflächenanlagen kann es zu positiven oder negativen Auswirkungen auf die Biodiversität kommen. Es hängt von der Vornutzung ab. Sogenannte Konversionsflächen oder wiedervernässte Flächen bei Moor-PV erfahren sicher eine Aufwertung, ein Naturschutzgebiet sicherlich nicht. Zudem besteht i.d.R. der Vorzug der Pestizid- und Düngemittelfreiheit der Fläche und der relativen Ungestörtheit des Habitats. Geschickt in eine Flächenkulisse integriert, können nützliche Rückzugs- und Pufferräume entstehen. Durch biodiversitäts-optimierte Gesamtanlage (Modulanordnung, spezielle Zäune etc.) und aufwertende Elemente im Sinne von Biodiversität-PV (Blühflächen, Steinhaufen, Totholzhaufen, Rohbodenstellen, Minigewässer, Hecken, Nisthilfen uva.) können klare Biodiversitätsvorteile gegenüber intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen erzielt werden (siehe NABU-Position Biodiversitätsanlagen https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/solarenergie/220330-nabu-positionspapier-solarenergie-solarparks-naturvertraeglicher-ausbau.pdf oder NABU/Bundesverband Solarwirtschaft https://www.solarwirtschaft.de/datawall/uploads/2021/05/bsw_pm_nabu_ffa_standards.pdf ).
Lieber versiegelte Flächen überbauen, statt freie Landschaft?
Es ist zweifellos sinnvoll, Parkplätze, ungenutzte Industrieflächen, Industriedachflächen etc. mit Photovoltaik zu überbauen. Diese Position teilen zahlreiche Institute und Verbände (KNE, UBA, BfN, NABU, BSW etc.). Leider gibt es dort oft viele Hemmnisse, die den Ausbau erschweren (höhere Kosten, aufwändigerer Bau, rechtliche und bauliche Hindernisse etc.). Auf längere Sicht wäre die Zubaumenge von 200 GW bis 2040 auch vollständig auf solchen Flächen unterzubringen. Wie aber zuletzt noch in Blog 50 angedeutet, fehlt uns die Zeit. Wir brauchen auch kurzfristig realisierbare CO2-Vermeidung und Freiflächen-PV ist einfach am schnellsten zu realisieren. Um später ungleich größeren Schäden der Biosphäre durch den Temperaturanstieg vorzubeugen, sollten wir vielleicht hie und da (es geht um deutlich unter 1,7% der Fläche) optisch unteroptimale Lösungen zugunsten der Zukunftsvorsorge tolerieren. Dies gilt besonders für das Umfeld großer Städte, die überproportional viel Energie verbrauchen. Wer viel Energie verbrauchen will, sollte auch die Erzeugungsanlagen tolerieren. Die Brennmittel können leider nicht mehr „unauffällig“ aus den Böden von fernen Ländern gewonnen werden. Die Solar- oder Windkraftanlage vor der eigenen Türe tut zwar vielleicht dem Auge mehr weh (wobei wir uns an Schornsteine und Überlandleitungen ja auch gewöhnt haben), unseren Kindern und zukünftiger Natur aber weniger. Vielleicht hilft auch der Gedanke, dass die Wertschöpfung in der Stadt bleibt, lokale finanzielle Beteiligungen möglich sind und sogar Zuschüsse zu Vereinen und sozialen Aktivitäten generiert werden können. Zudem wird ja v.a. der Bau entlang von Autobahnen, Bahnstrecken etc. privilegiert, wo ohnehin schon optische und emissionsbedingte (Abgase, Abrieb, Lärm) Beeinträchtigungen bestehen.
Landwirtschaft und Landwirte
Gerade unter Landwirten wird Freiflächen-PV sehr unterschiedlich beurteilt. Das ist verständlich. Ein Grundbesitzer kann Einnahmen mit einer Freiflächen-PV-Anlage machen, ein Pächter verliert jedoch seine Anbaufläche ersatzlos. Hinzu kommen negative Effekte durch mögliche Bodenpreissteigerungen u.a.. Agri-PV(d.h. Photovoltaik und Anbau auf der gleichen Fläche) könnte einen Teil zur Lösung beisteuern, ist aber ebenfalls teurer (weshalb Sonderausschreibungen geplant sind) und hat auch ihre Probleme, die vielleicht in einem späteren Blog einmal diskutiert werden können (- optisch wäre sie sogar ein stärkerer Eingriff als Flächen-PV). Eine großflächige schnelle Lösung verspricht sie eher nicht. Die Möglichkeit der (temporären) Nutzung von Stilllegungsflächen, die laut EU-Agrarrecht ab 2024 4% der Fläche umfassen müssen (GLÖZ-Standard), für Photovoltaik wird derzeit EU-rechtlich geprüft und möglicherweise ermöglicht, so dass vielleicht ein weiterer Teil der Konflikte lösbar ist. Auch Veränderungen des Erbschaftsrechtes werden geprüft, um Hindernisse für Landwirte abzubauen. Auch die ungewöhnliche Güte speziell der Krefelder Böden wird oft angeführt. Aber letztlich soll ja ggf. nur auf einen winzigen Bruchteil zugegriffen werden und selbst dieser muss nicht dauerhaft erfolgen. Der Boden wird ja nicht versiegelt oder nachhaltig geschädigt und kann ggf. durch Abbau der Solaranlage am Ende ihrer Nutzungsdauer (oder im Notfall) wieder in Nutzung genommen werden. Man könnte ihn in der Zeit sogar gezielt ertüchtigen (Humusaufbau etc.). Wenn also in 20 Jahren alle Industrieflächen mit PV versorgt sind, kann man die guten Böden wieder zur Bekämpfung von eventuellen Nahrungsknappheiten in die landwirtschaftliche Nutzung zurückführen. Die angestellten Überlegungen bedeuten natürlich komplexe wirtschaftliche Abwägungen, die die einzelnen Nutzer und Besitzer jeweils für sich anstellen müssen.
Quelle der Zahlen v.a. Öko-Institut e.v.: „Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland“, Überblicksstudie vom 4.4.2024: https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/PVFFA_Ueberblicksstudie.pdf
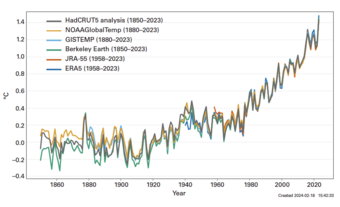
Blog Nummer 50 rechtfertigt vielleicht ein paar Schlaglichter, wo wir heute mit unseren Bemühungen um die Eindämmung der weltweiten Klimaveränderungen stehen. Dazu werden einige wichtige wissenschaftliche Organisationen und Gremien zitiert:
Das Klima ändert sich rasanter denn je
Die World Metereological Organisation (WMO) stellt in ihrem Bericht „State of the global Climate 2023“ (https://library.wmo.int/viewer/68835/download?file=1347_Statement_2023 _en.pdf&type=pdf&navigator=1 ) fest, dass das Jahr 2023 mit Abstand das wärmste Jahr seit Beginn der Klimaaufzeichnungen vor 174 Jahren war, mit einer globalen Durchschnittstemperatur in Oberflächennähe von 1,45 Grad Celsius über dem vorindustriellen Ausgangswert (der scharfe Temperaturanstieg 2023 ist in obiger Grafik gut erkennbar). WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo kommentiert die Ergebnisse: „Noch nie waren wir so nah an der Untergrenze von 1,5 Grad des Pariser Abkommens zum Klimawandel. Was wir im Jahr 2023 erlebt haben, insbesondere die beispiellose Erwärmung der Ozeane, den Rückzug der Gletscher und den Verlust des antarktischen Meereises, ist besonders besorgniserregend“.
Besorgniserregend seien die Hitzewellen der Meere, besonders im Nordatlantik. Sie lägen bis zu 3 Grad über dem Durchschnitt. Im Mittelmeer gab es zum zwölften Mal in Folge fast flächendeckend schwere Hitzewellen. Betroffen waren wesentlich auch der Golf von Mexiko, die Karibik, der Nordpazifik und weite Teile des südlichen Pazifik. Offenbar seien die Ozeane der Welt an den Grenzen ihrer Wärmespeicherfähigkeit angekommen. Das könnte einen Turbo für die Aufheizung der Luft bedeuten. Als ein Symptom von vielen: Die Gletscherschmelze wird befeuert: Allein in den letzten zwei Jahren verloren Gletscher in der Schweiz 10 Prozent ihres Volumens (vergleichbar auch andernorts).
Die Menschheit reagiert – aber zu verzagt
Einen Hoffnungsschimmer sieht die WMO im wachsenden weltweiten Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Zubau an erneuerbaren Kapazitäten stieg gegenüber 2022 um fast 50 Prozent. Wie allerdings die „International Renewable Energy Agency (IRENA)“ in einer Bewertung kritisch anmerkt (https://mc-cd8320d4-36a1-40ac-83cc-3389-cdn-endpoint.azureedge.net/-/media/Files/IRENA/Agency/ Publication/2024/Mar/IRENA_Tracking_COP2__outcomes_2024.pdf?rev=6a40bf8184744e209283c159ab779603 ), sei der Ausbau zwar beträchtlich und erfreulich, müsse aber jährlich dreimal so hoch sein, um die bei der 28. Vertragsstaatenkonferenz der Klimakonvention im November 2023 in Dubai vereinbarte Verdreifachung der regenerativen Energieerzeugung bis 2030 zu erreichen.
Die Emissionen müssten viel rascher gesenkt werden
Der „Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU)“ sprach sich in einer aktuellen Stellungnahme von März 2024 (https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2024_03_CO2_Budget.pdf?__blob=publicationFile&v=8) nochmals sehr überzeugend dafür aus, den Bemühungen um Klimaschutz in Deutschland ein CO2-Restbudget zugrunde zu legen. Sie aktualisierten dieses nach den neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen und stellten fest: Wenn wir das gegenwärtige Tempo der Emissionsreduktionen nicht deutlich beschleunigen, haben wir in Deutschland (und Europa) das Budget, was uns zur Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles mit 67%iger Wahrscheinlichkeit noch bleibt, bereits überschritten. Zwischen 2024 und 2029 überschreiten wir das Budget für die Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles mit 50%iger Wahrscheinlichkeit und 2037 bis 2040 das Budget für die Einhaltung von 1,75 Grad mit 67%iger Wahrscheinlichkeit. Die aktuell beschlossenen Maßnahmen würden den Temperaturanstieg zwar schließlich noch unter 3 Grad Celsius abfangen, was aber zahlreiche weitere Kipp-Punkte aktivieren würde (angesprochen in Blogs 2 und 43, ein ausführlicherer Blog dazu folgt noch).
Die deutsche Politik handelt schließlich – es reicht aber noch nicht
Das Institut „Agora-Energiewende“ stellt in ihrem Bericht „Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2023“ fest, dass die Treibhausgasemissionen 2023 gegenüber 1990 um 46 Prozent gefallen seien und damit auf den tiefsten Stand seit 70 Jahren. Leider sei dies zum Teil auf krisenbedingte Produktionsrückgänge der energieintensiven Industrie zurückzuführen. Nur 15% der Reduktion sei langfristig gesichert.
Erneuerbare Energie deckten 2023 erstmals über 50% des Stromverbrauches und die Kohleverstromung sei auf einen historischen Tiefstand gefallen. Der Zubau der Photovoltaik in 2023 habe mit 14,4 GW sogar die Zubauziele der Bundesregierung übertroffen!!
Die Sektoren Gebäude und Verkehr hätten aber erneut ihr Klimaziel verfehlt. Ihre Emissionen stagnierten. Hauptgrund sei die schleppende Elektrifizierung: E-PKW stellten wie 2022 knapp 20% der Neuzulassungen. Um das Ziel von 15 Mio. E-PKW bis 2030 zu erreichen, müsse der Anteil an den Neuzulassungen in den kommenden Jahren auf 90% ansteigen. 2023 sei zudem ein Rekordjahr für Wärmepumpen gewesen – aber auch für Gasheizungen. Es seien 2,5mal mehr fossile als klimaneutrale Heizungen verkauft worden!!!
Mit dem Karlsruher Haushaltsurteil werde die Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen zum zentralen Thema für 2024. Um das 2030-Klimaziel zu erreichen seien Investitionen in Klimaneutralität dringender denn je.
Und wie steht es in Krefeld?
Der Handlungsfahrplan „KrefeldKlimaNeutral 2035“ passierte im Dezember 2023 endlich (mühsam) den Stadtrat. Eine gewisse Grundbereitschaft zu Klimaschutzmaßnahmen ist in Politik, Verwaltung und städtischen Betrieben (SWK, NGN, KBK etc.) aber deutlich erkennbar. Einige Bereiche (zum Beispiel ZGM und Zoo - Blog 24 und Blog 15) nehmen Klimaschutzmaßnahmen sehr engagiert in Angriff. Auch die SWK haben Pläne (Blog 44).
Die Krefelder Bürger haben im Jahr 2023 auf ihren Privathäusern deutlich mehr Solaranlagen gebaut als in den Jahren zuvor. Der Anstieg ist wirklich beeindruckend. Dennoch ist noch eine deutliche Steigerung notwendig, um in Einklang mit den Klimazielen zu bleiben. Parallel wurden aber leider auch noch viele Gasheizungen eingebaut und breite Sanierungsoffensiven sind kaum erkennbar.
Windkraftanlagenstandorte werden identifiziert. Ob dort hinterher aber auch der Bau von Anlagen real durchsetzbar sein wird, steht noch in den Sternen. Freiflächensolaranlagen sind ebenfalls noch umstritten. „Quartiersmanager“ machen sich in der Klimastabsstelle daran, mögliche Klimaschutzmaßnahmen in einzelnen Vierteln zu identifizieren und anzuschieben. Die Bemühungen sind aber haushaltsbedingt nur punktuell und harren natürlich noch der Umsetzung. Haben wir die Zeit?
Schneller geht es mit der Wärmplanung: Aktuell wird der kommunale Wärmeplan für Krefeld erstellt. Noch in diesem Jahr sollen Ergebnisse vorliegen. Das ist eine sehr wichtige Grundlage für die notwendigen Entscheidungen der Stadt und der Bürger (siehe Blog 47 und 48). Krefeld hat sich damit wirklich beeilt. Hoffentlich ist das Ergebnis ehrgeizig genug, um rasche und ausreichende Erfolge zu erzielen und findet aktive Akzeptanz bei Politik und Bevölkerung.
Auch in der Verkehrsplanung gibt es Initiativen (z.B. Fahrradkonzept). Hier sind die Einflussmöglichkeiten aber leider begrenzter. Die Bürger sind hier auch gefragt. Gegenüber früher sieht man aber erfreulich viele Transporträder. Der Ausbau von Ladestationen für die E-Mobilität hinkt aber noch hinterher.
Zusammenfassend tut sich in Krefeld also Einiges (hier wurden nur Schlaglichter erwähnt). Vieles ist aber noch in Vorbereitung und wird erst in den nächsten Monaten und Jahren wirksam werden können. Der Klimablog wird berichten (sie können übrigens die E-mail-Benachrichtigung aktivieren, dann verpassen Sie nichts).
Noch einmal muss deutlich betont werden, was auch die WMO noch einmal betont: Teure Maßnahmen heute lohnen sich, da Zuwarten noch teurer wird. Und schmerzhafte Veränderungen von Gewohnheiten zu akzeptieren lohnt sich auch, da die bei tatenlosem Zuwarten drohenden klimabedingten Veränderungen noch deutlich schmerzhafter werden. Erste Anzeichen zeigen sich weltweit ja leider schon deutlich.

In dem Krefelder Podcast „Heulen oder Machen“ (https://www.projektmik.com/der-krefeld-podcast/ - falls die Seite nicht weiterleitet, weiter über "home" dann "Heulen oder Lachen"), in dessen 26. Folge im Januar 2024 Carsten Liedtke, Vorstand der SWK interviewt wurde (hörenswert!), sagte dieser sinngemäß, es werde in absehbarer Zeit ausreichend Wasserstoffangebote aus aller Welt geben. Aus weit entfernten Gebieten, wie z.B. Australien, werde er in Form von Ammoniak transportiert werden können.
Letzteres entspricht auch der gegenwärtigen Studienlage. Studien von 2024 (z.B. Hypat/Fraunhofer https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cce/2024/HyPAT_Impulspapier_Importstrategie_Wasserstoff.pdf ) sowie der Nationale Wasserstoffrat (https://www.wasserstoffrat.de/fileadmin/wasserstoffrat/media/Dokumente/2024/2024-01-19_NWR-Stellungnahme_Importstrategie.pdf ), sind sich einig in drei Aussagen:
Zu den dabei zu beachtenden Problemen ist in diesem Blog schon viel gesagt worden (Blogs 45, 26, 14, 10) und noch mehr könnte gesagt werden. Hier aber geht es nur um den Aspekt des im Rahmen der bevorstehenden Etablierung einer Wasserstoffwirtschaft zu erwartenden Strukturwandels.
Der Transport als Ammoniak ist sinnvoll
Deutschland (wie auch Belgien und die Niederlande) werden Wasserstoff importieren müssen. Da viele sonnen- und windreiche Länder außerhalb der Reichweite von Pipelines liegen (und die nah gelegenen Länder, z.B. Frankreich und Spanien, ihren grünen Wasserstoff großenteils selbst brauchen), wird auch der Transport in Form einer Trägersubstanz notwendig sein. Herr Liedtke wird vermutlich recht behalten, wenn er Ammoniak als eine wichtige zukünftige Transportform des Wasserstoffes benennt (siehe auch UBA: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/ files/medien/479/dokumente/uba_kurzeinschaetzung_von_ammoniak_als _energietraeger_und_transportmedium_fuer_wasserstoff.pdf ). Ammoniaktransport ist erprobt. Entsprechende Schiffs-, Anlandungs- und Aufspaltungskapazitäten müssten allerdings noch geschaffen werden. Japan und Südkorea stehen schon in recht konkreten Verhandlungen mit Australien über große Ammoniak-Mengen; ein Teil könnte aber den Weg bis zu uns schaffen. In Deutschland plant BP zusammen mit BASF bereits eine erste Cracking-Einrichtung, um aus dem Ammoniak wieder Wasserstoff zu machen (https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-reveals-plans-to-evaluate-expansion-of-germany-green-energy-port-with-new-hydrogen-hub.html ), der dann in das zunehmend konkret geplante deutsche Wasserstoffnetz eingespeist werden kann.
Ammoniak ist auch ein wesentlicher Teil der deutschen Grundstoffchemie
In Deutschland wurden bisher jährlich knapp 3 Mio. t Ammoniak produziert (weltweit sind es 185 t, v.a. in China). Rund 80% der deutschen Produktion dienen der Düngemittelherstellung, der Rest wird für Anwendungen der Spezialchemie und andere Zwecke (Kühlmittel etc.) gebraucht. Durch die Energiekrise kam es 2022 in Deutschland zu einem Rückgang der Produktion auf rund 2 Mio. t. Es gibt vier große Produktionsstätten (Ludwigshafen, Brunsbüttel, Köln und Piesteritz nahe Wittenberg – zwei weitere Anlagen in Ludwigshafen und Piesteritz wurden bereits heruntergefahren). Die Grundstoffchemie, wozu die Ammoniakproduktion gehört, ist in Deutschland für über die Hälfte des Chemieumsatzes verantwortlich. Ammoniak wird derzeit bei 600 Grad und 200 bar Druck aus Wasserstoff und Stickstoff hergestellt (Haber-Bosch-Verfahren). Für die Herstellung von 3 Mio. t Ammoniak werden rechnerisch 500.000 t Wasserstoff jährlich benötigt. Dies sind aktuell gut 50% des Bedarfes der gesamten Chemieindustrie. In ihren Zukunftsvisionen (https://www.vci.de/vci/downloads-vci/publikation/2019-10-09-studie-roadmap-chemie-2050-treibhausgasneutralitaet.pdf , https://www.vci.de/themen/energie-klima/chemistry4climate/chemistry4climate.jsp ) geht die Chemieindustrie davon aus, dass die Grundstoffproduktion in Deutschland auch bis 2045 kaum abnehmen wird. Bezüglich des Ammoniaks könnte das ein Irrtum sein.
Ammoniakproduktion in Deutschland – ein Auslaufmodell?
Kann es sinnvoll sein, den preiswert durch Elektrolyse mit Sonnen- und Windstrom in z.B. Australien hergestellten Wasserstoff dort in Ammoniak umzuwandeln, um dieses zu uns zu transportieren, hier unter Energieaufwand den Wasserstoff abzuspalten und dann aus diesem wieder Ammoniak zu machen? Bei ungünstig strukturierter Förderung könnte das passieren – aber sinnvoll ist es nicht. Wirtschaftlich wird jede importierte Tonne Ammoniak eine Tonne deutsche Produktion ersetzen. Erst wenn die Ammoniakproduktion in Deutschland komplett eingestellt ist, wird es sinnvoll sein, in Deutschland aus Ammoniak Wasserstoff zu machen. Bis dahin wird es kostengünstiger sein, das importierte Ammoniak direkt in der weiterverarbeitenden Spezialchemie einzusetzen bzw. es weltweit für die Düngemittelproduktion zu benutzen. Die Ammoniakproduktion aus Deutschland (und mit ihr einige Folgeprodukte) ist dann erfolgreich in die Länder mit preiswerterer grüner Energie umgezogen, was für diese Länder auch einen beträchtlichen Gewinn an Wertschöpfung bedeutet. Die deutsche Chemieindustrie weiß das, sonst würde sie nicht in Cracker investieren (s.o.) und über die DECHEMA leise anregen, Wasserstoff doch möglichst hier zu produzieren. Der Wandel wird aber unvermeidlich sein und durchaus nicht nur an „hohen Energiekosten“ liegen.
Man kann Ähnliches übrigens auch für die Stahlindustrie durchdeklinieren (gerade erfolgte der Startschuss für ein Stahlwerk in Duqm, Oman, welches ab 2027 grünen Stahl produzieren soll) und für andere Bereiche. Im Ergebnis ein beträchtlicher (und letztlich auch sinnvoller) Wirtschaftswandel, der strukturiert werden muss. Zudem deutet sich an, dass Deutschland dann vielleicht weniger Wasserstoff benötigt als derzeit berechnet, die Herkunftsländer aber um so mehr Eigengebrauch haben. An der begrenzten Verfügbarkeit in Deutschland ändert sich also nichts – im Gegenteil. Und es bestätigt sich: Grüner Strom wird ein entscheidender Standortfaktor sein – was der windreiche Norden Deutschlands schon gemerkt hat (siehe auch Blog 12).
Was bedeutet das für Krefeld?
In Krefeld gibt es keine Ammoniakproduktion. Die chemische Industrie ist aber ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Im Rahmen der zu erwartenden Umstrukturierung der Grundstoffchemie in Deutschland, wird auch die Spezialchemie Änderungen ihrer Rahmenbedingungen erfahren. Umstrukturierungen sind auch hier zu erwarten. Sinnvoll ist also eine frühzeitige Ausrichtung auf zukunftsfähige Verfahren. Darüber wird in den Betrieben und den Regierungen stetig nachgesonnen. Auch Verträge über Ammoniaklieferungen werden schon abgeschlossen (z.B. zur Freude des Wirtschaftsministeriums NRW auch zwischen der Abu Dhabi Oil Company und der Currenta GmbH: https://www.land.nrw/pressemitteilung/internationale-ammoniak-kooperation-weiterer-meilenstein-fuer-eine-klimaneutrale ).
Eine Transformationsidee wären lokale Kreislaufprozesse, die Synergien freisetzen. Der Flughafen Düsseldorf braucht in Zukunft viel synthetisches Kerosin. Dieses sollte zukünftig in Kreislaufprozessen aus CO2produziert werden. Der CO2-Ausstoß der MKVA (Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage) sollte ohnehin abgefangen werden (auch wegen der Kostenersparnis bei zunehmender CO2-Bepreisung). Aber wohin damit? Könnte man nicht im Chempark Flugbenzin daraus machen? Allerdings wird dazu auch Wasserstoff gebraucht, so dass die Sonnenstaaten uns dieses Geschäft vermutlich wegschnappen. Aber auch für andere zukünftige Kohlenstoff-Kreislaufprozesse wird CO2 gebraucht werden. Es direkt vor Ort im Chempark zu verwenden könnte Vorteile bieten.
Außerdem dürften sich Investitionen in das Kunststoffrecycling lohnen, welches in der aktuellsten Zukunftsstudie „Chemistry-4-Climate“ (link s.o.) als wichtiger Wirtschaftszweig mit beträchtlichem Energieeinsparungspotential identifiziert wurde. Dazu gibt es in Krefeld schon diverse Initiativen (z.B. unter Beteiligung der EGN: https://www.plastverarbeiter.de/markt/kooperation-fuer-das-recycling-von-polystyrol-abfaellen-956.html , oder Covestro: https://rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/krefeld-covestro-forciert-das-kunststoffrecycling-mit-partner-interseroh_aid-63403733 , oder Lanxess: https://lanxess.com/de-DE/Presse/Presseinformationen/2021/10/LANXESS-bringt-nachhaltigen-Hochleistungs-Kunststoff-auf-den-Markt ). Darauf kann man aufbauen.

Wie im letzten Blog (Nr. 47) erläutert, wird die Fernwärme ein wichtiger Baustein der Energiewende in Krefeld sein. Wir können also froh sein, dass wir in Krefeld bereits ein gut ausgebautes Fernwärmenetz haben.
Wie bereits in mehreren Blogs angesprochen (z.B. Blogs 25 und 30), hat Fernwärme große Vorteile für eine Umstellung der Wärmeversorgung auf regenerative Energien:
SWK/NGN sind zunächst zurückhaltend
Trotz dieser zahlreichen Vorzüge der Fernwärmeversorgung schlagen die SWK laut ihrem Positionspapier (siehe Blog 44) „nur“ 10% Fernwärmeversorgung als Ausbauziel für Krefeld vor (von aktuell 3% der Endwärme). Das ist zwar immerhin eine Verdreifachung des aktuellen („niedrigen“) Angebotes, liegt aber weit unterhalb der Versorgungsanteile in anderen Großstädten (wobei bei Vergleichen zwischen Angaben von Heizwärme, Endwärme, Emissionsanteilen und Zahlen von Anschlüssen bzw. beheizten Wohnungen zu unterscheiden ist, die sehr unterschiedlich sein können).
Die Vorsicht von SWK/NGN ist verständlich: Bedeutet doch ein massiver Ausbau der Fernwärme eine beträchtliche Störung der Straßennutzung aufgrund zahlreicher Baustellen. Zudem ist es eine große Investition. Unklar ist, ob ein größerer Ausbau überhaupt zu schaffen ist – angesichts des aktuellen Fachkräftemangels. Schließlich wird angeführt, dass ja für zusätzliche Verbraucher auch genügend „grüne Energie“ bereitgestellt werden muss.
Im Rahmen der aktuell laufenden Wärmeplanung (Blog 47) wird zwischen Stadt, SWK und schließlich auch der Politik ausdiskutiert werden müssen, ob für Krefeld deutlich höhere Ziele anzustreben sind.
Sind andere Städte mutiger?
Viele Städte haben deutlich höhere Fernwärme-Versorgungsanteile. In Skandinavien liegt das an günstigeren historischen Rahmenbedingungen durch frühzeitige CO2-Bepreisung, in manchen deutschen Städten an günstigen Wärmeangeboten (z.B. in Bereichen mit Schwerindustrie, wie Dortmund). Manche haben auch einfach sehr frühzeitig auf Fernwärme gesetzt (z.B. Mannheim, aber letztlich auch Krefeld). Im Osten Deutschlands wurde traditionell die Fernwärme stärker ausgebaut. So kommt es, dass auch in Deutschland zahlreiche Städte Versorgungsanteile zwischen 50% und 70% vorweisen können und diese im Rahmen der Energiewende sogar noch deutlich steigern wollen. Hohe Versorgungsraten sind also faktisch möglich und können offensichtlich auch ausreichend mit grüner Energie betrieben werden.
Ist die notwendige hohe Ausbaurate ein Problem?
Ist es aber überhaupt möglich, die hohen Ausbauraten zu erreichen, die die nun stark verspätete Energiewende vielerorts erfordern würden? Hier gibt es weniger Vorbilder, da die meisten fernwärmelastigen Städte Jahrzehnte Zeit hatten, den Ausbau nach und nach voranzutreiben. Aktuell kündigen viele Städte sehr hohe angestrebte Ausbauraten an. Bisher aber nur auf Papier. Konkrete Planungen sind kaum veröffentlicht. Im Rahmen der Wärmeplanungen müssen konkretere Zahlen vorgelegt werden. Bundesweit befinden sich die Wärmepläne aber – wie in Krefeld - überwiegend noch in Bearbeitung. Einige, die fertig sind, enthalten nur sehr vage Zahlenangaben. So schlagen sowohl München als auch Stuttgart in ihren Planungen einen starken Ausbau der Fernwärme vor, lassen dies aber entweder ganz allgemein (München) oder schlagen „Prüfgebiete“ vor (Stuttgart), wo eine Fernwärmeversorgung geprüft werden soll (Links unter Blogs 38 und 39). Fertige Wärmepläne kleinerer Städte sind nur bedingt vergleichbar (Blog 39). Es gibt also leider wenig Vorbilder.
Motivierendes Vorbild Heidelberg
Heidelberg (160.000 Einwohner) hat im November 2023 seine Wärmeplanung vorgelegt und politisch beschlossen (Info und Link: https://www.heidelberg.de/hd/HD/ Leben/klimaneutrale+waermeversorgung.html ). Heidelberg hat bereits eine hohe Fernwärmeversorgung (49% der Gesamtwärme, 6.700 Anschlüsse). Sie soll aber bis auf über 70% ausgebaut werden. Konkret bedeutet das bis zu 11.200 (!) zusätzliche Anschlüsse (bei insgesamt nur 25.243 beheizten Gebäuden, d.h. Steigerung von 26% auf 44% der Anschlüsse). Davon sollen in Verdichtungsgebieten, wo bereits Fernwärme liegt, 3.800 zusätzliche Anschlüsse gelegt werden. In Erweiterungsgebieten, die ganz neu an das Netz angeschlossen werden, sollen maximal bis zu 7.600 neue Anschlüsse verlegt werden. Davon sind 3.200 Anschlüsse bereits fest vorgesehen und sollen bis 2030 erschlossen werden. Weitere 4.200 Anschlüsse sollen bis 2040 ausgebaut werden, wobei diese im Detail noch auf Tauglichkeit überprüft werden sollen. Dennoch sind die Zahlen schon recht konkret. Und sie sind sehr ehrgeizig. Immerhin wird damit politisch beschlossen angestrebt, 3.800 + 3.200 = 7.000 neue Anschlüsse großenteils bis 2030 zu schaffen und bis 2040 bis mutmaßlich bis zu 4.200 weitere. Insbesondere sieht Heidelberg kein Problem bei der Erzeugung der „grünen Energie“ (z.B. mehrere Großwärmepumpen im Neckar sowie im Klärwerkabfluss, Tiefengeothermie etc.) – und das bei wesentlich mehr Anschlüssen insgesamt und ähnlichen natürlichen Rahmenbedingungen.
Wir sollten Heidelberg nacheifern
In Krefeld haben wir derzeit 1.900 Anschlüsse. 2.500 zusätzliche sind laut Positionspapier der SWK angedacht - anscheinend überwiegend in Verdichtungsgebieten. Wie steht es mit „Erweiterungsgebieten“? Große Gebiete wie der ganze Westen der Innenstadt, große Teile Cracaus und Teile Uerdingens würden sich aufgrund Struktur und Wärmedichte als Fernwärmevorranggebiete eignen. Aufgrund ihrer Gebäudestruktur sind dort Alternativen schwierig, Besitzstrukturen bremsen private Investitionen. Um die Bürger nicht in Schwierigkeiten laufen zu lassen (hohe Heizkosten, späte überstürzte oder unzweckmäßige Sanierungen), wäre möglicherweise ein „mutiger Wurf“ wie in Heidelberg sinnvoll. Mit z.B. 10.000 neuen Anschlüssen ließe sich für einen nennenswerten Teil dieser verdichteten Gebiete eine preiswerte und sichere Wärmeversorgung schaffen. Heidelberg scheint solche Größenordnungen für machbar zu halten. Für Krefeld laufen noch die Analysen. Aber wenn Heidelberg das schafft, und auch die dazu erforderliche grüne Wärme produzieren kann, können wir das auch.
Zukunft bedeutet Baustelle – allerdings auch viele Vorteile
Allerdings müssten wir frühzeitig anfangen, den Bürgern zu erklären, dass sie die für ihre erschwinglichen und umweltfreundlichen Heizsysteme erforderliche moderne Infrastruktur zum Preis zusätzlicher Baustellenbekommen. Wobei zu bedenken ist, dass die Fernwärme z.T. Baustellen für den Netzausbau ersparenkann, der für die vielen Wärmepumpen notwendig wäre – und viele Straßen bzw. Abwasserkanäle ohnehin saniert werden müssen. Umgekehrt verkleinern sich die innerhalb der Häuser notwendigen Baumaßnahmen und Anlagen beträchtlich, Unterhaltungsaufwand über die Jahre fällt weg und die Lärmbelästigung durch zahlreiche Luft-Wärmepumpen wird vermieden, die in verdichteten Gebieten oft die einzige „Notlösung“ sind, wenn keine Fernwärme kommt und die steigenden Heiz- bzw. Sanierungs-Kosten Ende der 30er Jahre über den Köpfen zusammenschlagen.
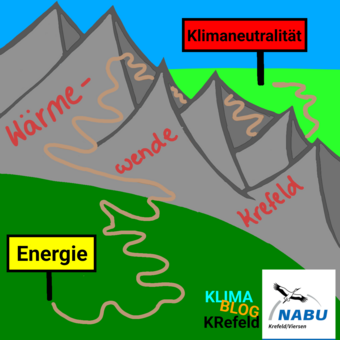
Im Januar 2024 setzte sich die Stadtverwaltung mit dem kurz zuvor beauftragten Gutachter Drees&Sommer (der auch schon bei KrefeldKlimaNeutral 2035 mitgewirkt hat), den SWK und der NGN zusammen, um das Vorgehen zur Erstellung des Wärmeplanes für Krefeld festzulegen. In Kürze soll die vereinbarte Strategie wohl auch der Politik zur Kenntnis gegeben werden. Voraussichtlich 2025 sollen erste Ergebnisse vorliegen.
Wie geht es weiter und was wäre zu wünschen?
Das praktische weitere Vorgehen dürfte sich an dem Vorgehen anderer Städte orientieren – wie z.B. in Blog 38 bereits für München skizziert. Der inzwischen fertig gestellte Wärmeplan Stuttgart ist ebenfalls ein gutes Beispiel (siehe Blog 39).
Die Erstellung eines Wärmeplanes umfasst zunächst Grundlagenanalysen zu Bedarfs- und Verbrauchsstruktur, Emissionen, Gebäudestruktur, Akteuren, Potentialen verschiedener grüner Energiequellen uva.. Eine umfassende Datensammlung ist Voraussetzung. In Krefeld liegen erfreulich viele Daten bereits vor (vorherige Gutachten, SWK/NGN, SWK-E2-Institut der FH, LANUV u.a.). Möglichkeiten zur Energieeinsparung und Effizienzsteigerung sind zu quantifizieren, potenzielle Wärmequellen zu identifizieren etc.
Für die Bürger praktisch interessant sind natürlich die Ergebnisse, vor allem die Aufteilung der Vorranggebiete für verschiedene Heizformen. Der Übersichtlichkeit halber sollen die dazu notwendigen einzelnen Schritte, die voraussichtlich in Krefeld zu gehen sind, in diesem Blog (zunächst nur stichwortartig) aufgelistet und mit schlagwortartigen „Klima-Wünschen“ des NABU versehen werden. Sowohl die einzelnen Schritte als auch die Klima-Wünsche des NABU werden anschließend in weiteren Blogs noch detaillierter zu erläutern und zu begründen sein. Auch die wichtige Frage, wie z.B. ausreichend „grüne Wärme“ in das Krefelder Fernwärmenetz kommen wird, ist noch zu diskutieren. Dieser Blog liefert erst einmal nur eine grobe Übersicht über das Vorgehen:
A) Fernwärme:
Bei der Erstellung von Wärmeplänen wird in der Regel zunächst der Fernwärmebereich betrachtet, da dieser auf bereits vorhandenen Fernwärmenetzen aufbaut und i.d.R. positiv für das Klima ist. Die SWK schlagen in ihrem Positionspapier (siehe Blog 44) eine Verdreifachung der Anschlüsse (auf ca. 10% der Krefelder Anschlüsse) mit Verdoppelung der Fernwärmeleitungslänge (von ca. 100 km auf 200 km) vor. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) weist in ihrem Energieatlas (https://www.energieatlas.nrw.de/ site/planungskarte_waerme : Wärmeplanung-Wärmenetze-Straßenzüge, Heranzoomen notwendig) allerdings für Krefeld deutlich mehr Straßenzüge mit hoher Wärmebedarfsdichte aus, so dass auf den ersten Blick ein höherer Fernwärmeanteil möglich erscheint. Dies wird diskutiert werden müssen. Damit verbunden ist auch die Frage: Wer muss investiv in Vorleistung gehen, die städtischen Institutionen oder der Bürger?
NABU-Klima-Wunsch: Da Fernwärme große Vorteile für die Energiewende hat (siehe Blogs 25 und 30), wird der NABU sich für einen möglichst breiten Ausbau der Fernwärmeversorgung einsetzen. Zudem entstünde mittelfristig bei nur 10% Fernwärmeversorgung ein soziales Problem: Viele dicht bebaute Mietshausblöcke würden nicht angeschlossen. Für Alternativen fehlen dort aber meist Geld und/oder Motivation (schwierige Refinanzierung), so dass Sanierungen unterbleiben und mit steigenden CO2-Kosten zu sozialen Problemen führen werden (mehr dazu in späteren Blogs).
Konkret gliedert sich das Vorgehen der Wärmeplanung zur Fernwärme voraussichtlich in drei Schritte:
NABU-Klima-Wunsch: Eine möglichst hohe Verdichtung (möglichst über 60% im Versorgungsgebiet) ist erstrebenswert.
NABU-Klima-Wunsch: Eine Identifizierung von möglichst vielen Erweiterungsgebieten wäre wünschenswert (analog erster Klima-Wunsch).
NABU-Klima-Wunsch: Alternativ wäre aus Sicht des NABU zu prüfen, ob nicht eine Fernwärmeversorgung für Hüls-Zentrum und Umgebung sinnvoll sein könnte. Diese könnte theoretisch sowohl als separates Netz, als auch als Erweiterung des bestehenden Netzes geplant werden.
B) Dezentrale Versorgungsgebiete:
Nach Abgrenzung des Fernwärme-Vorranggebietes wäre im Prinzip das gesamte Restgebiet dezentral zu versorgen. Laut SWK-Positionspapier wären dies rund 70% der Anschlüsse (100% minus 10% Fernwärmegebiet minus 20% „H2-Vorranggebiet“ Hüls). Die SWK machen in ihrem Positionspapier zunächst keine detaillierten Vorschläge, was in diesem Gebiet, außer privaten Wärmepumpen, geschehen könnte. Sicherlich aber gibt es auch bei den SWK Ideen. Ohne Ideen wären die Bürger genötigt, jeweils in eigener Initiative Lösungen zu finden. Im Rahmen der Wärmeplanung sollten drei Ansätze verfolgt werden:
NABU-Klima-Wunsch: Es möge eine der Hauptaufgaben des Wärmeplanes sein, lokale Chancen für Klima und Bürger zu erkennen und Vorschläge zur Umsetzung zu machen.
C) Gebiete für individuelle Lösungen:
Nach Abgrenzung des Fernwärmevorranggebietes und Identifikation aller lokalen Gebiete für die Quartierslösungen oder kleinräumigere Nahwärmelösungen klimatechnisch, wirtschaftlich und sozial möglich sind, können zunächst noch die Gebiete abgegrenzt werden, wo individuelle Lösungen der Privatpersonen und Betriebe (optimal i.d.R. Wärmepumpen, u.U. auch andere Heizformen) sinnvoll sind. Dies sind in der Regel Ein- und Zweifamilienhausgebiete mit umgebenden Freiflächen, wo Wärmepumpen gut eingesetzt werden können. Dort wird eine wärmenetzbasierte Versorgung nur in Einzelfällen günstiger sein (allenfalls bei sehr günstigen lokalen Wärmequellen oder Einzellösungen behindernden Rahmenbedingungen).
NABU-Klima-Wunsch: Der NABU würde sich wünschen, diese Gebiete sehr intensiv zu überprüfen (Punkt B), ob nicht doch Möglichkeiten für günstige lokale Gemeinschaftslösungen vorliegen. Vor allem aber sollte auch für die individuellen Lösungen im Rahmen der Wärmeplanung definiert werden, wie eine möglichst rasche Umsetzung (neben Heizungstausch auch die Dämmung) durch die Stadt, im Sinne des Klimaschutzes und des Schutzes der Bürger vor steigenden Energiekosten, unterstützt und gefördert werden kann.
D) „Besonders herausfordernde“ Gebiete:
Nach Definition der Gebiete A, B und C bleiben unter Umständen Gebiete, die im Wärmeplan Stuttgart als Gebiete „besonders herausfordernder klimaneutraler Wärmeversorgung“ definiert werden. Es handelt sich in der Regel um Gebiete, die nicht an das Fernwärmegebiet angrenzen, in denen eine individuelle Versorgung aufgrund der Verdichtung nur sehr schwer zu realisieren ist, wo aber auch kein nennenswertes erneuerbares Wärmepotential vorliegt. Das trifft in Krefeld, wie schon erwähnt, auf den Ortskern von Hüls zu. In solchen Fällen müssen die Möglichkeiten netzbasierter Versorgung besonders intensiv geprüft werden. Allerdings ist auch die Verortung der für Netze i.d.R. notwendigen „Energiezentralen“ in sehr verdichteten Gebieten eine Herausforderung. Da sich aber vergleichbare Probleme mit fortschreitender Wärmeplanung bundesweit sicherlich zu hunderten in vielen Städten stellen werden, werden in Kürze sicherlich auch hunderte neue kreative Lösungen gefunden werden, auf die zurückgegriffen werden kann. Aktuell stehen ja fast alle Kommunen noch am Anfang.
Es ist aber über Hüls hinaus zu befürchten, dass in Krefeld auch weite Gebiete der Innenstadt sowie Teile von Cracau und Uerdingen herausfordernd sein werden, sollte sich eine Versorgung mit Fernwärme als unmöglich erweisen.
NABU-Klima-Wunsch: Angesichts von Herausforderungen nicht verzagen und nicht auf „Luftschlösser“ (überhöhte Sanierungsraten, Wasserstoff u.a.) zurückgreifen, sondern optimistisch nach kreativen Lösungen im Rahmen des Möglichen suchen. Für eine zukunftsfähige Infrastruktur müssen ggf. auch investive Lösungen erwogen werden. Da ist dann die Politik besonders gefragt.
Die genannten Themenbereichen wurden, wie gesagt, hier nur angerissen. Zu allen wird es in der Folge noch ausführlichere Blogs geben, die auf die jeweiligen Vorteile und Hemmnisse eingehen werden.

Aus aktuellem politischen Anlass nun doch noch einmal ein allgemeines Thema (bevor es im nächsten Blog um die Krefelder Wärmeplanung geht): Immer wieder hört man, vor allem von Leugnern der Klimaveränderungen, das folgende Argument (kürzlich sogar noch im Landtag): China emittiere in wenigen Tagen unsere Jahresemissionen an CO2. Deshalb solle doch erst einmal China mit dem Klimaschutz beginnen. Dazu eine Sammlung von Gedanken:
Pro Kopf: Vordergründig stimmt es ja: Absolut gesehen, war China 2022 mit 30,7% der weltweiten CO2-Emissionen der größte Emittent, gefolgt von den USA mit 13,6%. Es folgten Indien (7,6%), Russland (4,5%), Japan (2,85%) und der Iran (1,86%). Erst auf dem 7. Platz kam Deutschland mit 1,8%. China hat allerdings über 15mal so viele Einwohner wie Deutschland. Pro Kopf sieht das Ranking 2022 dann ganz anders aus: Nach Ländern wie Palau (60 t pro Kopf) Katar, Saudi Arabien, Luxemburg, Singapur, Australien und anderen mit jeweils 15 bis 35 t CO2-Emissionen pro Kopf, erscheinen China und Deutschland beide erst zwischen dem 15. und dem 20. Rang mit gut 8 t CO2 pro Kopf fast gleichauf. Zugegeben: China hat Deutschland im Folgejahr 2023 knapp überholt. Der Unterschied ist aber nicht wirklich so groß, dass wir das Recht zum Faulenzen daraus ableiten könnten.
Historisch kumulierte Emissionen: Betrachtet man nun aber die Emissionen, die die Länder historisch seit Beginn der Industrialisierung (ca. 1850) ausgestoßen haben, so wird die Liste mit großem Abstand von den USA mit über 500 Mrd. t CO2 angeführt. Das sind 20% des überhaupt jemals durch menschliches Handeln emittierten Kohlendioxids. China liegt, trotz seiner vielfach größeren Bevölkerung, mit ca. 11% der Gesamtemissionen deutlich dahinter auf dem zweiten Platz. Es folgt Russland mit 7% der historischen Emissionen. Deutschland lag bei früheren Berechnungen auf Platz vier. Da neuere Berechnungen Waldrodungen z.B. zur Ackerlandgewinnung mit einbeziehen, wurde es von Brasilien (4,5%) und Indonesien (4,1%) „überholt“ und liegt nun mit 3,5% der weltweiten Emissionen auf Platz 6. Historisch und pro Kopf gesehen, liegen wir damit bei den Emissionen weit vor China.
Länderargument: Es heißt oft, Deutschland trage doch mit nur knapp 2% der weltweiten Emissionen kaum etwas bei. Bei insgesamt knapp 200 Ländern dieser Erde sind 2% viermal mehr als der Durchschnitt (100% : 200 = 0,5%). D.h. viele andere Länder hätten mehr Recht als wir, sich auszuruhen.
Klimaschutzausgaben: Viele stören die Kosten, die wir für die „grüne Transformation“ haben. China aber gab 2023 insgesamt 675 Mrd. Dollar dafür aus – mehr als die EU mit 341 Mrd. Dollar und die USA mit 303 Mrd. Dollar zusammen.
Zubau regenerativer Energiequellen: China hatte 2020 geplant, bis 2030 insgesamt 1200 Gigawatt erneuerbarer Energiequellen (v.a. PV und Windkraft) zuzubauen. Dann zündete es den Turbo: Das Ziel wird bereits 2025 mit 1371 GW überholt werden. Allein 2023 baute China so viel Photovoltaik zu, wie die ganze restliche Welt in 2022 – und legte sogar bei Windkraft 66% zu, während wir schwächelten. Von 2023 bis 2028 wird China mehr regenerative Energieanlagen zubauen, als der Rest der Welt je gebaut hat. Macht das nicht nachdenklich? China führt im Übrigen auch bei Elektroautos und beim Zubau von Ladestationen.
Forschung: Vor zehn Jahren war die EU-Forschung führend bei sauberen Energietechnologien – heute ist es China. Sie liegen durch die Bank vorn, bei Veröffentlichungen zu Solar- und Windenergie, Batterien, Wärmepumpen und Kohlenstoffabscheidungstechniken – alles Schlüsselelemente der Energiewende. Wollten wir ausruhen oder verschlafen?
Exportierte Emissionen: Wer bei der obigen Aussage, dass China Deutschland soeben bei den pro Kopf-Emissionen überholt hat, triumphiert hat, der sollte sich klar machen, dass wir viele „emissionsintensive Industrien“ in den letzten Jahrzehnten „exportiert“ haben und wir einen nennenswerten Teil der chinesischen Emissionen durch die reimportierten Produkte dieser Industrien selbst unterhalten. Wir haben also die Emissionen unser Verbrauchsgüter exportiert und kreiden sie nun den Chinesen an.
Spieltheorie: Wenn immer der Andere anfangen soll, fängt keiner an.
Lemminge: Wenn alle Lemminge auf die Klippe zulaufen, wie ist die Katastrophe dann aufzuhalten? Nur indem alle stehen bleiben! Nicht jedoch wenn alle auf die anderen zeigen – und auch Einzelne können nur sehr schwer stehen bleiben, wenn alle anderen weiterrennen.
Warum sollten ausgerechnet wir denn anfangen? Vielleicht weil wir es von unseren diversen Ressourcen (Finanzen, Technologie, Infrastruktur, soziale Stabilität uva.) her besser können als viele andere Länder. Wir können zudem Sogwirkung entfalten – so wie Kalifornien, welches vor allen anderen Staaten die Schadstoffemissionen von Autos begrenzte und damit die weltweite Autoproduktion nachzog. Ähnliches könnte jetzt das CO2-Ausgleichsinstrument für Importprodukte (CBAM) der EU bewirken – aber nur wenn wir emissionsmäßig besser dastehen als die Herkunftsländer.
Und die moralische Seite? Jeder Tag, den wir inaktiv verstreichen lassen, bedeutet zusätzliche Tote bei Hitze-, Überschwemmungs- und sonstigen Naturkatastrophen, die nachgewiesenermaßen durch die Klimaveränderungen zunehmen. Jedes Zögern lastet vor allem nachkommenden Generationen mehr Ungemach und Kosten auf. Wegen der Unumkehrbarkeit drohender Kipppunkte könnte man sogar etwas überspitzt argumentieren: Was wenn ausgerechnet wir durch unser Zögern der Grund sind, dass ein bestimmter Kipppunkt überschritten wird und ein irreversibler Prozess in Gang gesetzt wird? Sind unsere 2% vielleicht der berühmte „Tropfen“, der das Fass zum Überlaufen bringt?
Die rechtliche Seite: Zum Glück können wir uns in Deutschland gar nicht so einfach auf die faule Haut legen, weil wir in vielfältige internationale Verpflichtungen eingebunden sind und rechtlich gar nicht anders handeln können. Es würde eine gehörige Disruption bedeuten, da ausschwenken zu wollen.
Und warum wollen wir die Verantwortung überhaupt abschieben? Immer schon lebte der Mensch in Zeiten der Veränderung. Es war letztlich sein evolutionärer Vorteil, dass er durch Verstand und Sprache Veränderungen und schwierige Bedingungen besser überlebte als viele andere Spezies. Subjektiv scheinen uns die Veränderungen aber immer schneller zu gehen: Die rasche und immer schneller werdende Fortentwicklung der Technologien (über Dampfmaschine, Kühlschrank, Fernsehn, Computer, Smartphone usw.), die ja eigentlich keiner missen will. Die vielfältigen (positiven) gesellschaftlichen Veränderungen (Sozialversicherungen, Arbeitsrecht, Familienstrukturen, Mobilität, moderne Medizin uva.) die man leider nicht ohne immer komplexere Regelsysteme bekommt. Die Globalisierung mit finanziellen Verflechtungen, internationalen Abkommen, Reisemöglichkeiten, internationalem Handel, Internationalisierung von Arbeit, aber auch der Küche, und der modernen Medien, die uns die ganze Welt gut bebildert ins Wohnzimmer liefern - das ist manchmal viel auf einmal.
Insbesondere, wer in dieser komplexen Welt mit allem Auf und Ab Nachteile (finanziell, sozial, persönlich) erlitten hat, könnte versucht sein, die Welt anhalten zu wollen – am besten vor der persönlichen Verschlechterung: „früher“. Aber es sei auch den einfach nur „Modernitätsgestressten“ gegönnt, einmal zu seufzen und zu sagen: „Früher schien es mir übersichtlicher – und jetzt sollen erst einmal andere handeln! Ich brauche eine Veränderungspause!“
Einzelne können sich das sogar ohne großen Schaden für längere Zeit leisten. Aber als Gesellschaft sollten wir den Verstand einschalten, der uns ja damals auch in den kalten Breiten hat überleben lassen: Wollen wir wirklich an anderem Ort oder in anderer Zeit leben? War wirklich alles so viel besser als wir noch mehrheitlich mit der Hacke den Acker bestellten und die Schafe auf die Weide trieben? Oder im Mittelalter? Oder in der Nachkriegszeit? Oder vor dem Gebäude-Energie-Gesetz (GEG)? Oder in der Südsee, in Mallorca, in Schweden, in Shangri-la oder all den anderen Sehnsuchtsorten – wo wir am Ende aber doch auch einkaufen und am Abend den Müll runterbringen müssen? Finden wir vielleicht sogar einen Sündenbock, dem wir die Schuld an unserer „Überforderung“ anlasten können?
Oder leben wir nur einfach in einer sehr dynamischen und komplexen Welt, die uns viel abverlangt aber auch viel bietet? Kann man die Vielheit überhaupt „anhalten“? Ist sie nicht das Wesen von Leben und Gesellschaft?
Als Hirtenvolk wäre es übersichtlicher und wir würden weniger Schaden anrichten – es könnte aber nur ein kleiner Teil von uns überleben. Um die moderne Welt mit Ihren Möglichkeiten und Gaben zu meistern brauchen wir mehr Verstand als vor 20.000 Jahren. Zum Glück haben wir seither auch viel gelernt und sollten unser Wissen nutzen! Ob es reicht, wird sich zeigen. Verleugnung oder polemische Vereinfachung jedoch waren immer ein sicherer Weg in die Katastrophe.

Frohes neues Jahr an alle Leser! Es ist jetzt an der Zeit, nach vorne zu blicken und die Erstellung des Wärmeplanes und weitere konkrete Transformationsmaßnahmen zu begleiten. Zuvor bin ich aber noch die im letzten Blog versprochene Analyse zur Wasserstoffproduktion im Ausland schuldig.
Wasserstoff spielt in der Klimadebatte in Krefeld immer wieder eine große Rolle. Auf der Ratssitzung am 12.12.2023 wurde ein Antrag der Ratsfraktion der Linken und von Ratsfrau Althoff, das „Wasserstoff-Szenario“ aus dem Gutachten „KrefeldKlimaNeutral 2035“ zu streichen, abgelehnt. Ein zu dieser Sitzung vorgelegtes Positionspapier der SWK schätzte den Anteil von Wasserstoff an der zukünftigen Wärmeversorgung von Krefeld auf bis zu 20% der Haushalte. Da Schätzungen zufolge maximal die Hälfte des in Zukunft benötigten „grünen“ Wasserstoffes in Deutschland selbst produziert werden kann (viele rechnen lediglich mit 20-30%), richten sich alle Hoffnungen auf das Ausland. Deshalb soll in diesem Blog analysiert werden, ob diese Hoffnung Aussichten auf Erfüllung hat.
Rasante Hochläufe von Technologien hat die Welt schon öfters erlebt: Z.B. ersetzten motorisierte Fahrzeuge nach der vorletzten Jahrhundertwende die Pferdkutsche in einem Jahrzehnt. Ähnlich schnell lief die Verbreitung der Smart-Phones knapp hundert Jahre später. Insofern sind Prognosen immer unsicher. Einige Anhaltspunkte sollen aber zusammengetragen werden.
Südeuropa: Im Süden Europas ist die Sonneneinstrahlung deutlich höher als in Deutschland. Deshalb werden oft Spanien und Frankreich als Herkunftsländer für grünen Wasserstoff genannt. Studien belegen aber, dass das sonnige Südeuropa, speziell das zusätzlich windreiche Spanien und Frankreich ausscheiden, da sie, bei den möglich erscheinenden Ausbauraten der Stromerzeugung, den bei ihnen erzeugten Wasserstoff selbst verbrauchen werden (z.B. https://www.fh-erfurt.de/fileadmin/Dokumente/GTI/Dokumente_GE/ forschung/lenz/fp-2023-08-21-wasserstoffnachfrage-bis-2050-web.pdf ).
Norwegen: Ähnlich nah liegt Norwegen. Dort gibt es zwar weniger Sonne aber Wind und viel Wasserkraft. Norwegen ist bereits zu über 90% regenerativ energieversorgt. Norwegen bietet Deutschland Wasserstoff an. Wirtschaftsminister Habeck hat eine Absichtserklärung über die Abnahme von 50 TWh jährlich ab 2030 unterschrieben. Er soll zunächst aus Erdgas gewonnen werden. Das freiwerdende CO2 soll zunehmend abgefangen und eingelagert werden, später Umstellung auf Elektrolyse und damit „grüne“ Produktion. Im Verlauf soll die Menge bis auf 150 TWh gesteigert werden, was immerhin einen nennenswerten Anteil unseres Bedarfes darstellen würde (je nach Schätzung sind dies minimal 240 TWh, maximal 800 TWh bis 2050). Aber ein bisschen kaufen wir die Katze im Sack: Der Deal mit dem blauen Wasserstoff wird z.T. sehr kritisch beurteilt (Methanlecks, CO2-Lecks, Energiebilanz: kurz z.B. in https://energiewinde.orsted.de/energiepolitik/blauer-wasserstoff-norwegen-pipeline-kritik-klimabilanz ). Und wird er grün? Aktuell prahlt Norwegen, dass die „größte skandinavische“ Produktionsanlage für grünen Wasserstoff bei Alesund entstünde, die im Endausbau 40.000 Tonnen pro Jahr produzieren soll, was 1,6 TWh entsprechen würde. Es bleibt also noch ein weiter Weg bis 50 TWh oder gar 150 TWh. Auch in Norwegen müssen halt die Produktionsanlagen (Wind, Wasser) erst gebaut werden. Auch wird nicht alles nur für Deutschland sein und Pipelines müssten auch noch gebaut werden.
Nordafrika: Schon kurz nach der Jahrtausendwende wurde das Desertec-Projekt gestartet. Grundidee war, dass unter ein Prozent der Wüstenfläche Nordafrikas ausreichen würde, um mittels Sonnenenergie einen Großteil des Strombedarfes Europas zu produzieren. Hinzu käme Windenergie von der Atlantikküste. Viele Studien wurden durchgeführt. Es gab verschiedene (Industrie-)Zusammenschlüsse, die das Projekt voranbringen wollten, die aber immer wieder zerfielen. Verschiedene lokale Initiativen und internationale Verträge bestehen fort. Wirklich abgehoben hat das Projekt nie.
Wie schon im NABU-Blog 11 erwähnt, sah bereits die von 2018 bis 2022 erstellte große MENA-Fuels-Studie von DLR, IZES und Wuppertal Institut zu Wasserstoffimport aus den nordafrikanischen Staaten viele Hindernisse (Zusammenfassung: https://wupperinst.org/fa/redaktion/downloads/projects/ MENA-Fuels_Synthesebericht_Zusammenfassung_de.pdf ). Obwohl auch die MENA-Staaten ihren Energieverbrauch bis 2050 verdoppeln würden, sei das theoretische Angebot an grüner Energie ausreichend. Problem sei aber das Investitionsumfeld. Dessen Unsicherheit führe zu hohen Kapitalkosten und damit Kosten der Endprodukte. Außerdem seien die erforderlichen Ausbaudimensionen nicht einmal ansatzweise in den Zukunftsplänen der Länder enthalten und würden noch viel politische Vorarbeit erfordern, um die Umsetzung konfliktfrei durchführen zu können. Schließlich bleiben in allen nordafrikanischen Ländern politische Unsicherheiten (Stichwort „Arabischer Frühling“). Vor einigen Monaten stoppte die Verschlechterung der bilateralen Beziehungen zu Marokko vorübergehend alle Projekte. West-Sahara wirft Marokko zudem anhaltend „Kolonisation“ mit Solar- und Windkraftprojekten vor. Leider gibt es auch bei bestehenden Bergbauprojekten teilweise erschreckende Defizite der sozialen und ökologischen Verträglichkeit. Erste Schritte nach vorne gibt es aber auch: Im September 2023 wurde vom ehemaligen NABU-Präsidenten Jochen Flasbarth (jetzt Staatsekretär im BMZ) mit Marokko ein Pilotprojekt der Wasserstofferzeugung vereinbart: Innerhalb von zwei Jahren soll ein Ertrag von 10.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr erreicht werden. Das ist immerhin ein Tausendstel der in Deutschland 2050 benötigten Gesamtmenge. Allerdings wird ein Teil lokal benötigt werden und andere Länder haben ebenfalls Interesse.
Naher Osten: Im Gegensatz zu Nordafrika ist hier reichlich Investitionskraft lokal vorhanden. Die Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) haben mit Masdar auch ein Industrieprojekt, welches sich den Ausbau von regenerativer Stromerzeugung in ganz Afrika auf die Fahnen geschrieben hat. Beträchtliche Erzeugungskapazitäten sind auch für Wasserstoff in Planung. Fast täglich kündigen die UAE neue Projekte weltweit an. In den UAE selbst sind Projekte in Höhe von 7 Mrd. USD in Planung (u.a. mit Uniper) und sollen in den nächsten Jahren begonnen werden. Saudi-Arabien hat noch größere Pläne (z.B. im Rahmen des Zukunftsprojektes Neom). Es will bis 2035 2,9 Millionen Tonnen (113 TWh) Wasserstoff pro Jahr erzeugen. Und Saudi-Arabien beginnt tatsächlich zu bauen (auch auf Google-Maps zu sehen - und vertreibt dazu gewaltsam einige Beduinendörfer). Elektrolyseure sind bei Thyssen-Nucera bestellt, allerdings zunächst in kleineren Mengen – aber ausbaufähig (z.B. https://www.deutschland.de/de/topic/umwelt/gruener-wasserstoff-aus-neom-in-saudi-arabien ) – vorausgesetzt auch Thyssen fährt die Produktion rasch genug hoch. 2026 sollen zunächst einmal 650 Tonnen (0,025 TWh) H2 pro Jahr entstehen – es ist also viel Luft nach oben. Der Oman hat auch ehrgeizige Pläne: Bis 2050 will er 8 Millionen Tonnen (312 TWh) Wasserstoff jährlich erzeugen. Das würde ausreichen, um den deutschen Bedarf weitgehend zu decken. Allerdings wird sich die ganze Welt auf den Ertrag stürzen. Ob es dann für uns reicht? Alle arabischen Länder haben aber auch selbst einen hohen Energieverbrauch (pro Kopf deutlich höher als in Deutschland). Wenn sie diesen dekarbonisieren wollen, werden sie auch selbst einen beträchtlichen Teil ihrer Produktion benötigen – oder sie verbrennen für sich selbst weiter Öl, was global-ökologisch kein Vorteil wäre.
Subsahara-Afrika: Die afrikanischen Staaten südlich der Sahara haben zwar, nach Nordafrika und dem Nahen Osten, das höchste theoretische Potential für Wasserstoffproduktion. Dafür sind die Probleme auch deutlich größer. Meist hat ein Großteil der Bevölkerung noch nicht einmal einen eigenen Netzanschluss. Zudem sind die Anteile regenerativen Stromes im Netz für viele Staaten minimal (Niger z.B. Anschlussquote von 17%, regenerativer Strom 1% - das gilt aber nicht generell, Kenia hat prozentual mehr grünen Strom als wir). Das notwendige Wasser ist teilweise rar. Zudem gibt es mehr Armut und wenig ausgebildete Bevölkerung. Es muss also bei Großprojekten ausgesprochen behutsam vorgegangen werden, um nicht Ungleichgewichte und damit Widerstand hervorzurufen bzw. im schlimmsten Fall „neokoloniale“ Zustände. Im Niger zerschellten deutsche Wasserstoffträume am Putsch. Im Senegal gibt es Konkurrenz zu einer Elite, die lieber Öl und Gas erschließen würde. Namibia war eines der Länder, wo aus Deutschland viel Hoffnung bestand, ein großes Projekt zu starten. Es gab aber aus verschiedenen Gründen Probleme. Unter anderem fürchtete man soziale Benachteiligung für die ärmere Bevölkerung, wenn so viele Facharbeiter im Bereich des Projektes konzentriert würden. Es werden jetzt zunächst mehrere kleinere Projekte beworben. Manche Studien schließen fairen Import von Wasserstoff aus Afrika auf Jahrzehnte aus (z.B. https://arepoconsult.com/wp-content/uploads/2022/04/Studie_Fair_Hydrogen.pdf ).
Australien: Hier gibt es hunderte Wasserstoffprojekte (eindrucksvoll aufbereitet bei https://research.csiro.au/hyresource/ ). Entsprechend groß ist der internationale Optimismus. Allerdings sehen nur einige der Projekte auch den Export vor. Denn auch Australien dürfte zunächst seine eigene grüne Energieversorgung sicherstellen müssen (derzeit 30%) und dann exportieren. Zudem sind die Verträge mit Australien z.T. mit Japan und Südkorea zusammen gemacht worden. Diese liegen aber bedeutend näher und benötigen ebenfalls sehr viel Wasserstoff. Wird noch genug bei uns ankommen? – Auch weil Wasserstoff ja aus jedem Transportgefäß verdampft. Man wird eher Ammoniak transportieren müssen, das dann aber hier erst aufbereitet werden müsste. Es ist noch ungeklärt, wer für das „Cracken“ hier aufkommen muss. Streckenmäßig liegt Asien eindeutig näher – und viele Projekte Australiens sprechen auch vorrangig von „Märkten in Asien“. Wenn man die Projektgebiete Australiens auf Google-Maps aufsucht, findet man kaum Zeichen eines Baubeginns. Vieles ist noch nicht beschlossene und erst recht nicht finanzierte Sache. Das größte australische Projekt (AREH) wurde 2021 zunächst gestoppt, da Meeresbiotope beeinträchtigt würden (durch Meerwasserentsalzung für den hohen Wasserbedarf), 2023 aber genehmigt. Schließlich fehlen in Australien – so wie hier – auch die Fachkräfte, die Riesenprojekte umzusetzen. Es ist durchaus ein Ziel für Australien, über die Projekte Fachkräfte ins Land zu holen. Leider brauchen wir unsere hier selbst.
Sonstige Sonnen- und Windländer: Weitere Staaten deutscher Wasserstoffbegehrlichkeiten sind Kanada, Chile, Argentinien, Brasilien und Kasachstan. Kanada wollte aber mit Deutschland zunächst keinen Vertrag machen, obwohl zwei Projekte in Ostkanada sehr weit gediehen sind – vielleicht ein Indiz, dass die Länder zunächst ihre eigenen Planungen machen wollen, bevor sie Exportwünschen nachgeben? Planungen gibt es auch in Indien und China (riesige Projekte in der inneren Mongolei und massives Hochfahren der Produktion von Elektrolyseuren, die ein Drittel der europäischen kosten) – wobei beide vorwiegend an den eigenen Bedarf denken. Eine Einzelanalyse aller Staaten würde hier aber zu weit führen.
Viele Hindernisse und Unsicherheiten
Es ist aber erkennbar, dass es noch viele Hindernisse auf dem Weg bis zur weltweiten Vollproduktion geben wird. Es geht auch anderswo meist nicht schneller als in Deutschland. Es gibt Widerstände, die hohen Zinsen drücken uva.. Unsichere Rahmenbedingungen treiben die Kapitalkosten (Kreditabsicherung etc.). Feste Verträge über Abnahmemengen fehlen. Die Politik in den Abnahmeländern hat sich noch gar nicht auf Strategien und damit stabile Zusagen geeinigt. Für dem "Umweg" über Wasserstoff muss sehr viel zusätzliche "grüne Energie" zugebaut werden - dazu müssen Rohstoffe, Produktion und Arbeitskräfte vorhanden sein. Zudem müssen auch die Elektrolyseure produziert werden, was einen extremen Hochlauf bedeutet, der bis 2035 wohl kaum flächendeckend zu schaffen ist. Bislang gibt es nur kleine Projekte und Einzelmontage von Großelektrolyseuren (eine erste kleine Serienproduktionsanlage in Deutschland ist von Thyssen in Berlin geplant). Gerade hat BASF in Ludwigshafen eine Förderzusage von 124,3 Mio. Euro für einen PEM-Elektrolyseur von 54 MW zur Wasserstoffproduktion bekommen. Es soll der „größte seiner Art“ in Deutschland sein. Er ist noch nicht gebaut. Die ca. 500fache Elektrolyse-Leistung wird allein in Deutschland benötigt. Das Upscaling hat aber noch kaum Fahrt aufgenommen. Viele Flaschenhälse! Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt, dass von allen angekündigten Projekten nur 7% der Leistung 2030 wirklich in Betrieb gegangen sein wird.
Der Transport ist zudem ein Kernproblem
Wasserstoff ist extrem flüchtig und, als Gas, sehr raumgreifend. Verflüssigung fräße viel Energie. Viele halten deshalb lediglich den Transport durch Pipelines für wirtschaftlich darstellbar. Das jedoch schlösse viele Länder aus. Zudem müssten die Pipelines – aber auch die Transportschiffe – erst noch gebaut werden, was nur mit „Deutschlandtempo“ schnell geht.
Alternativen zur Pipeline ist die Weiterverarbeitung zu stabileren Produkten im Herkunftsland, z.B. zu Ammoniak, Methan, Synfuels. Dazu besteht aber noch keine Einigkeit. Diese müsste bestehen, um die Transportinfrastruktur investitionsfähig zu machen. Wer wird z.B. in Deutschland für das „Cracking“ von Ammoniak zuständig sein? Für ein Crackingprojekt machen gerade EON, Iqony, Bayer und Westenergy erste Pläne in Bergkamen – wann sie wohl umgesetzt werden?
Vielleicht aber werden sich Wirtschaftsunternehmen und viele der genannten Staaten mit Aufbau der Infrastruktur denken: Warum denn die energieintensiven Industrien nicht direkt neben den Energieproduktionsanlagen ansiedeln? Der Island-Effekt würde sich weltweit wiederholen (die geothermale Energie zog z.B. Aluminiumfirmen nach Island). Unter dem Gesichtspunkt der lokalen Wertschöpfung wäre das im Interesse der Produktionsländer. Die Industrie insgesamt würde durch billigere Produktion auch gewinnen. Nur wir in Deutschland würden in die (leere Pipeline-)Röhre gucken.

Auf der Ratssitzung am 12.12.23 sollte sowohl das Gutachten „KrefeldKlimaNeutral 2035 (KrKN35)“ als Leitbild für den Weg zur Klimaneutralität in Krefeld beschlossen werden, als auch über einen Antrag entschieden werden, das „Wasserstoff-Szenario“ komplett aus dem Gutachten zu streichen. (Ersteres wurde knapp beschlossen, Zweiteres abgelehnt). Als Hilfe für die Entscheidungsfindung versandten die SWK wenige Tage vor der Sitzung ein „Positionspapier der SWK: Erreichung von Klimaneutralität für Krefeld“ an die Fraktionen. Unmittelbar im Anschluss legte auch der NABU ein Positionspapier zu den anstehenden Beschlüssen vor, welches auch auf einige Inhalte des SWK-Papieres Bezug nahm.
Der NABU betonte dabei, dass die zunehmend gute Zusammenarbeit zwischen SWK und Stadtverwaltung sehr erfreulich und eine elementare Voraussetzung für den Erfolg der Klimawende in Krefeld sei. Die Stellungnahme der SWK sei als Positionsangabe sehr hilfreich zur „Einhegung“ wild wuchernder Spekulationen um die beunruhigende aber unvermeidbare bevorstehende Transformation unseres Energiesystems. In diesem Blog sollen nochmals einige Gemeinsamkeiten und Differenzen der Ansichten kurz zusammengefasst werden.
2035 oder 20XY?
Einleitend betonen die SWK in ihrem Papier, dass sie sich als „Treiber der Verkehrs- und Energiewende sowie der Recycling- und Kreislaufwirtschaft in Krefeld“ verstehen. Sie begrüßen das „ambitionierte Klimaziel“ der Stadt Krefeld und „unterstützen das Ziel, Klimaneutralität für die Stadt Krefeld zu erreichen mit den ihr zu Verfügung stehenden Mitteln“. Sie betonen aber, neben der Nachhaltigkeit auch die Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit als ihren Auftrag. Dazu zähle auch die „technische und praktische Machbarkeit“ von Maßnahmen (z.B. Baustellenplanung, Ressourcenverfügbarkeit bei Planung und Genehmigung, im Tiefbau und bei Handwerkern sowie bei Investitionen). Auf diesem Hintergrund hielten die SWK das Klimaneutralitätsziel 2035 nicht für realistisch und wollten in ihren Planungen lieber dem Zeithorizont der Bundesregierung (2045) folgen.
Wie in Blog 43 dargelegt, ist diese Debatte in ihrer Zuspitzung verfehlt, da es ja physikalisch um die Gesamtemissionen geht, nicht um ein Zieljahr. Dennoch hängt beides zusammen: Wenn man für eine längere Zeitspanne plant, verschieben sich Maßnahmen nach hinten und stoppen die Emissionen nicht so schnell. Für den Hinterkopf ist es aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass gerade die sehr wirksamen Emissionsminderungsmaßnahmen längere Planungshorizonte aufweisen und deshalb nicht sehr kurzfristig umsetzbar sein werden (eklatantes Beispiel z.B. die Leitungsverlegung für Fernwärme).
Man mag zwar erstaunt vermerken, dass sich die „Stadttochter“ SWK hier explizit in Widerspruch zu bestehenden Ratsbeschlüssen setzt. Auch ist das Aufzählen von Hindernissen eine Steilvorlage für bremsende Gruppierungen. Dennoch ist die Debatte erlaubt und sollte konstruktiv geführt werden. Es wird zu beantworten sein, wie wir, trotz der langen (vielleicht kürzbaren?) Vorlaufzeiten bei wichtigen Maßnahmen, rasch zu Emissionsminderungen kommen können. Ferner sollten wir bereits überlegen, wie wir die 2035 voraussichtlich noch verbleibenden Emissionen kompensieren wollen. Eine gewisse zu kompensierende Restmenge ist im Gutachten vorgesehen. Was, wenn diese ziemlich groß ist? Die Stadt München hat sich dazu schon Gedanken gemacht (z.B. Moorvernässungen).
Mehr Fernwärme wäre schön
Wie der NABU sehen auch die SWK die Wärmewende als „Fokusthema der Klimaneutralitätsdebatte“. 97% der Gebäude in Krefeld seien dezentral beheizt, davon 72% mit Erdgas. Nur 3% beziehen derzeit Fernwärme (ca. 5% der Endenergie). Mit Strom seien 12% der Gebäude beheizt, die allerdings nur 2% des Wärmebedarfes benötigten, da es zumeist Neubauten oder kernsanierte Gebäude seien.
Nach Einschätzung der SWK werde „sich das Verhältnis von Strom zu Gas innerhalb der nächsten 20 Jahre ungefähr drehen“.
Prämissen der SWK seien: 1) Je Straße wird nur ein Energieträger für die Wärmeversorgung vorgesehen (Fernwärme, Gas oder Strom). 2) Fernwärme wird in verdichteten Gebieten ausgebaut; dort wird die Gasinfrastruktur stillgelegt. 3) Ein gasbasiertes Netz kann dort bestehen bleiben, wo es Schlüsselkunden gibt, die nicht anders angeschlossen werden können (z.B. bestehende Heizkraftwerke oder BHKWs).
Der NABU ist mit den ersten beiden Prämissen im Grundsatz einverstanden. Er hält die Fernwärme für einen Hauptpfeiler der Wärmewende (siehe Klimablog 25 und 30). Er freut sich deshalb, dass die SWK das Netz „in kompakter Form“ ausbauen wollen. Er unterstützt die Nutzung der Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage (MKVA) als Übergangslösung bis ausreichend CO2-freie Wärmequellen erschlossen sind. Er begrüßt sehr die zahlreichen Optionen zur Dekarbonisierung, die die SWK prüfen (Geothermie, Umweltwärme, Abwärme) und, bei Freigabe der aktuell blockierten Bundes-(BEW)-Fördermittel, auch vorantreiben wollen.
Allerdings schwebt den SWK nur eine Verdreifachung der Anschlüsse vor, was etwa 10% der Gebäude entspräche (und 100 km neuer Leitung). Der NABU drängt aber auf höchstmögliche Ausweitung der Fernwärmeversorgung – eher in Richtung 40-50%, wie in vielen anderen Städten (wir haben in Krefeld viele verdichtete Gebiete mit Geschosswohnungsbau, die wirtschaftlich zu versorgen wären) und unterstützt politische Rahmenbedingungen, die dazu notwendig sind. Dies wird im Rahmen der Wärmeplanung genau zu prüfen sein.
Dass dabei viele Baustellen entstehen werden, ist unvermeidlich. Dafür haben wir anschließend eine zukunftsfähige Infrastruktur (besonders, wenn man andere Leitungen mit modernisiert) – und viele schöne neue Straßendecken.
Die erste SWK-Prämisse „je Straße nur ein Energieträger“ erscheint pragmatisch sinnvoll. Allerdings fürchtet der NABU ein Einfallstor für Bedenkenträger, die dann einen (impliziten) „Anschlusszwang“ beschwören. Das ist zwar heute Polemik, muss aber demnächst einmal sauber durchargumentiert werden. Zudem ist die Bundesgesetzgebung abzuwarten.
Zukünftige Gasversorgung?
Die dritte Prämisse der SWK spricht von einem „gasbasierten Netz“. Welches Gas wird wohl darin fließen? Es gäbe drei potentielle „grüne“ Gase, die aus heutiger Sicht verfügbar sein könnten, wenn Erdgas nicht mehr in Frage kommt: Biogas, Synthesegas und Wasserstoff. Biogas ist für manche kleine, ländliche Kommune schon heute das Hauptstandbein der Energiewende. So viel Bioabfall (inkl. Holz) fällt in Krefeld aber nicht an, so dass allenfalls Nutzung in Einzelfällen denkbar wäre (siehe auch Blog 41). Synthesegas gibt es derzeit erst in Ansätzen. Eine Nutzung z.B. im Sinne einer Kohlenstoff-Kreislaufführung bei den Heizwerken sollte als Zukunftsvision erwogen werden, ist bis 2035 aber eher unrealistisch.
Die SWK räumen folglich dem Wasserstoff einen großen Raum in ihrem Papier ein. Ein Beschluss über das „Wasserstoffszenario“ stand im Rat ja auch auf der Tagesordnung. Wasserstoff ist unbestritten ein wichtiges Zukunftselement. Es wird in der Industrie (als Rohstoff der Grundstoffchemie, für die Reduktion in der Stahlindustrie etc.) händeringend gesucht. Das für diesen Zweck benötigte überregionale H2-Backbone-Netz wird erfreulicherweise in der Nähe von Krefeld verlaufen. Die bestehenden PE-Gasleitungen in Krefeld sind sehr vorteilhaft und können zur Versorgung der Industriebetriebe umgenutzt werden.
Wie die SWK, sieht auch der NABU die Spitzenlastabdeckung bei Strom und Wärme (auch Überbrückung von „Dunkelflauten“) als mögliches zukünftiges Einsatzgebiet für Wasserstoff und unterstützt die diesbezüglichen Planungen der SWK. Der NABU begrüßt auch, dass geringe Beimischungen von H2 zum Erdgas in Krefeld nicht geplant sind.
Wasserstoff zum Heizen?
Der NABU freut sich über die klare Formulierung des SWK-Papieres, „dass der Einsatz von Wasserstoff im Gebäudewärmesektor nicht sehr effizient ist und daher eine nachrangige Lösung darstellen sollte“. Auch wenn es in Einzelfällen vielleicht Gebäude geben könnte, in denen auch Wasserstoff zum Einsatz kommen könnte, möchte der NABU dies als absolute Ausnahme betrachten! Die Wärmeplanung wird festlegen müssen, ob es überhaupt die Notwendigkeit geben wird.
Wasserstoff zum Heizen ist ein hohes Risiko
Warum sieht der NABU Wasserstoff zum Heizen so kritisch? Natürlich in erster Linie wegen seiner Ineffizienz und damit „Verschwendung“ und Blockierung von knapper grüner Energie (siehe Blog 26).
Aber es gibt auch wirtschaftliche Risiken: Gerade der hohe Bedarf der Industrie und der Spitzenlastkessel im Strom- und Wärmebereich, ist ein hohes Risiko für die Verfügbarkeit von Wasserstoff für den Gebäudewärmesektor. Dieser steht nämlich als letzter in der Warteschlange. Und die gegenüber der direkten Nutzung von grünem Strom unbestritten hohe Ineffizienz der Wasserstoffheizung ein echter Konkurrenznachteil (auch im Papier der SWK festgehalten: „....ist die erneuerbare Energiemenge zur Bereitstellung von Niedertemperaturwärme durch Wasserstoff um 500-600% höher gegenüber der Wärmepumpe“). Je knapper also Wasserstoff sein wird, um so weniger bleibt für die Heizung und um so höher wird der Preis sein.
Hoffnung auf preiswerten Wasserstoff aus dem Ausland
Die erneuerbaren Kapazitäten für die Produktion von Wasserstoff können, allein für die vorrangigen Nutzungen, allenfalls zur Hälfte in Deutschland bereitgestellt werden. Der Angelpunkt der Diskussion ist damit: Wird es genügend preiswerten Wasserstoff aus dem Ausland geben? Darin sind sich SWK und NABU (derzeit) nicht einig. Damit wird sich Blog 45 ausführlich befassen. Das Fazit aus der Mehrheit der Studien ist bisher: Kurzfristige Knappheit, langfristige Unsicherheit!
Damit sind bei Festlegung auf Wasserstoff zwei Grundpfeiler der Energiebereitstellung gefährdet: Die Versorgungssicherheit und die Wirtschaftlichkeit.
Wasserstoffhochburg Hüls?
Der NABU ist sich zwar mit den SWK völlig einig, dass das „Wasserstoffzenario“ des Klimagutachtens KrKN35 mit einem Wasserstoffanteil von bis zu 60% „komplett unrealistisch“ ist. Die SWK halten aber einen Anteil der mit Gas geheizten Gebäude von bis zu 20% für möglich und nötig (inklusive Biogas allerdings, z.B. heute schon lokal in Linn). Eine vorläufige Verteilungsskizze in dem SWK-Papier sieht vor allem den Ortskern Hüls zu 69% nur mit Wasserstoff „grün“ beheizbar, umgebende Bereiche zu 30-40%. Ein Teil davon muss allerdings noch einmal neu berechnet werden, nachdem zwischenzeitlich die Abstandsregeln für Wärmepumpen verändert wurden und diese damit breiter einsetzbar werden.
Der NABU fragt sich allerdings, ob es tatsächlich für den Ortskern Hüls keine andere Lösung gibt. Jede Kleinstadt, die aktuell kein Fernwärmenetz hat, hat doch das gleiche Problem. Sollen alle Kleinstädte Wasserstoff zum Heizen nutzen? Dann wäre sicherlich nicht genug für alle da. Viele Städte haben ihre Wärmeplanung aber schon ohne Wasserstoff geschafft. Das sollte Krefeld auch versuchen. Einzelhäuser und Kleingruppen können im Notfall auch mit Biomethan versorgt werden, ganz Hüls wohl kaum.
Der NABU rät also erneut von Wasserstofflösungen im Heizungsbereich dringend ab (siehe auch Blog 29). Wenn man sich irrtümlich auf Wasserstoff verlässt, haben die Bürger später regional in großem Stil neue H2-ready-Heizungen, die zunächst immer teurer werden und ihnen schließlich möglicherweise wenig nutzen. Der NABU ist der Überzeugung, dass sich in den nächsten Jahren zunehmend zeigen wird, dass Wasserstoff nicht in ausreichendem Maß für das Heizen zur Verfügung stehen wird und deshalb im Privatbereich ganz automatisch andere Lösungen gefunden werden. Er freut sich deshalb, dass dem Wasserstoff auch bei den SWK eine begrenzte und tendenziell abnehmende Bedeutung für die Heizung beigemessen wird. Darauf lässt sich konstruktiv aufbauen.
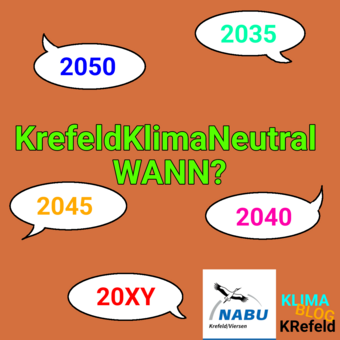
Die Bundesregierung hat, unter dem Eindruck des Verfassungsgerichtsurteils, das Ziel der Klimaneutralität für Deutschland von 2050 auf 2045 vorverlegt. Auch das neue Ziel ist fragwürdig, denn: Wissenschaftlich gesehen ist nicht so sehr das Datum des Erreichens der Klimaneutralität entscheidend, sondern wie viel CO2 bis dahin emittiert wird. Klimawirksam ist nämlich das im Zeitverlauf angesammelte CO2 in der Atmosphäre, welches dort hunderte von Jahren verweilen wird. Dessen Konzentration bestimmt, wie stark sich das Klima verändern wird. Je höher sie ist, um so mehr heizt sich das Klima auf, wie in einem Glashaus. Da das Ausmaß der Klimaauswirkungen von der Temperatur abhängt, ist sie weltweit als Maßzahl für das Ausmaß notwendiger Maßnahmen gewählt worden. Der Temperaturanstieg soll laut der Klimakonferenz 2015 in Paris möglichst auf 1,5 Grad begrenzt werden.
Warum sind 1,5 Grad gewählt worden?
Bei Überschreiten von 1,5 Grad Temperaturanstieg steigt das Risiko des Erreichens von Kipp-Punkten deutlich. Kipp-Punkte sind Prozessmarken, an denen bestimmte Kausalketten einen Eigenverlauf nehmen und nicht mehr einfach durch Rückkehr zu niedrigeren Temperaturen gestoppt werden können (Beispiel: Wenn die Tundra taut, werden Unmengen Methan frei, die das Klima exponentiell anheizen. Selbst durch Abkühlung kehrt das Methan nicht in den Boden zurück).
Ein Kipp-Punkt wurde höchstwahrscheinlich schon überschritten (bei 1,2 Grad): Das Absterben der Korallenriffe. Dieses ist im Wesentlichen nicht mehr aufzuhalten, da die Meereserwärmung nicht rasch genug zu stoppen ist. Mit den Korallen stirbt ein ganzes Ökosystem plus das ganze davon abhängige Wirtschaftssystem. Millionen Menschen weltweit geraten in Not.
Im Temperaturbereich zwischen 1,5 Grad und 2,0 Grad drohen weitere Kipp-Punkte. Gerade in diesen Tagen hat ein Team von über 200 Wissenschaftlern (Studie unter https://global-tipping-points.org ) vier davon als die wahrscheinlichsten identifiziert: Der Kollaps des Grönländischen und des Westantarktischen Eisschildes (langfristig ca. 13 m Meeresanstieg), die Disruption der Nordatlantischen Zirkulation ("Golfstrom"; mit starken Wetterauswirkungen auch bei uns) und das Tauen der Permafrostböden. Jeder einzeln von diesen Kipp-Punkten wird die Erde exponentiell zu einem wesentlich ungemütlicheren Ort machen. (Zu Chancen und Nutzen des Klimazieles 1,5 Grad siehe recht übersichtlich Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/1,5-Grad-Ziel ).
Was bedeutet das für Krefelds Klimaneutralitätsziel?
Wegen der deutlichen Zunahme der negativen Auswirkungen bei höherem Temperaturanstieg hält die Wissenschaft am 1,5 Grad-Ziel fest. Sie kann ziemlich genau ausrechnen, wie viel CO2 zur Einhaltung dieses Zieles noch in die Atmosphäre gelangen darf. Diese Zahl kann pro Kopf umgerechnet und dann auf die Krefelder Bevölkerung heruntergebrochen werden. Genau das ist im Anhang „Restbudget“ zum Gutachten „KrefeldKlimaNeutral 2035“ geschehen (https://www.krefeld.de/c1257cbd001f275f/files/krefeld_klimaneutral_2035_-_anhang_restbudget.pdf/$file/krefeld_klimaneutral_2035_-_anhang_restbudget.pdf?openelement ). Dort ist auch die sachliche Grundlage noch einmal ausführlicher erläutert: Um das Klimaziel 1,5 Grad mit 67% Wahrscheinlichkeit einzuhalten, darf Krefeld ab 2021 noch 4.577.204 Tonnen CO2 emittieren. Bei dem jährlichen Verbrauch von 2021 ist das Budget in 3,2 Jahren erschöpft, d.h. 2025. Um das Klimaziel 1,5 Grad mit 50% Wahrscheinlichkeit zu halten, dürfen wir maximal 7.094.666 t CO2 emittieren (was 4,9 Jahre „reichen“ würde). Um 1,75 Grad mit 67%iger Wahrscheinlichkeit zu halten, „dürfen“ wir maximal 13.960.473 t CO2 emittieren, was bei jetziger Geschwindigkeit 9,6 Jahre dauert.
Alle diese Zeiträume liegen vor 2035. Bis 2035 also unverändert weiter zu emittieren, und dann zu stoppen, reicht also nicht. Bei rasch absteigender Emissionskurve aber kann es noch reichen – sogar für das 2035er Ziel.
Entscheidend ist, dass die größten Emissionsabsenkungen möglichst frühzeitig erfolgen. Die Hauptabsenkungen müssen noch vor 2030 und deutlich vor 2035 stattfinden. Sicherlich nicht erst 2045. Insofern ist 2035 ein guter Kompromiss, wenn man unbedingt ein Jahr nennen will. Wissenschaftlich begründet sind aber eher die Gesamtemissionen - bis zu welchem Jahr auch immer. Wichtig ist, dass deren Kurve im Zeitverlauf ganz kurzfristig stark fällt und am Ende flach ausläuft (für Mathematiker: Das Integral unter der Kurve ist zu minimieren).
Fazit für die politischen Diskussionen
Die politischen Diskussionen drehen sich immer wieder um die Frage, ist die Festlegung von 2035 als Neutralitätsziel realistisch, oder sollte es eher 2045, oder noch ein anderes Jahr sein? Auch die SWK haben sich aktuell in die Diskussion eingeschaltet und 2035 aufgrund der technischen und praktischen Machbarkeit (Baustellenplanung, Ressourcenverfügbarkeit, Arbeitkräfte etc.) als „nicht realistisch“ bezeichnet.
Der NABU appelliert an alle Beteiligten, die genaue Festlegung eines Zieljahres nicht so wichtig zu nehmen, wie die Gesamtemissionen bis dahin. Die Zahl 2035 sollte eher nur als „Anfeuerungsruf“ verstanden werden: Zentral ist, wir müssen möglichst viel möglichst rasch reduzieren. Darauf sollten alle gemeinsam hinwirken. Das ist auch im Kern die Rhetorik aller Fraktionen und der SWK. Es könnte also die zentrale Botschaft der gemeinsamen (!) weiteren Anstrengungen sein.
Unter dieser Botschaft kann man das Gutachten „KrefeldKlimaNeutral 2035“ guten Gewissens als Leitbild nehmen, egal wann genau wir ankommen werden. Die Zahl ist nur Motivans, wir wissen alle nicht, wann wir die Klimaneutralität erreichen werden. Keine Stadt der Welt hat dies in dieser Form schon geleistet. Alle fangen erst an. Es gibt keine Vorbilder. Das Gutachten aber fasst die Maßnahmen zusammen, die aus jetziger fachlicher Kenntnis sinnvoll sind – auch wenn es vielleicht Defizite bei den Zahlenschätzungen (siehe Klimablog 40) oder dem Wasserstoffszenario (siehe Blog 44, folgt) hat. Es entspricht inhaltlich den Maßnahmen, die sich alle anderen größeren Städte Europas vorgenommen haben (siehe Klimablog 29,36 und 11). Alle Maßnahmen werden in den nächsten Jahren Jahr für Jahr noch einzeln in den Gremien diskutiert. Dann kann man das Fortbestehen ihrer Sinnhaftigkeit, ihre inhaltlichen Details, ihre Kosten und auch ihren Zeitverlauf noch modifizieren. Die letzten Maßnahmen werden sicherlich erst nach 2035 abgeschlossen sein. Die letzte Photovoltaikanlage wird vielleicht 2050 gebaut und die letzte Wohnung werden wir vielleicht erst 2070 sanieren.
Entscheidend ist, dass jetzt rasch und entschlossen losgelegt wird und CO2 vermieden wird! Wir müssen den Karren über einen gewaltigen Berg ziehen. Ja, Transformation ist eine große Baustelle (buchstäblich)! Das Ziel ist eine moderne Infrastruktur für Krefeld. Da sollten wir alle uns ermutigend zunicken, jeder sein Seil packen und losziehen. Jeder mit seiner vollen Kraft. Alle in die gleiche Richtung! Was jeder sich denkt, wann wir oben sind, ist doch eigentlich egal. Wir werden es sehen. Warum das Ausmaß unserer Motivations(un)fähigkeit vergleichen? Warum uns jetzt die Hindernisse vorbeten? Die kommen von selbst. Wenn wir uns jetzt mit hohlen Diskussionen ermüden, geht viel Kraft und Motivation verloren. Im Kern besteht Einigkeit: Wir müssen möglichst viele Emissionen möglichst rasch reduzieren!

Biogas entsteht, wenn man Biomasse (Pflanzen, Bioabfälle, Holz, Mist, Gülle, Klärschlamm etc.) in luftdichten Tanks, sogenannten Fermentern, unter Ausschluss von Sauerstoff mittels Mikroorganismen vergärt. Das entstehende Rohbiogas wird in der „Kuppel“ des Fermenters gesammelt. Die entstehenden Gärreste stehen als fast geruchsloser Dünger wieder der Landwirtschaft zur Verfügung oder werden kompostiert. Gegenüber der „reinen Kompostierung“ hat die Fermentierung eine positive Energiebilanz. Untersuchungen haben ergeben, dass bei der Biogasfermentierung verschiedene Klimagase (v.a. Methan und Lachgas) emittiert werden. Die emittierten Mengen sind sehr gering (unter 1% des erzeugten Biogases). Die Vermeidung erfordert aber eine gewisse Sorgfalt.
Leider variiert die Menge an produziertem Biogas mit der Verfügbarkeit der Biomasse – saisonal und regional. Trockenperioden oder Knappheiten können die Produktion mindern. Wenn Biogas direkt vor Ort produziert wird, stärkt es die regionale Wirtschaft. Es senkt die Abhängigkeit von Öl- und Gaspreisen. Das Biogasgemisch kann z.B. direkt vor Ort in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) genutzt werden, um Strom und Wärme zu erzeugen. Es enthält einen variablen Anteil (25-50%) Biomethan und ist kaum teurer als fossiles Erdgas. Es ist allerdings nicht in jeder Heizung nutzbar und auch nicht in das Erdgasnetz einspeisbar.
Was ist der Unterschied zwischen Biomethan und Biogas?
Das Rohgas kann aber auch in einer Gasaufbereitungsanlage zu Biomethan veredelt werden. Dazu wird es von Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid, Wasserstoff, Stickstoff und anderen Spurengasen gereinigt und besteht zum Schluss zu mehr als 96% aus Methan (Biomethan). Dieses kann in das Erdgasnetz eingespeist werden. Jede Erdgasheizung kann damit betrieben werden. Es ist aber deutlich kostspieliger als Erdgas (bei Abnahme von 10.000 kWh/Jahr z.B. 13 Cent/kWh – Erdgas Dez. 2023 ca. 8 Cent).
Emissionen der Biogasnutzung
Biogasnutzung wird oft als klimaneutral bezeichnet, was bedingt korrekt ist, da ja bei der Fermentierung nur CO2 freigesetzt wird, welches zuvor von den Pflanzen gebunden wurde. Aber es wird auch bei Biogasgewinnung, -aufbereitung und -transport, neben den oben erwähnten geringen Emissionen von Methan und Lachgas, in nicht unerheblichen Mengen CO2 frei. Auch wird ja z.B. der CO2-Gehalt des Biogases bei der Aufbereitung abgetrennt, der bis 65% beträgt. Perspektivisch wäre Auffangen sinnvoll, erfolgt aber derzeit praktisch (noch) nicht. Der spezifische Emissionsfaktor von Biogas wird entsprechend mit 230 g CO2/kWh angegeben und liegt damit zwischen Erdgas (819 g/kWh) und Photovoltaik (50 g/kWh) bzw. Wind (23 g/kWh).
Kann man bei Biogas-/Biomethanbetrieb seine Gasheizung behalten?
Ja, Verbraucher können mit Hilfe von Biogas die 65%-Regel des GEG (Gebäude-Energie-Gesetzes) erfüllen. Es gibt viele Angebote dazu auf dem Markt, beispielhaft erklärt z.B. das Angebot der „Energiepioniere“ Elektrizitätswerke Schönau (EWS) (https://www.ews-schoenau.de/biogas ). Stadtwerke können z.B. auch ein 15%, 30%, 60% oder 65%-Produkt anbieten und damit die Steigerungsvorschriften des GEG für den Fortbestand von ab 2024 eingebauten Gasheizungen absichern. Insofern wird Biogas gelegentlich auch als „Brückentechnologie“ angepriesen, bis irgendwann die Hoffnung auf genügend Wasserstoff erfüllt wäre.
Wenn man sich zu einem Gastarif mit 100% Biogas entscheidet, kommt natürlich kein reines Biogas aus der Leitung. Der Anbieter verpflichtet sich lediglich, die abgerechnete Menge in das allgemeine Gasnetz einzuspeisen. Das Netz wird also insgesamt etwas klimafreundlicher.
Nachteile für den Verbraucher?
Es gibt aber auch Nachteile für die Verbraucher, die sich in der Hoffnung auf Biogas oder Wasserstoff für eine Gasheizung entscheiden: Da die Heizung zunächst weiter mit Erdgas betrieben wird, besteht eine Abhängigkeit von den Erdgas-Preisschwankungen sowie den Preissteigerungen durch den EU-Emissionsdeckel (kumuliert bis 2035 durchaus 15.000 Euro, siehe Blog 29). Da in der Regel kein direkter Biogas-Anschluss verfügbar ist, kann zudem für die vorgeschriebene zunehmende Beimischung nur das teurere Biomethan verwendet werden. Zudem ist bei Neueinbau eine Gasheizung mit Biogas nicht förderfähig. Insgesamt besteht gegenüber dem Einbau einer Wärmepumpe ein deutlich höheres Risiko, sowohl was die Preise als auch was die Sicherheit der (ausreichenden) Verfügbarkeit bis 2045 angeht(siehe nächster Absatz).
Erhebliche Nachteile für die Umwelt zu erwarten
Biogasproduktion findet großenteils aus Abfällen statt, z.T. (bis zu 50%, v.a. für Biomethan) aber auch aus gezielt angebauten nachwachsenden Rohstoffen (Raps, Mais, Weizen, Zuckerrüben), die auch Lebensmittel sind. Die Flächen für deren Anbau sind begrenzt. Energiepflanzen konkurrieren darum mit dem zunehmenden Bedarf für Ernährungssicherheit, Artenschutz und Biodiversitätserhalt, Ökologisierung der Landwirtschaft, CO2-kompensatorischer Aufforstungen und Flächen-Photovoltaik – alle wollen die begrenzten Flächen nutzen. Weltweit werden durch Bevölkerungs- und Wohlstandszunahme bis 2050 ca. 40 bis 60% mehr Getreide benötigt. Wenn gleichzeitig durch die Klimaveränderungen viele Anbauflächen im Süden durch Hitze, Trockenheit und Erosion wegfallen, werden Flächen in gemäßigten Breiten wahrscheinlich wieder bedeutsam werden.
Wie fünf Wissenschaftler in „Spektrum der Wissenschaften, Mai 2023“ (leider nicht verlinkbar, aber z.B. alternativ via Google: Europe’s Green Deal offshores environmental damage to other nations. Nature 2020) sehr eindringlich belegen, hat die EU in den letzten Jahrzehnten einen beträchtlichen Teil ihrer Lebensmittelerzeugung ausgelagert (vielfach in die Tropen) und dadurch dort die Entwaldung gefördert. Sie berechnen: Auf vier Hektar Fläche in Europa beanspruchen wir einen Hektar im Ausland. Dazu berechnen sie auch die Kohlenstoffbilanz, die deutlich negativ ausfällt. Sie schlussfolgern: Europa hat keine „freien Flächen“ für Energiepflanzen. Im Gegenteil, zusätzliche Renaturierungsflächen müssen aus Gründen der CO2-Bilanz geschaffen werden oder Produktion rückverlagert werden, um den Klimaschaden zu mindern. Dass die EU im Rahmen des Klimaprogrammes „fit for 55“ eine Verdoppelung des Energiepflanzenanbaues erwäge, sei im höchsten Maße klimaunverträglich. Dass Bioenergie als „klimaneutral“ eingestuft werde, lasse komplett die Opportunitätskosten außen vor. Diese müssten komplett einbezogen werden – oder Bioenergie nicht als klimaneutral eingestuft werden. Auch andere Quellen belegen: Zwei Drittel der Fläche, die erforderlich ist, um den EU-weiten Bedarf an nicht verzehrbarer Biomasse zu decken, liegen in anderen Weltregionen. Die Fläche stieg von 1995 bis 2010 um 37 Prozent.
Möglichst nur Abfallsstoffe fermentieren!
Der Einsatz von Getreide, Mais und anderen Nahrungsmitteln für die Energiegewinnung sollte also nach Möglichkeit reduziert werden. Vermehrt sollten stofflich nicht anders verwendbare Rest- und Abfallstoffe genutzt werden.
Eine Steigerung der Bioabfallnutzung wäre aus privaten Quellen noch um ca. 65% möglich, im gewerblichen Bereich werden praktisch alle Potentiale bereits genutzt. Von den in Deutschland anfallenden 160 Mio. t Gülle werden allerdings bisher nur ca. 30% vergoren. Es wird damit eine Strommenge von 4 TWh/a erzeugt, die durch höhere Nutzung noch zu verdoppeln wäre (Umweltbundesamt 2019: https://www.umweltbundesamt.de/sites/ default/files/medien/1410/publikationen/2019-04-15_texte_41-2019_biogasproduktion.pdf ). Darüber hinaus aber ist die Verfügbarkeit von Abfallstoffen saisonal und in Gänze beschränkt. Es ist also ein knappes Gut!
Konkurrenz zur Spitzenlasterzeugung für Strom und Fernwärme
Gerade weil es ein knappes Gut ist, muss bedacht werden, dass derzeit 90% des produzierten Biogases zur Verstromung und damit zur Herstellung von Ökostrom genutzt wird. Auch in Zukunft sollte diese knapp verfügbare Ressource, statt privat verheizt zu werden, in hochflexiblen Blockheizkraftwerken Strom zu Spitzenzeiten erzeugen und damit die fluktuierende Stromeinspeisung durch Wind- und Solaranlagen ausgleichen. Deren Abwärme sollte dann möglichst in Fernwärmenetze fließen. Damit kann die in der wertvollen Biomasse enthaltene Energie deutlich effizienter nutzbar gemacht werden. Zudem fehlen vielerorts sinnvolle Alternativen, um die Versorgung bei Strom und Fernwärme kontinuierlich sicherzustellen.
Fazit
Biomethan kann in Einzelfällen helfen, Härtefälle bei der Umstellung auf klimafreundliches Heizen zu vermeiden. In großem Maßstab, gar als „Brückentechnologie“ zu einer ebenfalls sehr unsicheren „Wasserstoff-Zukunft“, birgt es für die hiesigen Verbraucher Kosten- und Verfügbarkeitsrisiken und lässt großen Schaden für die Umwelt befürchten. Sie steht in vielfältiger Konkurrenz zu Nahrungsproduktion und anderen Umweltaufgaben der Flächen und zu dem Bedarf von Spitzelastkraftwerken für Strom und Fernwärme. Die Förderung von Biogasnutzung zum Heizen sollte möglichst vermieden werden. Das GEG wurde diesbezüglich leider etwas aufgeweicht, das Wärmplanungsgesetz sieht aber Einschränkungen vor.
Vor Einbau einer neuen Gasheizung sollte dringend eine Energieberatung stattfinden (siehe auch Blog 29) und nach Möglichkeit eine andere Alternative gewählt werden. Spätestens 2025 sollen die Ergebnisse der Wärmeplanung in Krefeld flächendeckend vorliegen, welche für viele (Mehrfamilienhaus-)BereicheFernwärme als die bessere Alternative ausweisen wird. Ansonsten ist eine Wärmpumpe mit höchster Wahrscheinlichkeit die beste Kosten-, Verfügbarkeits- und Umweltalternative.
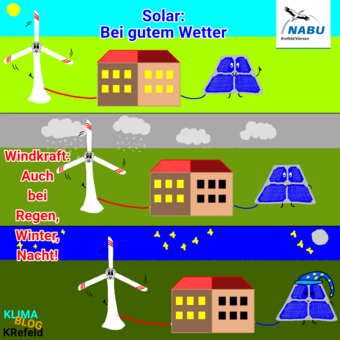
Sonnenenergie und Windenergie sind die Hauptstandbeine der Energiewende. Sonnenenergie ist weltweit auf dem Vormarsch, Windenergie hängt noch zurück. Händeringend werden Standorte gesucht. Dabei ist die Windenergie von großer Wichtigkeit. Die Sonne scheint vor allem im Sommer und mittags. Aber was ist nachts? Was ist im Winter? Hier wird Windkraft zwingend benötigt! Strom speichern ist teuer. Im Einzelhaushalt können Stromspeicher für eine Nacht wirtschaftlich sein, nicht aber im großen Maßstab. Erst recht ist eine komplette Überbrückung des Winters undenkbar. Wind aber bläst auch nachts und besonders sogar im Winter. Vor allem auf dem Meer bläst er sehr konstant. Windkraft wird deshalb auch das „Arbeitspferd“ der Energiewende genannt.
Es gibt nur wenige Tage bis maximal Wochen im Jahr, in denen weder Sonne noch Wind ausreichend Energie liefern. Diese „Dunkelflauten“ sind ein wichtiges Problem der Energiewende. Es gibt auch dafür Lösungen; in diesem Blog aber soll es um die Windkraft gehen.
Wohin mit den Anlagen?
Kaum einer hat Einwendungen gegen Solaranlagen auf Dächern. Klar! Diese sollten alle belegt werden, vor allem die großen Industriedächer. Aber, wie eben begründet, wollen wir ja nicht nur im Sommer ausreichend Strom haben. Gerade für die zunehmenden Wärmepumpen brauchen wir Strom auch im Winter.
Mit der dafür notwendigen Aufstellung von Windkraftanlagen aber gibt es immer wieder Probleme. Es werden alle möglichen Gründe geltend gemacht, warum sie hier und da nicht stehen dürfen – vor allem nicht vor der eigenen Haustüre. Jeder will aber Strom haben, nicht nur tags und im Sommer.
Tausende von Windkraftanlagen müssen aufgestellt werden – möglichst nah beim Verbraucher. Oft aber sagt der Bürger: „Nicht bei mir, stellt sie doch nebenan auf!“ Der Nachbar sagt aber das Gleiche. Also sagen dann beide: „Stellt sie doch in der freien Landschaft auf!“ Da sagen die Spaziergänger: „Nein, hier wollen wir uns erholen!“ und die Naturschützer: „Nein, hier lebt der gefährdete Rotmilan!“ Es gilt also wieder abzuwägen. Aufs Meer? Auch da wird Natur beeinträchtigt. Zudem sind die Anlagen und die langen Leitungen teurer und umkämpft (wie Krefeld als „Transitstadt“ für Nordseestrom weiß). Das Meer alleine reicht zudem bei weitem nicht. Die Anlagen müssen also doch auch auf Land irgendwo hin.
Im Konflikt zwischen freier Natur und Stadt hat die Stadt eigentlich wenig Grund sich zu zieren. Sie sollte anerkennen, dass sie den Löwenanteil des Stromes verbraucht und zu dessen Erzeugung so viele Windkraftanlagen aufstellen wie möglich. Dann müssen in den wenigen noch verbliebenen „freien Landschaften“ so wenige aufgestellt werden wie nötig. (Krefeld hat zudem dort schon welche und wird noch mehr brauchen).
Wohin also mit den Anlagen in Krefeld?
Klar ist, dass alle Abstandsregeln, Emissionsregeln und sonstigen Bau- und Naturschutzvorschriften beachtet werden müssen. Es bleiben dann naturgemäß in einer dicht bebauten Stadt nur wenige Bereiche. Welche es sind, dazu wird die Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Krefeld in wenigen Tagen eine Auswertung der Möglichkeiten vorlegen. Aber obwohl so ein „Arbeitspferd“ viel Strom macht (eine 6 MW-Anlage kann mit einer einzigen Rotordrehung ein Elektroauto 156 km weit fahren lassen), werden wir auch bei maximaler Ausschöpfung aller Standorte nur einen Teil unseres Stromes erzeugen können (dazu bräuchten wir 100 dieser Anlagen). Um so dringender ist es, aus den obigen Gründen jeden Standort der möglich ist auch zu nutzen.
Welchen Vorteil hat das?
Der Hauptvorteil ist die „eigene“ Erzeugung von Ökostrom. Wir leisten unseren (Pflicht-)Beitrag zur Energiewende. Der Ertrag ist bei uns (nachrichtlich) bilanzierbar, mehr Kunden können versorgt werden und wir sind unabhängiger von fernen Erzeugern – im Hinblick auf Preis (Höhe und Stabilität), Versorgungssicherheit und Vertrauen. Wir brauchen weniger „Norwegen-Zertifikate“ (Blog 37).
Es bleibt bei lokaler Erzeugung auch deutlich mehr Wertschöpfung in der Region, in Form von Gewerbesteuern, Gewinnen, Pachteinnahmen, Nettoeinkommen, Bau-, Betriebs- und Wartungseinnahmen, Arbeitsplätzen, ggf. Kapitalerträge usw.. Neben Investitionen lokaler Unternehmen (v.a. SWK) wären auch aktive und passive Bürger-Beteiligungen denkbar.
Kosten sparen die geringeren Transport- und Transformationsverluste bei lokaler Erzeugung. Das ist effektiver und drückt auf die Strompreise. Wir werden zudem etwas unabhängiger von Preisschwankungen auf dem Strommarkt.
Lokaler Ökostrom ist zudem ein positiver Standortfaktor und Krefelder Betriebe können, bei entsprechenden Verträgen, mit klimafreundlichem Bezug von Ökostrom werben (ganz ohne dubiose Kompensationsprojekte). Versucht werden sollte sogar eine Erweiterung der Standorte auf Industriegebiete zur direkten Versorgung; BASF, VW, Thyssen und viele andere Industrieunternehmen starten aus Gründen der Versorgungs-, Kosten- und Kennzeichnungssicherheit eigene Windkraftprojekte – es gibt auch in Krefeld Interesse.
Vereinsförderung inklusive?
Ein besonderes Leckerli: Die neue Bundesgesetzgebung sieht zudem vor, dass ein kleiner Prozentsatz des Gewinnes von Windkraftanlagen an die lokale Kommune gehen soll (https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__6.html - das Land NRW will mit einer verpflichtenden Gesetzgebung nachziehen). Rund 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde würden sich bei einer 6 MW-Anlage auf etwa 20.000 Euro pro Jahr summieren. Wenn 15 Anlagen aufgestellt werden könnten, könnten es ein jährlicher Ertrag von 300.000 Euro sein.
Ein Modell könnte Kevelaer sein, das schon vorgeprescht ist und bereits vor der Gesetzgebung einen Fördertopf für Vereine aufgelegt hat (https://rp-online.de/nrw/staedte/kevelaer/wie-vereine-in-kevelaer-von-windkraft-profitieren_aid-67920433 ).

Da in Presse und Ausschüssen immer wieder über die hohen Zahlen bei der Kostenschätzung für die Umsetzung von "KrefeldKlimaNeutral 2035" diskutiert wird, hier einmal ganz kurz die Erklärung wie es zu den hohen Schätzungen gekommen ist:
Die Gesamtkosten der Umsetzung der Klimawende werden im Gutachten mit „ca. 33,5 Mrd. Euro“ angenommen, wovon allerdings 30 Mrd. (d.h. knapp 90%) allein auf den Sanierungsbedarf privater Gebäude entfallen, d.h. privatwirtschaftlich getragen werden. Als mit Abstand größter Kostenpunkt sollen diese hier näher betrachtet werden.
Die Herleitung der Schätzung wird in Maßnahme WW-03 „Umsetzung umfangreicher Effizienzmaßnehmen in privatgenutzten Bestandsgebäuden (Wohn- und Nicht-Wohngebäude) näher erläutert (Gutachtenteil „Steckbriefe“ Seite 41 und 42).
Dort steht unter „Kostenannahmen“: „Es wird von Sanierungskosten in Höhe von rund 1.000 bis 3.000 €/m2(ja nach Sanierungsbedarf......) ausgegangen“.
und
„Laut Liegenschaftskataster kann die Nutzfläche aller Gebäude im Krefelder Stadtgebiet mit ca. 14. Mio. m2geschätzt werden“.
Wenn man nun einen mittleren Wert der geschätzten Sanierungskosten pro Quadratmeter mit der Gesamt-Nutzfläche multipliziert, kommt man tatsächlich auf rund 30 Mrd. Euro.
Wie realistisch ist die Rechnung?
Diese Rechnung ist eine leider viel zu grobe (geradezu leichtfertige) Schätzung, die, wie man derzeit sieht, eine schwere Hypothek für das Gutachten ist, da man solche Ausgaben nicht für realistisch hält. Mit Recht!
Zunächst sind die Kostenschätzungen pro Quadratmeter zu hinterfragen: Wenn man „Sanierungskosten pro Quadratmeter“ bei Google eingibt, erhält man zahlreiche Schätzwerte in einer Spanne zwischen 400 € und 1.200 €/m2. Darüber hinaus gehende Sanierungskosten sind selten.
Keinesfalls wird in Krefeld jedes Gebäude voll saniert werden, viele Gebäude werden nur teilsaniert werden. Zudem wird man im Rahmen der Wärmeplanung zunächst die Gebäude mit den hohen Einsparpotentialen angehen, wo die Durchschnittskosten völlig anders liegen können.
Auch die Gesamtfläche von 14 Mio. m2 kann nicht realistisch Grundlage der Berechnung sein. Es werden niemals alle Gebäude saniert werden müssen. Allein zeitlich werden, bei der im Gutachten angenommen Sanierungsrate von 4-5%/Jahr, bis 2035 rechnerisch maximal 60% der Gebäude saniert. (Dies entspricht auch den konkreteren Schätzung in Wärmeplänen anderer Städte).
Nimmt man diese Zahlen (also 60% von 14. Mio. m2 und durchschnittliche Sanierungskosten von 800 €/m2), dann käme man auf Kosten von 6,7 Mrd. für Maßnahme WW-03 – also weniger als ein Fünftel von 30 Mrd.. Der Gesamtprozess KrefeldKlimaNeutral 2035 würde mit dieser, immer noch viel zu groben Schätzung, bis 2035 also 10,2 Mrd. Euro kosten.
Genauere Zahlen wird die Wärmeplanung ergeben. Es ist damit zu rechnen, dass diese noch deutlich niedriger liegen.
Wenn man Berlin oder München der Schätzung zugrunde legen würde, die acht- bis fünfzehnmal so viele Einwohner wie Krefeld haben und mit geschätzten Gesamtinvestitionen für die Sanierung von "nur" rund 4 Mrd. Euro rechnen, müsste Krefeld ja deutlich unterhalb von einer halben Mrd. bleiben.
Und wenn man dann noch die vorhandenen und prospektiv voraussichtlich noch wachsenden Fördermittel abzieht, dann zeigt sich, dass die Aufregung über die Kosten zumindest verfrüht, wahrscheinlich aber völlig unnötig ist.

Auch wenn es vielleicht nervt: Nach dem überlangen Blogbeitrag 38 zur Wärmeplanung in München, der die Grundprinzipien der Wärmeplanung an einem praktischen Beispiel etwas breiter beleuchten sollte, hier noch ein Blick auf einige andere Städte, die schon Wärmepläne haben. Die Breite der Möglichkeiten soll deutlich werden (aber der Blog viel kürzer, wie versprochen)!
Freiburg (230.000 Einwohner), Oktober 2021 (https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/ get/params_E442090769/2021233/ Masterplan_Waerme_Freiburg%202030 _barrierearm.pdf ): Der Plan heißt „Masterplan Wärme 2030“ zielt aber auf Klimaneutralität 2050. Die Sanierungsquote soll von 1,5% bis 2030 auf 2,2% ansteigen. Der Wärmebedarf sinkt insgesamt um 16% bis 2030 und 40% bis 2050.
Aktuell 22% Fernwärmeversorgung über 30 Netze. Kein Hauptnetz. Mehr als fünf Versorger. Geplant sind Ausbau und Verbundbildung. Die Fernwärmeversorgung soll auf 51% erhöht werden. In Freiburg besteht ein großes Potential an Tiefen-Geothermie (soll 66% des Bedarfes decken). Das Abwasser ist wegen tiefer Lage besonders warm, deshalb überdurchschnittlich geeignet. Es gibt wenig industrielle Abwärme, keine Müllverbrennungsanlage. Es wird kein breiter Einsatz von Wasserstoff im Bereich Wärme erwartet. Eine Kostenanalyse der Wärmewende erfolgt nicht.
Rostock (211.100 Einwohner), Dezember 2023 (https://rathaus.rostock.de/media/ rostock_01.a.4984.de/datei/2022-06-16%20Wärmeplan_Rostock_FINAL.444911.pdf ): Ziel ist Klimaneutralität bis 2035 (sei aber vollständig erst 2045 erreichbar). Nach Beschreibung der Ausgangssituation und der Bedarfsanalyse werden die möglichen regenerativen Wärmepotenziale ermittelt z.B. Großwärmepumpen in Klärwasser, Flusswasser und Ostsee, Tiefegeothermie, Frei- und Dachflächensolarthermie, Biomasse (zu wenig, allenfalls Spitzenlast), Industrieabwärme (zu wenig). Die Sanierungsrate soll von aktuell 0,7% auf 1,2% bis 2% gesteigert und quartiersweise begleitet werden, dadurch Energieeinsparung bis 15% bis 2035. Besonderheit Rostocks (wie auch anderer ostdeutscher Städte) ist ein gut ausgebautes Fernwärmenetz von 400 km Länge. Die Anschlussquote soll von 60% auf 80% gesteigert werden. Saisonale Großwärmespeicher sollen gebaut werden. Die Gesamtkosten für alle Maßnahmen werden auf 1.400 Mio. € geschätzt, wovon 470 Mio. durch Förderung abgedeckt werden können, was ca. 930 Mio. Investitionsbedarflässt. Davon macht die Sanierung ca. 600 Mio. aus. Die Wärmewende sei dämpfend für die Preisentwicklung und damit hilfreich für Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen insofern sozialverträglich. Zudem sei man unabhängiger von überregionalen Preisentwicklungen und die regionalen Wirtschaftskreisläufe würden gestärkt.
Recklinghausen Südost (53.000 von 111.700 Einwohnern), Dezember 2013 (https://www.recklinghausen.de/inhalte/startseite/leben_wohnen/Dokumente/Barrierefreie_Vorlage_KSTK_Integriertes_Wärmenutzungskonzept.pdf): Recklinghausen erstellte für seine südöstlichen Stadtteile bereits 2013 (!!!) einen Wärmeplan mit dem Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen (Zwischenziel 2020). Es wurden Sanierungsraten zwischen 1% und 1,5% unterstellt, damit Rückgang des Wärmebedarfes um 8,6% bis 12,7% bis 2020. Sodann wurden die Wärme-Potenziale verschiedener regenerativer Quellen untersucht: Abwasser, Bioabfälle, oberflächennahe Geothermie, Schachtwärme, Grubenwasser, Grubengas, Industrieabwärme, Erdgas-KWK, Solarthermie. Anschließend wurde deren jeweilige Nutzung in verschiedenen konkreten Objekten und Quartieren des Zielgebietes untersucht und ein Maßnahmenkonzept mit Kostenschätzungen erarbeitet; ebenso ein Controlling-Konzept, um den Verlauf zu überprüfen.
Tübingen (90.000 Einwohner), Mai 2023 (https://www.tuebingen.de/ Dateien/Bericht_kommunaler_Waermeplan_Tuebingen.pdf ): Tübingen hat das Ziel 2030 klimaneutral zu sein. Als Sanierungsrate wurden 2% angesetzt, womit in der kurzen Zeit bis 2030 lediglich eine Energieersparnis von knapp 10% erreichbar wäre. Als mögliche Wärmequellen wurden identifiziert (% von Gesamtbedarf): Solarthermie auf Freiflächen (12%) und Dächern (7,5%), Abwasserwärme (7,9%), Erdkollektoren (7%) und -sonden (7%), Abwärme (5%), Oberflächengewässer (5%). Es folgte die Ermittlung von Eignungsgebieten für Fernwärme (Ausbau auf 59% Endenergie) und für die dezentrale Versorgung (vorwiegend Wärmepumpen) inkl. lokaler Wärmeinseln und abgeleitet die Vorschläge für die konkreten Quartiere.
Stuttgart (633.000 Einwohner), September 2023 (die Seite ist nicht mehr direkt ansteuerbar: Google-Suche: "Energieleitplanung und kommunaler Wärmeplan Stuttgart" öffnen, dort "Bericht" herunterladen) Neutralitätsziel 2035: Stuttgarts Wärmeplanung ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Zum einen gab es frühzeitig Quartiersteckbriefe aber keinen umfassend ausformulierten Handlungsplan im Wärmebereich. Es gab einen groben Rahmenplan, der tabellarisch diverse allgemeine Maßnahmen definierte (ohne Kostenabschätzungen). Ferner gab es ein paar einzelne Potentialstudien, die Abwärme, Abwasser, Fernwärme, Solarthermie und Neckarwärme untersuchen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass es über wärmepumpengenutzte Umweltwärme hinaus nur sehr geringe Potentiale erneuerbarer Wärme gibt und ein genereller Ausbau der Fernwärme nicht zielführend ist. Individuelle Quartiers-Lösungen wurden empfohlen. Die Zusammenfassung zum Bericht "Kommunale Wärmeplanung 2023" erfolgte erst Ende 2023. Dort ist das Vorgehen noch einmal gut beschrieben und er enthält die Quartiersteckbriefe. Er soll politisch beschlossen und Anfang 2024 veröffentlicht werden.
Sehr interessant und beeindruckend ist die Vielfalt der Lösungen in den 53 Quartier-Steckbriefen. Diese schlagen ganz individuelle lokale Maßnahmepakete vor, die von kombinierten lokalen Wärmepumpenlösungen (z.B. Oberflächenwärme unter Sportplätzen, Luftwärmepumpen, Erdsonden) über Abwasserwärme und Industrieabwärme über viele lokale Netze bis zum Anschluss an vorhandene Fernwärmenetze reichen. Wo sehr wenig Wärme vorhanden ist und individuelle Lösungen schwierig sind, wird der Schwerpunkt auf die Sanierung gelegt. Eine Sanierungsrate von 3,7% soll insgesamt erreicht werden (Tiefe KfW 55). Kostenabschätzungen gibt es allerdings auch in den Quartiersteckbriefen nur punktuell.
Kleinere Städte in Baden-Württemberg
Die Wärmepläne ähneln sich sehr, da sie den Landesvorgaben folgen: Als Neutralitätsziel wird deshalb i.d.R. 2040 angestrebt, ggf. mit Zwischenzielen 2030. Es folgen Bestandsanalyse, Potentialanalyse, Zielszenario, Strategie und Maßnahmenkatalog. Dann mehr oder weniger kleinräumige Gebietsanalysen. Die angestrebten Sanierungsraten liegen meist bei 3%, um Einsparungen des Heizenergiebedarfes zwischen 30% und 46% zu erreichen. Dann Verteilung des Restbedarfes auf die verfügbaren regenerativen Energiequellen. Meist wird der Bau oder Ausbau lokaler (Fernwärme-)Netze empfohlen. Verbrauchsmäßig aber überwiegen die dezentralen Lösungen, ganz überwiegend mit Wärmepumpen.
Giengen an der Brenz (20.000 Einwohner), Juli 2023: https://www.giengen.de/Kommunale-Waermeplanung(Plan abrufbar unter „Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung“)
Kornwestheim (33.680 Einwohner), Juli 2023: https://www.kornwestheim.de/start/leben+und+wohnen/klima+und+energie.html
Ostfildern (39.800 Einwohner) Juni 2023: https://www.ostfildern.de/wärmeplanung.html
Kirchheim unter Teck (41.900 Einwohner), Mai 2023: https://www.kirchheim-teck.de/klimaschutz/Kommunale-Waermeplanung
Weitere Pläne (auch bundesweit) sind auch gelistet unter https://www.kww-halle.de/wissen/themen-der-kommunalen-waermeplanung/praxisbeispiele-in-der-uebersicht/kommunale-waermeplaene-im-ueberblick
Folgerungen für Krefeld
Die Wärmewende ist bis 2035 voraussichtlich möglich und muss aber für jede Stadt individuell erarbeitet werden. Stuttgart z.B. macht vor, wie man bei der Quartiersbetrachtung höchst kreative lokale Lösungenerarbeiten kann und dadurch selbst bei schlechtem Wärmequellenangebot Klimaneutralität erreichen kann. Ehrgeizige Sanierungraten (zwischen 2% und 4% pro Jahr) und Ausbau netzgebundener Energie (Fern- oder Nahwärmenetze) sind aber bei praktisch allen Städten Elemente einer erfolgreichen regenerativen Versorgung.
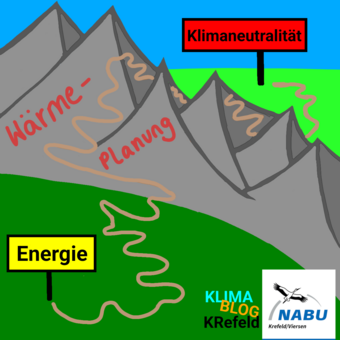
Schon in Blog 8 und Blog 25 wurde betont, dass der Wärmebereich in Krefeld der größte Treibhausgasemittent ist und deshalb die Wärmeplanung so wichtig ist. Derzeit wird auf Bundesebene über das Wärmeplanungsgesetz gestritten. Einige Bundesländer haben schon diesbezügliche Gesetze (z.B. Baden-Württemberg). Auch in NRW gehen einige Städte schon voraus und beginnen mit der Wärmeplanung. Erfreulicherweise ist auch Krefeld darunter. Die Haushaltsmittel dafür sind bewilligt, der Antrag auf Bundesförderung ist gestellt. Die Ausschreibung für die Erstellung erfolgt in diesen Tagen.
Gibt es schon Vorbilder?
Mehrere Städte haben die Wärmepläne schon fertig. München z.B. hat bereits am 6.10.2021 einen Wärmeplan veröffentlicht mit dem Neutralitätsziel 2035 (https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:37abd6b3-1684-4853-8b5a-2c9ff0313fbc/Klimaneutrale-Waerme-Muenchen.pdf ). Da er von den beauftragten Gutachtern (FFE GmbH und Öko-Institut e.V.) sehr ausführlich (282 Seiten) und systematisch erstellt wurde, soll er hier beispielhaft vorgestellt werden.
Wie wurde der Wärmeplan in München erarbeitet?
Zunächst wird als Zielwert eine maximale Treibhausgas-Restemission des Wärmebereiches von 0,06 t CO2äq je Einwohner festgelegt. Dann wird jeweils recht ausführlich die Strategien vergleichbarer Städte(Hamburg, Wien, Zürich, Kopenhagen) dargestellt und die Relevanz von Erfolgsfaktoren für die Stadt München betrachtet.
Anschließend erfolgt eine Analyse der Wärmebedarfe Münchens. Der Datenbestand vorhandener Quellen wird abgeglichen, anzusetzende Zahlen für Neubauten (Anzahl, Wärmestandard etc.) diskutiert.
Sodann wird die Abgrenzung dreier verschiedener Gebiete angestrebt: 1) Fernwärme-Verdichtungsgebiete, 2) Fernwärme-Erweiterungsgebiete, 3) dezentral zu versorgende Gebiete. Die Verdichtungsgebiete sind bekannt (existierendes Netz). Für die Abgrenzung der Erweiterungsgebiete ist zunächst langfristiger Bedarf und die Wärmebelegungsdichte (Wärmemenge pro verbauter Wärmetrasse) maßgeblich. Des Weiteren erreichbare Erlöse, Ausbaukosten (Trasse, Anschlüsse), Wärmegestehungskosten, Vorhandensein klimaneutraler Wärmequellen und weitere Faktoren. In einem Raster von 250x250 m wird sodann die Fernwärme-Erweiterungsgebiete auf der Karte markiert. Übrig bleiben die dezentralen Gebiete.
Anschließend werden der Reihe nach die in München vorhandenen Wärmepotentiale analysiert. Nach einigen Grundsatzüberlegungen werden folgende Wärmequellen in ihrer räumlichen und zeitlichen Verfügbarkeit, ihrer Verlässlichkeit und ihre Stärken, Einschränkungen und Effekten betrachtet: Tiefe Geothermie, Biomasse, Wärmepumpen, Emissionsarme Gase (Wasserstoff u.a.), Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, Industrielle und gewerbliche Abwärme sowie Abwärme aus Klärschlammverbrennung, Abwasserkanälen, Tunneln.
Nächster Schritt ist die Festlegung relevanter dezentraler Lösungen (nicht-Fernwärme-Gebiete). Vorausgeschickt wird, dass sich der Anschluss von Ein- und Zweifamilienhäusern an die Fernwärme i.d.R. nicht lohnt. Für diese müssen also generell dezentrale Lösungen gefunden werden. Analyse mehrerer Studien zeigt, dass Sanierung, Wärmerückgewinnung, Solarthermie und Wärmepumpen die günstigsten CO2-Verminderungskosten versprechen (neben Biomasse, die aber anderweitig dringender benötigt wird). Damit bleibt als Wärmquelle hauptsächlich die Wärmepumpe, da Solarthermie zwar bei hohem Warmwasserbedarf sinnvoll ist, aber allein nicht ausreicht.
Als nächstes wird die Perspektiven für die Fernwärme dargestellt: Dazu gehören „technische Maßnahmen“ wie Temperaturabsenkung (Hin- und Rücklauf), Dampfnetzumstellung, Speicher (auch saisonal), Wärmeeinspeisung Dritter, Digitalisierung. Vor allem aber Transformation hin zu klimaneutraler Fernwärmeerzeugung (Schwerpunkt in München: Tiefen-Geothermie).
Schließlich werden Kompensationsmaßnahmen diskutiert, falls eine ausreichende Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2035 nicht möglich sei.
Ausführliche Kostenanalyse
In der Folge werden sehr ausführlich die Kosten (inkl. zukünftiger Entwicklung) aller Maßnahmen analysiert und verglichen. Einige Voraussetzungen werden diskutiert, z.B. die beträchtliche Steigerung der CO2-Emissionsbepreisung, die Entwicklung der Strompreise und des Stromverbrauches sowie der Gas-, Öl- und Wasserstoffpreise und der Netzentgelte. Daraus abgeleitet wird die Kostenentwicklung für Einzelverbraucher und für den Fernwärmepreis abgeschätzt sowie die Wärmebereitstellungskosten, Heizsystemtauschraten, verschiedene Wärmesysteme und die Kosten für Verdichtung und Erweiterung der Fernwärme betrachtet.
Schließlich wird auch die Wärmeverbrauchsseite analysiert: Wärmedämmung sei zwar im Vergleich mit anderen Maßnahmen (z.B. Heizungsersatz) teurer, sei jedoch für die Effizienz klimaneutraler Wärmequellen eine wichtige Voraussetzung. Wegen des Neutralitätszieles 2035 werden ambitionierte Sanierungsraten (rund 2,7% pro Jahr) für notwendig gehalten. Dennoch könnte rechnerisch bis 2035 nur maximal ca. ein Viertel der Häuser saniert werden. Bezüglich der Sanierungstiefe wird empfohlen, in Fernwärmegebieten die im restlichen Stadtgebiet angenommene Verschärfung auf die Sanierungsstandards KFW 55 und KFW 40 nicht durchgehend anzuwenden; entsprechend gibt es am Ende unterschiedliche empfohlene Sanierungstiefen für verschiedene Gebäude. Bei der folgenden Kostenrechnung werden ohnehin notwendige Kosten für Modernisierungen (die alle 40 Jahre rechnerisch stattfinden) ausgeklammert. Es folgt eine Priorisierung: Denkmalgeschützte Gebäude (in München 20%) sollen nachrangig saniert werden, da bei anderen Gebäuden höhere Einsparungen möglich sind. Da rechnerisch bis 2050 nur 60% der Gebäude saniert werden können, bleiben weitere 20%, die nachrangig saniert werden müssen. Da wegen der überwiegenden Wärmepumpenlösungen in dezentralen Gebieten mehr Effizienzgewinne möglich sind, sollten die nicht prioritär zu sanierenden Gebäude im Fernwärme-Verdichtungsgebiet liegen.
Zukunftsszenarien
Aufgrund der ermittelten Daten werden dann zwei Zukunftsszenarien („Fokus Fernwärme“ und „Fokus dezentral“) entwickelt mit den Vorschlägen für Maßnahmen und den zu erwartenden Kosten. Bei beiden Szenarien sinkt der Gesamtwärmebedarf bis 2035 um 16% (bis 2050 um 34%) auf 9,3 TWh. Davon werden 2035 im Szenario „Fernwärme“ 5,1 TWh (75%) durch Fernwärme und 1,3 TWh durch dezentrale Wärmepumpen bereitgestellt (im „dezentralen“ Szenario 4,6 TWh und 1,6 TWh).
Der Beitrag von (blauem) Wasserstoff im Wärmesektor wird für 2035 mit ca. 12% „Fokus dezentral“) bzw. 2% („Fokus Fernwärme“) angenommen. Beträchtlich sei hingegen der Anstieg des Strombedarfes im Wärmesektor.
Aber: Der CO2-Ausstoß von 0,06 t CO2/Kopf wird 2035 deutlich verfehlt, 2050 aber erreicht. Der entscheidende Faktor für die Verfehlung in 2035 ist die begrenzte Geschwindigkeit der Transformation speziell in Gebieten mit dezentraler Wärmeerzeugung. Auch die Müllverbrennung bildet einen Emissionssockel (etwa in Höhe des Zielwertes), der die Erreichung des Zieles schwer macht. Entsprechende Kompensationen der CO2-Restmenge werden teuer, können aber, was den Müllanteil angeht, evtl. auf die Abfallgebühren aufgeschlagen werden.
Kostensummen - niedriger als in Krefeld?
Um die Klimaneutralitätsziele zu erreichen sind in beiden Szenarien hohe zusätzliche Investitionen (jeweils 2021-2035/2026-2050) in Sanierung (ca. 0,8/2,4 Mrd. €), Heizungstausch (1,2/1,4 Mrd. €) und Fernwärme (0,8-1,7/0,2-0,4 Mrd. €) notwendig. Diese fallen bei verschiedenen Akteuren an. Es stehen aber Einsparungen über die Lebensdauer der Anlagen/Investitionen an, die die Mehrinvestitionen in vielen Fällen überkompensieren. Knapp die Hälfte der notwendigen Investitionen wird durch Fördermittel des Bundes bestritten.
Im Vergleich mit einem „Referenzszenario“ ohne umfassende Maßnahmen zur Verdichtung und Erweiterung der Fernwärme und ohne forcierte Sanierung und Heizsystemumstellung verbleibt nach Abzug der Fördermittel ein Rest-Investitionsbedarf von 3,8 Mrd. € im Szenario „dezentral“ bzw. 4,4 Mrd. € im Szenario „Fernwärme“ (die Differenz gleicht sich bei den Betriebskosten wieder aus).
In München lohnt es sich!!
Zitate: „In den Jahren 2025, 2030 und 2035 gleichen sich zusätzliche Investitionen und Einsparungen in den zielorientierten Szenarien gegenüber der Referenz in etwa aus. Ab dem Jahr 2040 dominieren die Netto-Einsparungen....mit steigender Tendenz“ (z.B. 12 € pro Kopf und Monat im Jahr 2050). „Insgesamt lässt sich also festhalten, dass beide zielorientierten Szenarien gegenüber der Referenz aus der Sicht der „Mini-Volkswirtschaft München“ in Summe und insbesondere ab dem Jahr 2040 lohnenswert sind“.
Bei isolierter Betrachtung der Stadtwerke München wird die Bilanz allerdings vorwiegend durch hohe Wasserstoffkosten belastet, die nur durch zusätzliche Förderungen wirtschaftlich darstellbar wären.
Bei Betrachtung speziell der Nutzenden von Gebäuden, die Investitionen von 3,6 Mrd. € („dezentral“) bzw. 3,2 Mrd. € („Fernwärme“) tragen müssen, ergibt sich, bei angenommener etwa hälftiger Bundesförderung und dem prognostizierten Kostenanstieg fossiler Energieträger, durchweg eine Entlastung gegenüber dem Referenzszenario. Allerdings verteilt sich der Nutzen nicht generell motivierend für Vermieter. Dazu würden derzeit auf Bundesebene noch geeignete Anreizmodelle überlegt (z.B. Umlage CO2-Preis etc.). Für Mietersind eher deutliche Ersparnisse zu erwarten (durch Wärmpumpeneinbau stärker noch als durch Fernwärme).
Was bedeutet das für Krefeld?
Das insgesamt lohnenswerte Ergebnis für München ist auch für die Wärmeplanung in Krefeld motivierend. Insbesondere die detaillierteren finanziellen Analysen in München legen nahe, dass z.B. der Investitionsbedarf (v.a. für Sanierungen) in Krefeld bei genauerer Analyse nicht so hoch sein wird, wie die ersten (siehe Blog 35) sehr groben Schätzungen im Gutachten „KrefeldKlimaNeutral 2035“ vermuten ließen (z.B. weil dort pauschal mit 100% der gesamten Gebäudefläche gerechnet wurde). Bei detaillierterer Rechnung und Einbeziehung der Rahmenbedingungen (CO2-Preis, Fördermittel, Referenzszenario) werden sich vielleicht auch viel deutlichere Ersparnisse ergeben und damit ein wirtschaftlich lohnendes Ergebnis auch für Krefeld bestätigt werden können.
Die „Weltrettung“ durch die Einhaltung der Klimaziele und der Gewinn durch regionale Wertschöpfung kommen dann „als Bonus“ noch obendrauf!
(PS: Die Länge dieses Blogbeitrags bitte ich zu entschuldigen. Es sollte die Breite des Themas beleuchtet werden. Die nächsten Beiträge werden kürzer – versprochen!)
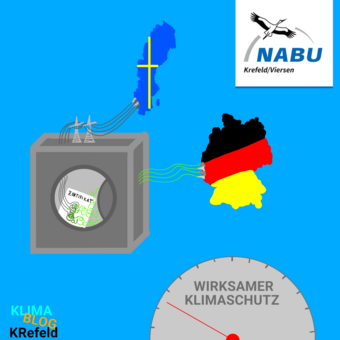
Als „Lockerungsübung“ zwischen den vielen Blogs über „KrefeldKlimaNeutral 2035“, hier der „Skandinavien-Krimi Teil II“ als Ergänzung zu Blog 32 „Das Skandinavienproblem des Ökostromes“. Wie dort erklärt wurde, kann ein hiesiger Stromversorger eingekauften fossil erzeugten Strom durch Kauf europaweit gültiger Herkunftsnachweise (HKN) in Ökostrom „umdeklarieren“. Wie dargelegt, führt dieses System leider nicht zum Ausbau von erneuerbarer Energieerzeugung, da die Nachweise aufgrund der zahlreichen Wasserkraftanlagen vor allem in Skandinavien nicht knapp sind und deshalb kein Zubau angeregt wird. Es ist aber alles völlig legal, solange die Stromeigenschaft nicht doppelt verkauft wird.
Island geriet als erstes in Verdacht
In Bezug auf regenerative Energieerzeugung ist Island aufgrund seiner starken vulkanischen Aktivität Vorreiter. 99% seines Stromes stammen aus Geothermie und Wasserkraft. Als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) nimmt Island auch am Mechanismus der Herkunftsnachweise (HKN) teil. Da es sich bei den HKN nur um eine virtuelle Eigenschaftszuschreibung handelt, ist dies, wie erläutert, legal möglich, obwohl das isländische Stromnetz keinerlei Verbindung zum europäischen Netz hat und damit realer isländischer „Ökostrom“ definitiv nicht auf das europäische Festland gelangt.
Die Ausgabe von HKN wird durch einen Zusammenschluss der in den jeweiligen Ländern für die Ausstellung und Entwertung zuständigen Behörden Association of Issuing Bodies (AIB) überwacht. Diese trennte Island am 28. April 2023 zunächst vom Herkunftsregister, so dass dieses keine HKN mehr ausstellenkonnte (das für Deutschland zuständige Umweltbundesamtes verfügte entsprechend am 8. Mai 2023 einen Importstopp).
Was war passiert?
Schon am 29.11.2022 veröffentlichte der Journalist Hanno Böck auf der Rechercheplattform Golem seine Untersuchungen zu isländischen Herkunftsnachweisen (https://www.golem.de/news/erneuerbare-energien-wie-island-seinen-oekostrom-doppelt-verkauft-2211-169902-2.html ). Er belegte darin ausführlich, dass die regenerative Eigenschaft des isländischen Stromes doppelt genutzt würde.
Kurz zusammengefasst: Island produziert im Jahr 19 Terawatt grünen Strom. Gleichzeitig wurden für 14 Terawatt Strom Herkunftszertifikate ins Ausland verkauft (https://www.aib-net.org/facts/market-information/statistics/activity-statistics-all-aib-members ); (nebenbei: Landsvirkjun, der größte Stromerzeuger Islands verdiente 2022 daran rund 11 Mio. Euro pro Jahr). Seit den 90er Jahren aber warb Island auch mit preiswertem und sauberem Strom, weshalb sich (unter anderem) drei große Aluminiumhütten in Island ansiedelten (Rio Tinto, Nordural und Alcoa). Diese werben in weltweit mit Aluminiumproduktion aus 100% regenerativen Stromquellen und weisen das in ihren CO2-Bilanzen aus so aus. Sie verbrauchen in Island zusammen 12 Terawattstunden Strom im Jahr. Sie erwerben dafür keine Herkunftsnachweise. Aber, selbst wenn sie es täten: Es wären nur Herkunftsnachweise für 19 – 14 = 5 Terawatt Strom verfügbar. Nicht einmal die Hälfte ihres angeblichen Öko-Stromverbrauches wäre also EU-konform als „Ökostrom“ belegt. Physikalisch erhalten die Aluminiumunternehmen regenerativen Strom, bilanztechnisch aber auch die ausländischen Unternehmen (inkl. Stromversorger wie die SWK), die Herkunftsnachweise beziehen. 7 Terawatt Strom werden damit aber doppelt angerechnet.
Was ergaben weitere Recherchen?
Auf Rückfrage von Hanno Böck bei der AIB wurde klar, dass diese schon länger von dem Problem wusste. Sie hatte die isländischen Behörden auch bereits aufgefordert, Abhilfe zu schaffen. Immerhin wurden Kunden des Stromversorgers zunehmend motiviert, Herkunftsnachweise zu erwerben – was das Grundproblem aber nicht löste. Hanno Böck fragte auch bei den Unternehmen nach: Von Alcoa erfuhr er, dass weder in Island noch für ein Werk in Norwegen Herkunftsnachweise bezogen würden. Ziel von Alcoa sei, im physikalischen Sinn emissionsfrei zu produzieren, (was ja lobenswert ist). Man verwende ein ortsbasiertes Bilanzverfahren, bei dem nur der jeweils vor Ort vorhandene Strommix relevant sei; und dieser sei sowohl in Norwegen als auch in Island praktisch 100% regenerativ. Dieses Verfahren sei für das Unternehmen im Sinne eines einheitlichen Bilanzsystems notwendig, weil es ja auch in Ländern operiere, die gar keine Herkunftsnachweise hätten. Seitens des Unternehmens nachvollziehbar. Die Probleme entstehen erst dadurch, dass der Stromversorger für den gleichen Strom auch noch Herkunftsnachweise verkauft. Dieser aber sieht das Problem bei den Unternehmen, die ohne Nachweise mit Ökostrom werben würden und der Regierung, die darauf nicht reagiere.
Die weltweiten Ansichten zu diesem Problem teilen sich in zwei Lager: Den marktbasierten und den ortsbasierten Ansatz. Zugrunde liegt das weltweit gültige „Greenhouse Gas Protocol“. Dieses erlaubt aber letztlich beide Abrechnungsarten. Eine Überprüfung ist allerdings angekündigt.
Ist der Mißstand jetzt abgestellt?
Nachdem das Umweltbundesamt am 8. Mai 2023 den Importstopp von HKN offiziell verfügt hatte, wurde der Import am 1. Juni 2023 wieder erlaubt. Parallel wurde Island vom AIB wieder an die zentrale Verrechnungsstelle angeschlossen. Das Umweltbundesamt begründete seine „Kehrtwende“ damit, dass Island nachbessere und dass es die Ausstellung und Abrechnung von HKN juristisch nur versagen könne, wenn eine Doppelabrechnung innerhalb des HKN-Systems stattfinde. Dies sei aber nicht der Fall (https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/372/dokumente/20230728_pressemailing_aussetzungsofortvollziehung.pdf).
Hinter den Kulissen wird gemunkelt, dass es auch pragmatische Überlegungen waren, nicht auf einer Versagung des Importes zu bestehen. Recherchen machen sehr wahrscheinlich, dass auch in Norwegen beträchtliche Doppelabrechnungen erfolgen. Damit müsste auch der Import von HKN aus Norwegen untersagt werden. Da die in Deutschland anerkannten HKN aber fast zur Hälfte aus Norwegen stammen, hätte das gravierende Konsequenzen für den Ökostrommarkt in Deutschland. (siehe z.B. https://www.ffe.de/veroeffentlichungen/norwegen-und-die-doppelvermarktung-erneuerbarer-energien/ ).
Auswege aus dem Dilemma werden gesucht. Am 8. November 2023 will das AIB wohl eine Entscheidung zu dem Thema verkünden. Spannend!
Was bedeutet das für Krefeld? Ein „Hoch“ auf Wind und Sonne!
Auch die SWK sind darauf angewiesen, Teile ihres Ökostromangebotes durch Herkunftsnachweise als Ökostrom zu legitimieren. Wie man aber sieht, kann das zu Problemen führen. Zum einen steht aktuell die Glaubwürdigkeit des HKN-Systems auf dem Prüfstand. Je nachdem wie die Debatte sich entwickelt, könnte es für Unternehmen sinnvoller sein, im Sinne juristisch tragfähiger Werbeaussagen nicht auf HKN-zertifizierten Strom zu vertrauen. Zum anderen besteht für die SWK das Risiko, dass (z.B. im November) der HKN-Bezug aus Norwegen in Frage gestellt wird und dann Probleme bestehen, genügend „Ökostrom“ für die Kunden belegen zu können.
Alle Beteiligten müssten also ein hohes Interesse daran haben, die Produktion von regenerativem Strom in und um Krefeld herum massiv auszubauen. Dann wären sowohl marktbasierte als auch ortsbasierte Zurechnungssysteme anwendbar. Zudem für meinen einfachen Geist: Ökostrom von der Windkraftanlage vor der Türe weckt mehr Vertrauen als aus Island, mit dem gar keine Stromverbindung besteht.

In Blog 11 vom Januar 2023 war bereits festgestellt worden, dass bereits eine ganze Reihe von Städten in Deutschland Neutralitätsbeschlüsse gefasst hatten oder daran arbeiteten. Inzwischen sind es noch viel mehr geworden.
Auch komplette Klimaschutzprogramme (wie unser KrefeldKlimaNeutral 2035) mit dem Ziel einer vorgezogenen Klimaneutralität liegen inzwischen in vielen Städten vor. Waren es 2019/2020 nur vereinzelte (z.B. Freiburg, Aachen, Gießen), wurden es von Jahr zu Jahr mehr. Inzwischen ist die Anzahl kaum noch zu überblicken. Die meisten peilen 2035 als Neutralitätsziel an, einige 2030 (z.B. Marburg, Tübingen, Erlangen, Mannheim), einige 2040. Einige teilen: Gesamtstadt bis 2035, Stadtverwaltung bis 2030 (u.a. Frankfurt, Heidelberg, Osnabrück), was in der Pressedarstellung zu Missverständnissen führen kann.
Jahreszahl oder CO2-Restbudget?
Einige Städte betrachten dabei aber nicht so sehr die Jahreszahl des Erreichens der Klimaneutralität als Zielgröße, sondern das CO2-Restbudget (z.B. Aachen, Erlangen, Mannheim, Hamburg). Wie schon in Blog 33 erwähnt, kann man ausrechnen, wieviel CO2 die Weltbevölkerung noch verursachen darf, bis das 1,5-Grad-Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten wird. Dies kann man dann auf die jeweilige Stadt herunterbrechen. Ohne Emissionsreduktionen hätte z.B. Krefeld schon Mitte 2025 sein Restbudget verbraucht. Entsprechend rasch ginge es auch bei praktisch allen anderen Städten. Deshalb wird betont, dass vor allem ganz kurzfristig massive Emissionsreduzierungen notwendig sind, um das Budget zu strecken und bis zum Erreichen der Klimaneutralität nicht zu überschreiten. Die wirksamsten und die schnellsten Maßnahmen sollten also so früh wie möglich ergriffen werden. Da dies in der Praxis aber meist nicht so schnell geht, wird in allen erwähnten budgetgeführten Städten eine Einhaltung des 1,5-Grad-Budgets für praktisch nicht mehr möglich gehalten – obwohl die Neutralitätsziele jahreszahlmäßig (Erlangen 2030, die anderen 2035) noch erreicht werden können. Die Geschwindigkeit der Absenkung der Emissionen sei aber allenfalls noch mit dem 1,75-Grad-Ziel vereinbar.
Zu erwähnen ist noch, dass die meisten Städte, mehr oder weniger ausgesprochen, Treibhausgasneutralität anstreben; Mannheim aber strebt ausdrücklich „Klimaneutralität“ an (d.h. Mitberücksichtigung von Klimaauswirkungen jenseits der Treibhausgase).
Inhaltlich besteht weitgehende Einigkeit
In Blog 34 war eingangs bereits erwähnt worden, dass sich die Klimaschutzprogramme der verschiedensten Städte in den meisten Aspekten gleichen. In der Folge soll das in einigen Punkten näher beleuchtet werden:
Erarbeitungsprozess: Die meisten Städte haben nach Ratsbeschluss einen oder mehrere Gutachter beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Stadt und wichtigen Akteuren ein Klimaschutzprogramm zu erstellen. Andere Städte haben das Programm selbst erarbeitet. Einzelne (z.B. Erlangen, Mannheim und Wuppertal) haben die anzustrebenden Maßnahmen sogar in verschiedensten Beteiligungsprozessen mit der Bevölkerung und vielen anderen Akteuren gemeinsam erarbeitet.
Ausformulierungen: Die Klimaschutzprogramme stammen von sehr unterschiedlichen Gutachtern oder von den Städten selbst. Entsprechend unterschiedlich sind die Formulierungen und Blickrichtungen. So ist z.B. der Endbericht von Stuttgart „Net zero“ vortragsartig, tabellarisch; andere sind kurz und eher allgemein (z.B. Wuppertal), während viele lange Prosa, Erläuterungen oder viele Anhänge bevorzugen.
Hauptbereiche: Praktisch alle Städte unterteilen wie Krefeld in die großen Bereiche „Wärmewende“, „Mobilitätswende“ und „Stromwende“ sowie daneben „strukturelle, übergreifende Maßnahmen“. Die Emissionsschwerpunkte unterscheiden sich zwischen den Städten z.T. leicht, je nach (industrieller) Struktur (in Aachen und Erlangen z.B. „führt“ der Verkehr). ETS-Betriebe bleiben – im Gegensatz zu Krefeld - eher selten unberücksichtigt (in Mannheim z.B. explizit eingeschlossen).
Wärmewende: Der für Krefeld als Hauptemittent so wichtige Wärmebereich wird unterschiedlich gehandhabt. Manchen Gutachten verweisen fast komplett auf den zu erstellenden Wärmeplan, den erst wenige Kommunen fertig haben. Ansonsten sind die Empfehlungsschwerpunkte wie in Krefeld: Sanierung der Gebäude, Ausbau der Fern- und Nahwärme (bis auf deutlich über 50%), Decarbonisierung der Fernwärme, Decarbonisierung der Gasnetze, Ausbau von Wärmepumpen. Mehr dazu in Kürze in einem Blog speziell zur Wärmewende. Nur schon der Hinweis: Praktisch alle Städte halten, wie Krefeld, eine Steigerung der Sanierungsraten auf rund 4% für notwendig (München weicht z.B. ab mit 2,7%). Es gibt Unterschiede in Sanierungsbreite und -tiefe. Allerdings werden die Kosten generell eher niedriger geschätzt (z.B. Stuttgart schätzt „nur“ 5 Mrd., statt wie Krefeld 30 Mrd.). Aachen hat – wie die Niederländer - offenbar bereits gute Erfahrungen mit Quartiersberatungen.
Stromwende: Hier setzen alle hauptsächlich auf Wind und Sonne, wobei manche Städte bilanziell bis zu 100% ihres Strombedarfes selbst erzeugen wollen. Viele halten aber nur weniger für möglich (z.B. Köln 51%,). Unterschiedlich sind die Anrechnungsmodelle. Wie schon in Blog 34 erwähnt, erlaubt das i.d.R. praktizierte Bilanzierungsmodell (BISKO) keine direkte Anrechnung von CO2-Einsparungen durch regenerative Energieerzeugung, da ja überall der gleiche Strom aus dem Netz kommt. Erzeugungskapazitäten können aber in der Bilanz nachrichtlich erfasst werden. Dies handhaben Städte aber unterschiedlich, was zu schwer vergleichbaren Zahlen führt. Außerdem führen manche Städte bei ihren 100%-Plänen auch Erzeugungskapazitäten der Stromversorger außerhalb der Stadtgrenzen mit auf (z.B. München).
Potentiale von Sonne und Wind: Das Windenergiepotential soll immer maximiert werden und hängt meist vom Vorhandensein von Außenbereichen ab. Akzeptanzförderungen werden diskutiert (z.B. Marburg). Ausbaumöglichkeiten für Photovoltaik werden z.T. recht unterschiedlich eingeschätzt; sie werden, wie in Krefeld, oft auf gut 50% des theoretischen Potentials geschätzt; manche wollen (utopische?) 90% erreichen. Satzungsmaßnahmen (Solarpflicht, Verbrennungsverbot etc.) werden in allen Städten empfohlen.
Kosten: Viele Städte betonen, dass Warten nur teurer wird und sich die meisten Investitionen für Bürger und Städte lohnen. Viele aber halten sich mit konkreten Zahlen zu Ausgaben und zu Ersparnissen sehr zurück und verweisen auf noch zu erfolgende Detailanalysen, da viele Zahlen nur grob geschätzt werden könnten.
Restemissionen: Unterschiedlich sind die Einschätzungen der Restemissionen, die 2035 entweder „tolerabel“ sind oder kompensiert werden müssen. Sie liegen meist zwischen 0,3 und 0,9 t CO2/Kopf. Einige Klimakonzepte enthalten Vorschläge dazu, wie diese am Ende zu kompensieren sind. Mehrere schlagen Aufkauf und Entwertung von EU-Emissionszertifikaten vor, andere analysieren diverse Kompensationsprojekte (München z.B. ausführlich auch die Renaturierung von Mooren: Krefelder Feuchtgebiete??).
Bodennutzung: Einige Städte betrachten zusätzlich zu den oben genannten großen Bereichen ausdrücklich auch die Land- und Forstwirtschaft und die sonstige Bodennutzung (Flächenversiegelung, Wasserhaushalt, Schwammstadt etc.), die bei Bilanzierung nach BISKO in der Regel außen vor gelassen wird.
Übergreifende Aspekte: Viele Städte weiten ausdrücklich den Blick über die mehr technischen Aspekte der Energiewende hinaus und diskutieren Kreislaufwirtschaft, graue Emissionen, Mikroplastik, Ansiedelung nachhaltiger Unternehmen, Nachhaltigkeitskriterien, Lebensstil/Suffizienzprinzip, Fleischkonsum, Wohnflächenreduzierung, überregionale Auswirkungen (Konsum, Flüge etc.) oder Stadtplanungskonzepte wie kurze Wege, Nutzungsdurchmischung, Rückbau, Entsiegelung, grüne und blaue Infrastruktur etc.
Diverse spezielle Maßnahmen: Manche Städte konkretisieren spezielle Maßnahmen, wie z.B. spezifische Förderprogramme (das Kölner Förderprogramm „klimafreundliches Wohnen“ ist z.B. mit 20 Mio. € ausgestattet – Krefeld bisher mit 0,5 Mio. €), Detailmaßnahmen (Marburg z.B. Vermarktung von post-EEG-Anlagen; Mannheim, Köln und Stuttgart planen das CO2 der Müllverbrennung einzufangen uva.), Mühlheim plant eine überregionale Verzahnung seiner Wärmeplanung und den Einsatz von Synfuels, Freiburg erwähnt eine mögliche Übernahme externer Kosten z.B. durch Kompensationsleistungen von Unternehmen bzw. Zahlungen von Bürgern in einen „Flugreisentopf“ und Berücksichtigung in der Stadtbilanz etc.. Tübingen hat zu den „größeren Maßnahmen“ jeweils Bürgerbefragungen durchgeführt, um die Akzeptanz einzuschätzen. Marburgs Klimaprogramm enthält interessante „best-practice“-Links bei fast allen Maßnahmen.
Wie geht es weiter?
Ein Klimaschutzprogramm ist prima und eine (fast) unverzichtbare Grundlage, stellt aber in der Regel nur den Rahmen für konkrete Maßnahmen dar. Diese müssen nach und nach sowohl ausformuliert als auch mit inhaltlichen und haushaltswirksamen Beschlüssen hinterlegt werden. In Krefeld läuft dieser Prozess erst an. Wie weit andere Kommunen da sind, bleibt einer weiteren Analyse überlassen. Städte die Klimaschutz ernst nehmen erkennt man aber schon an „ernsthaften“ Investitionen (z.B. Ausstattung von Förderprogrammen, Investitionszuschüssen, Strukturbeschlüssen etc.).

Wie im letzten Blog dargestellt, schlägt das Gutachten „KrefeldKlimaNeutral 2035 (KrKN35)“ zahlreiche Maßnahmen vor, die Treibhausgasemissionen in Krefeld reduzieren – zum Teil in beträchtlichem Ausmaß. Gerade die wirksamsten Maßnahmen scheinen aber auch sehr teuer. Die zum Teil sehr hohen Zahlen führten mancherorts zu Schreckreaktionen. Um zu vermeiden, dass die Empfehlungen des Gutachtens durch Missverständnisse unnötig in Verruf geraten, hier ein paar Erläuterungen dazu.
Zuwarten in jedem Fall teurer!
Vorauszuschicken ist, dass es, global gesehen, mit jedem Jahr des Aufschiebens der Ausgaben teurer wird. Perfiderweise könnte man allerdings darauf hoffen, dass die Ausgaben dann nicht in Krefeld sondern vielleicht in New York (Hochwasser), Italien (Dürre) oder Bangladesh (Überschwemmungen) anfallen. Davon abgesehen, dass derartiges „Trittbrettfahren“ die Augen vor dem Leid in der Welt (und bei uns) verschlösse, steigen auch bei uns in Krefeld die Kosten mit jedem Zögern, wie im Folgenden stichpunktartig gezeigt werden soll.
Vorausgeschickt werden muss aber auch, dass es sich bei den Zahlen im Gutachten „KrKN35“ noch um sehr vorläufige Schätzungen handelt, die in weiteren Ausarbeitungen noch deutlich konkretisiert werden müssen. Man darf also keinen Betrag auf die Goldwaage legen und die Rechnungen in der Folge sind auch nur als grobe Schätzungen zu betrachten.
Wer wird eigentlich „zur Kasse“ gebeten?
Wenn man die Beträge, die über die 12 Jahre bis 2035 benötigt werden, aufschlüsselt, so werden von den in der Presse schon erwähnten geschätzten „Gesamtausgaben“ von 33,5 Milliarden Euro 30,7 Milliarden Euro (d.h. über 90%) von Privatpersonen und der privaten Wirtschaft zu tragen sein. Die städtischen Betriebe werden ca. 2,8 Milliarden Euro investieren müssen (ca. 8,3%), die Stadt selbst ca. 226 Millionen Euro (ca. 0,65%).
Was bekommen wir für das Geld?
Es ist ganz wichtig festzustellen, dass es sich bei einem Großteil der Ausgaben um Investitionen handelt – nicht nur in eine klimafreundlichere Welt, sondern auch für spätere Ersparnisse. Viele Ausgaben „rechnen“ sich dabei schon nach 2-5 Jahren, z.B. Ausgaben für Energiemanagementsysteme für städtische Gebäude und KBK oder für allgemeine Energiesparmaßnahmen (Geräte etc.) im Stadtkonzern oder in der Wirtschaft. Auch die für Energiesparmaßnahmen bei Privatpersonen angesetzten 110 Mio. Euro Gesamtausgaben werden sich in ca. 6 Jahren amortisiert haben. Wäre es nicht dumm, den Gewinn nicht einzustreichen?
Vieles sind langfristige Investitionen z.B. in die Strom- und Wärmenetze (Ausbau Fernwärme, Stromnetze, Tiefengeothermie, Großwärmepumpen) mit Abschreibungszeiten von z.T. mehr als 40 Jahren.
Ein Großteil der vorgeschlagenen Ausgaben rechnen sich also früher oder später durch vermiedene Kosten. Aber auch manchen Ausgaben, die sich nicht unmittelbar im Geldbeutel rechnen, „rechnen“ sich durch gleichzeitige Wohlstands- oder Sicherheitsgewinne (jenseits der Klimawirkung), z.B. manches Verkehrsmanagement und Logistikkonzept, Verkehrsberatung in Schulen.
Wie schon im letzten Blog erläutert, sind insbesondere im Bereich „strategische, übergreifende Maßnahmen“ zahlreiche Maßnahmen in ihrer kostensparenden Wirkung nicht seriös konkret bezifferbar. Sie sind aber dennoch für die Erreichung des Gesamtzieles unverzichtbar.
Manche Ausgaben können ohnehin nicht vermieden werden
Manche Investitionen werden von europäischer, Bundes- und Landgesetzgebung erzwungen. Sie stehen also als unvermeidbare Ausgaben im Gutachten. Z.B. ist mit zunehmender überregional angestrebter Elektrifizierung des Lebens ein Ausbau der Strominfrastruktur kaum zu vermeiden (immerhin ein Posten von 250 Mio. Euro). Oder die Stadtwerke sind verpflichtet, schrittweise neue Busse zu kaufen, die zunehmend regenerativ betrieben werden. Ein Austausch fossiler Heizsysteme wird mittelfristig nicht nur wirtschaftlich sinnvoll sein, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben usw.. Für Köln haben Gutachter errechnet, dass von 41 Mrd. Gesamtkosten 27 Mrd. (65%) auch im "Trendszenario" ohne beschleunigende Klimaschutzmaßnahmen notwendig gewesen wären.
Welches ist der größte Einzelposten?
Den mit Abstand größten Betrag werden private Bürger und Wirtschaftsbetriebe für die energetische Sanierung ihrer Wohnungen, Häuser und Betriebsstätten ausgeben, nämlich 30 Milliarden Euro (über 12 Jahre verteilt, wohlgemerkt). Gleichzeitig ist dies aber auch eine der mit Abstand wirksamsten Einzelmaßnahmen des Gutachtens zu Treibhausgasminderung.
Bei der Analyse ist Vorsicht angesagt: Die Zahl wird im Gutachten KrKN35 bewusst als vorläufig bezeichnet. Auf die notwendige Konkretisierung im Rahmen der Krefelder Wärmeplanung, die ja in Kürze begonnen wird, wird ausdrücklich verwiesen. Dort wird sich erweisen, wie hoch die Ausgaben wirklich geschätzt werden müssen (andere Städte setzen sie z.T. deutlich niedriger an) und wie viele zukünftige (Heiz-)Kosten den Bürgern dadurch erspart werden.
München hat bereits 2021 einen sehr umfassenden Wärmeplan erstellt (https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:37abd6b3-1684-4853-8b5a-2c9ff0313fbc/Klimaneutrale-Waerme-Muenchen.pdf ). Dort werden z.B. Sanierungskosten, Sanierungsbreite, Sanierungstiefe und Sanierungsgeschwindigkeit sehr viel detaillierter analysiert. Auch die Maßnahmen werden viel genauer beschrieben und damit bezifferbar. Für München ergibt sich das Fazit, dass es deutliche Einsparungen der Gebäudenutzenden und auch der Stadt München gegenüber dem Referenzszenario ohne ausreichende Sanierungsmaßnahmen geben wird. Auch die sozialen Effekte seien positiv. Es gibt guten Grund zu hoffen, dass beides auch für die Krefelder Wärmeplanung gelten wird.
Zusätzlich gibt es ja auch noch Fördermittel
Bei vielen Posten des Gutachtens KrKN35 sind überregionale Fördermittel bereits eingerechnet. Bei manchen aber nicht oder nur teilweise; da kann sich also der auszugebende Betrag noch vermindern. Besonders für den großen Posten der energetischen Sanierung wird es zusätzliche Fördermittel geben, die zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung noch unzureichend definiert waren. Diese werden zur Wirtschaftlichkeit der individuellen Ausgaben beitragen. Auch die europaweite steigende CO2-Bepreisung wird Unterlassungen (z.B. Erhalt alter Gasheizungen, siehe Blog 29) teuer und Klimaausgaben wirtschaftlich immer sinnvoller machen.
Riesiges Wirtschaftsförderungsprogramm
Aktuell verlässt praktisch jeder Euro, den wir für Öl, Gas oder Strom ausgeben, die Region. Durch Umsetzung des Gutachtens KrKN35 werden wir einen Großteil der Gelder in der Region halten können. Dämmung, Fernwärme, Bau und Wartung von Solaranlagen, lokale Stromproduktion, Energiemanagement, öffentlicher Verkehr, lokales Recycling von Rohstoffen („Circular Economy“) und vieles andere nutzt lokalen Wirtschaftsbetrieben. Es wird die Aufgabe kreativer Politik sein, möglichst viel von diesem (Wirtschafts-)Potential zu heben. Der Erfolg wird am größten sein, wenn alle ihre wertvollen konstruktiven Ideen dazu beisteuern und möglichst wenig auf die Bremse treten.

Wie im letzten Blog verkündet, liegt nun das komplette Gutachten „KrefeldKlimaNeutral 2035 (KrKN35)“ vor. Bei erster Lektüre fällt auf, dass es sich kaum von vergleichbaren Gutachten anderer Städte (z.B. Bonn, Wuppertal, München, Freiburg etc. – siehe auch Blog 11) unterscheidet. Alle fußen auf ähnlichen Grundannahmen, alle empfehlen umfassende Umstrukturierungen in allen energierelevanten Bereichen, alle betonen die kurze verbleibende Zeit, die erfordert, praktisch alle Maßnahmen gleichzeitig einzuleiten, alle empfehlen im Wesentlichen die gleichen Maßnahmen und alle betonen, dass zukünftige Kosten aller Art erspart werden. Das ist nicht verwunderlich, denn die Rahmenbedingungen sind überall in etwa gleich. Krefeld befindet sich also in guter Gesellschaft.
Leider aber gibt es keine vergleichbaren Städte in Deutschland, die schon sehr viel weiter wären, so dass wir davon lernen könnten (Städte in anderen Ländern sind in Teilbereichen voraus, haben aber auch andere Rahmenbedingungen). So können wir zwar zusehen, was andere parallel entwickeln; komplette Erfolgsgeschichten kopieren können wir aber nicht. Wir müssen wagen, unseren eigenen Weg zu gehen. Dass viele den gleichen Weg gehen wollen, sollte uns aber ermutigen. Er kann nicht ganz falsch sein.
Was empfiehlt das Gutachten inhaltlich?
Wie schon in Blog 33 kurz angerissen, gliedern sich die Handlungsempfehlungen in vier Bereiche: Wärmewende, Stromwende, Verkehrswende und „strategische, übergreifende Maßnahmen“. Alle Bereiche müssen in Angriff genommen werden, wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen. Alle 57 in den Steckbriefen detaillierten Einzelmaßnahmen sind wichtig. Weitere Maßnahmen werden voraussichtlich noch im Verlauf als notwendig erkannt werden. Wer sich umfassend informieren will: Alle Teile des Gutachtens sind abrufbar unter https://ris.krefeld.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZV6htEDNuOwBNhipPRnVWFQ (ris.krefeld.de: Vorgang 5224/23 suchen).
Wo liegen die größten Treibhausgas-Einsparpotentiale?
Vorauszuschicken ist, dass in Krefeld fünf Großbetriebe angesiedelt sind, die mit Ihren CO2-Emissionen vom europäischen Emissions-Handelssystem (ETS) erfasst werden und unter diesem auch „gezwungenermaßen“, ihre Emissionen ausschleichen müssen. Da hier städtische Maßnahmen nicht greifen werden, werden diese Betriebe im Gutachten KrKN35 nicht berücksichtigt. Sie stellen mit deutlich über 25% der Krefelder CO2-Emissionen (über 500.000 t) einen beträchtlichen Teil des Reduktionspotentials.
Ohne diese ETS-Betriebe produzierte Krefeld im Jahr 2022 insgesamt 1,56 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente (d.h. pro Kopf 6,86 Tonnen).
Wie schon in Blog 8 und 25 dargestellt, werden in Krefeld im Wärmebereich 66% der Endenergie benötigt und 52% der Treibhausgas-Emissionen verursacht. Es wundert also nicht, dass hier auch die mit Abstand größten Einsparpotentiale liegen:
- Decarbonisierungsmaßnahmen auf Quartiersebene (Effizienzsteigerung, Abwärme aus der Industrie, Umweltwärme etc.) können 450.000 Tonnen CO2 vermeiden.
- Kompletter Austausch des Erdgases im Netz gegen Wasserstoff würde 440.000 t CO2 vermeiden (wobei hier Fragezeichen wegen Kosten und Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff – siehe Blogs 14, 14, 29 - und unklarer Bilanzzuordnung bestehen).
- Durch energetische Sanierungsmaßnahmen im privaten Bereich (v.a. Dämmung und technische Modernisierung) können 308.200 Tonnen CO2 eingespart werden.
Diese drei Maßnahmen liegen weit vor allen anderen im Gutachten quantifizierten Maßnahmen und stehen damit für gut die Hälfte des gesamten Reduktionspotentiales. Sie gehören allerdings auch zu den teuersten Maßnahmen (siehe Blog 35, folgt). Alle drei werden im Rahmen der bald beginnenden Erarbeitung des Krefelder Wärmeplanes (siehe Blog 9) noch viel detaillierter ausgearbeitet werden müssen, wobei sich noch deutliche Verschiebungen der Einsparpotentiale ergeben können.
Weitere größere Potentiale
Weitere größere Treibhausgaseinsparungen (je zwischen 60.000 und 19.000 t CO2) sind zu realisieren durch privates Stromsparen, Ausbau der Fernwärme, Energieoptimierung privat und Wirtschaft, Ausbau der Solarenergie, Energiesparen im Stadtkonzern, Decarbonisierung der Fernwärme, Ausbau des öffentlichen Personen-Nahverkehrs, Radverkehrskonzept, Parkraumkonzept, Mobilitätsstationen. Zusammen sparen diese neun Maßnahmen bei kompletter Realisierung weitere ca. 300.000 t CO2 ein.
Auch die übrigen 45 Maßnahmen des Gutachtens liefern wichtige Beiträge zur Erreichung des Neutralitätszieles, wie man schon daran ablesen kann, dass die gerade aufgeführten Maßnahmen in der Summe das Gesamtziel noch nicht erreichen (auch weil teilweise Überschneidungen bestehen).
Wichtig sind dabei vor allem auch die 14 „strategischen, übergreifenden Maßnahmen“ (z.B. Kommunikationsstrategie, Beratungs- und Förderangebote, Ablauf- und Satzungsoptimierung), denen überwiegend (noch) keine bezifferbaren Einsparpotentiale zugeordnet werden können, die aber zur Erreichung des Gesamtzieles unverzichtbar sind.
Berücksichtigt werden muss auch, dass z.B. der Ausbau der Photovoltaik und der Windenergie zwar große Einsparpotentiale freisetzt, die aber aus Bilanzierungsgründen (Strom fließt frei im Netz) nicht voll in die Krefelder Bilanz eingerechnet werden können.
Einfach beschließen, umsetzen und fertig?
Wäre schön, ist aber nicht so einfach. Das Gutachten ist sehr hilfreich als Impulsgeber, Richtungsgeber und Rahmen für die weitere Arbeit: Es darf kein wichtiger Bereich vergessen werden. Verbindungen zwischen Bereichen müssen bedacht werden. Manche Maßnahmen müssen vor anderen begonnen werden, damit sie wirksam sind. Ganz viele Bereiche müssen aber noch detailliert bearbeitet werden, um in der Praxis umsetzbar zu sein (vor allem die Wärmeplanung ist vordringlich!). Das Gutachten kann insofern auch nur als rahmengebender Kompass von der Politik beschlossen werden.
Die konkreten Beschlüsse, die dann vor allem die wichtigen Haushaltsmittel für Maßnahmen und Personal beinhalten, werden einzeln verhandelt und in den nächsten Monaten und Jahren beschlossen werden müssen. Dass alle diese zukünftigen Beschlüsse aber wichtig für die Erreichung des Gesamtzieles sein werden, wird mit der Zustimmung der Politik zu Zielen und Richtung des Gutachtens vereinbart. Diese grundsätzliche Bereitschaft zu ausreichendem Klimaschutz, die so elementar für die Vermeidung zukünftigen Leides auf der Welt aber auch in Krefeld (z.B. Hitzetote) ist, kann dann Jahr für Jahr bei den Haushaltsberatungen und anderen Beschlüssen in Erinnerung gerufen werden.

Der Rat der Stadt Krefeld hatte ursprünglich am 23.6.2020 das integrierte Klimaschutzkonzept „KrefeldKlima 2030“ beschlossen, welches Klimaneutralität bis 2050 zum Ziel hatte. Aufgrund der fortschreitenden wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Notwendigkeit schnelleren Handelns und unter dem Eindruck der massiven Klimaproteste der Jugend bundesweit – und auch in Krefeld - beschloss der Umweltausschuss der Stadt am 18.2.2021, ein Gutachten zu beauftragen, welches ermitteln sollte, was notwendig wäre, um Krefeld bereits 2035 klimaneutral zu machen: „KrefeldKlimaNeutral 2035 (KrKN35)“. Nach Vortrag vorläufiger Ergebnisse Ende 2022, wurde das komplette Gutachten jetzt am Donnerstag, den 28.09.2023 dem Umweltausschuss vorgelegt. Es soll im nächsten Schritt in einer Sondersitzung des Umweltausschusses in etwa einem Monat als Handlungsrahmen für den Klimaschutz in Krefeld beschlossen werden.
Woraus besteht das Gutachten?
Das Gutachten baut auf dem vorliegenden Klimaschutzkonzept „Klima 2030“ auf. Die dort bereits vorgeschlagenen Maßnahmen werden überprüft und meistenteils verschärft im Hinblick auf das Ziel, bereits 2035 klimaneutral zu werden. Die einzelnen Teile des Gutachtens können aufgerufen werden unter: https://ris.krefeld.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZV6htEDNuOwBNhipPRnVWFQ
Teil A (39 Seiten) gibt eine Zusammenfassung. Teil B (118 Seiten) erläutert die notwendigen Aktionsfelder in den Bereichen Stromwende, Wärmewende und Verkehrswende. Es werden jeweils die Ausgangslage, die Potentiale und Szenarien vorgestellt. Teil C (40 Seiten), das Handlungskonzept, beschreibt Einzelziele und die dafür notwendigen Maßnahmen.
Darüber hinaus gibt es Anhänge zum Krefelder CO2-Restbudget, Klimafolgekosten, lokaler Wertschöpfung und zur Reduzierung des konsumbedingten Fußabdruckes. Schließlich gibt es eine sehr hilfreiche, detaillierte und mit allen Beteiligten abgestimmte Liste (126 Seiten) von Steckbriefen, die 57 konkrete Einzelmaßnahmen umsetzungsorientiert formulieren.
Die Ausgangslage
Laut Gutachten seien von 2017 bis 2021 die Treibhausgasemissionen der Krefelder geringfügig gesunken (von 7,93 auf 6,86 Tonnen pro Einwohner pro Jahr). In der Aufstellung nach Anwendungszwecken haben die Emissionen aus dem Endenergieeinsatz für Wärmezwecke mit 53% eindeutig den größten Anteil (Mobilität 17%, Strom 28%). Im Strombereich sanken die Emissionen in den letzten Jahren am deutlichsten durch den bundesweit zunehmenden Einsatz von regenerativen Energiequellen. In allen Bereichen reichen die Reduktionen aber bei weitem nicht aus, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen. Sie erfüllen in allen Bereichen, außer der Reduktion des Heizölverbrauches, nicht einmal die Vorgaben des Klimaschutzkonzeptes „Klima 2030“.
Krefelder CO2-Restbudget
Wenn man das Ziel zugrunde legt, die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten, darf nur noch eine bestimmte berechenbare Restmenge CO2 in die Atmosphäre gelangen. Umgerechnet auf die Bevölkerung von Krefeld dürfen hier (ab 2022) nur noch 4.577.204 t CO2 emittiert werden, um 1,5 Grad mit 67% Wahrscheinlichkeit nicht zu überschreiten. Mit dem gegenwärtigen Verbrauch ist dieses Budget in 3,2 Jahren (also Mitte 2025) verbraucht. Wir müssen also so schnell wie möglich handeln.
Was muss geschehen?
Krefeld muss laut Gutachten den Energieverbrauch reduzieren und in allen Bereichen so gründlich wie möglich auf regenerative Energiequellen umstellen. Verfügbar seien in Krefeld: Solarenergie, Windenergie, Tiefenwärme, Umgebungswärme - und die Müllverbrennungsanlage.
Bisher machten regenerative Energien (unter Einrechnung der Müllverbrennungsanlage) bei der Wärmeerzeugung in Krefeld nur 12% aus, beim Strom 19%.
Die Wärmewende sei das zentrale Thema, das umgehend angegangen werden sollte. Der Wärmeverbrauch müsse gesenkt werden (Dämmung etc.) und die Wärmequellen „vergrünt“ werden (die Heizungen, die Fernwärme etc.). Details dazu müsse der „Wärmeplan“ (siehe auch Blog 8) erarbeiten (erfreulicherweise steht dieser in Krefeld schon kurz vor der Beauftragung).
Beim Strom könne die bilanzielle Eigendeckung aus regenerativen Quellen bis 2035 auf 49% gesteigert werden; dazu Ausbau der Photovoltaik (Dächer, Freiflächen) auf über 400 MWp und der Windenergie auf über 16,5 MW. Für die übrigen 51% müssten wir auf Vergrünung des bundesweiten Stromes hoffen.
(Informationen zu weiteren im Gutachten vorgeschlagenen Maßnahmen wird es in weiteren Blogs geben).
Hemmnisse
Im Gutachten werden aber auch Hindernisse benannt: Schwierig zu mobilisieren seien vor allem die beträchtlichen Finanzmittel, die weit überwiegend von Privatpersonen und der Wirtschaft, aber auch von der Stadt aufgebracht werden müssen. Zudem müssten soziale Folgen bedacht werden (Auswirkung auf Mieten, Mobilität etc.). Die Gutachter bescheinigen, dass es eines „erheblichen politischen Willens“ bedarf, ausreichende Maßnahmen zu ergreifen, um auch nur in die Nähe des 1,5 Grad-Zieles zu gelangen.
Entsprechend meldeten sich auch bei der Vorstellung des Gutachtens im Umweltausschuss zunächst die Bedenkenträger: „Wer soll das alles bezahlen?“, „die Bürger gehen auf die Barrikaden“, „werden Anschlusszwänge nötig?“, „die Maßnahmen sind nicht konkret genug formuliert“ etc....
Besser jetzt freiwillig investieren als später notgedrungen
Deshalb hier die Bitte, sich nicht von Zahlen erschrecken lassen! Klar ist ohnehin: Je länger wir warten, um so teurer werden die notwendigen Maßnahmen und die Bekämpfung der Klimafolgen. Ersparen können wir uns die Ausgaben nicht. Auch das Gutachten rechnet das vor.
Die „großen Zahlen“ dürfen aber vor allem nicht als „sinnlose“ Kosten betrachtet werden: Es sind überwiegend hochgradig sinnvolle Investitionen, die sich großenteils rechnen: Das Geld für die Dämmung beispielsweise (die sogar noch gefördert wird) müssten die Bürger ungedämmter Häuser sonst später ohnehin für überhöhten Heizmittelbedarf ausgeben. Das zu vermeiden wiederum ist lokale Wirtschaftsförderung (denn Öl und Gas kommen aus dem Ausland, die Dämmung installieren jedoch lokale Betriebe). Das Gutachten liefert auch dazu Anhaltszahlen. (In weiteren Blogs werden diese auch hier näher noch analysiert werden).
Klimaschutz als Chance und prioritäre Aufgabe begreifen
Schon das eine Beispiel der Dämmkosten zeigt: Man sollte den Klimaschutz in Krefeld besser als riesige Chance begreifen. Wie können wir die Bürger und die anderen Beteiligten motivieren und unterstützen, bei diesem Wirtschaftsprogramm mitzumachen, das "nebenbei" auch noch „die Welt rettet“? Hier ist viel Raum für politische Kreativität.
Das Gutachten gibt den notwendigen Rahmen und viele erste Schritte vor. Es ist eine gute Grundlage für die weitere Arbeit. Viele Details werden im Verlauf noch geklärt bzw. erarbeitet werden müssen. Aber selbst Dissens in Einzelpunkten darf den Gesamtelan nicht bremsen!
Die Motivation bei den Mitarbeitern von Stadt und Betrieben ist da und die Zusammenarbeit (z.B. Stadt – SWK) funktioniert auch immer besser. Jetzt sollte auch noch die Politik und die Stadtführung den Klimaschutz als prioritäre (!!!) Aufgabe begreifen und offensiv vertreten, dann können wir viel bewegen und unseren Kindern eine weniger gefährliche Welt hinterlassen.
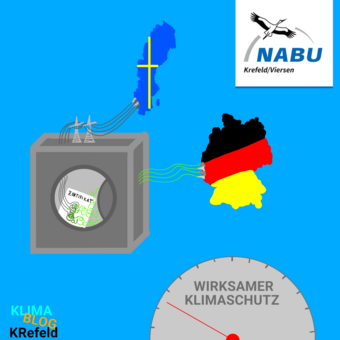
Neben dem „24/7-Problem des Ökostromes“, welches im letzten Blog (Blog 31) beschrieben wurde, gibt es auch einige Fragezeichen, welchen Nutzen „Ökostromangebote“ für die Energiewende haben.
Was ist Ökostrom?
Unter Ökostrom wird in der Regel Strom verstanden, der zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen stammt.
Es ist aber nochmals darauf hinzuweisen, dass der Strom aus der Steckdose immer eine Mischung ist, die bundesweit in etwa gleich ist. Man kann aber durch die Auswahl des Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmens (EVU) und des bezogenen Stromproduktes beeinflussen, welche Art von Strom in das allgemeine Netz eingespeist wird.
Der Prozentsatz der Ökostromkunden in Deutschland liegt knapp über 20%. In Krefeld beziehen laut SWK sogar rund die Hälfte der Stromkunden Ökostromprodukte.
Die Kennzeichnungspflicht soll beim Durchblick helfen
Viele EVUs bieten vertraglich „Ökostromprodukte“ an (oft mehrere). Wie diese sich zusammensetzen, kann man der Stromkennzeichnung des entsprechenden Produktes entnehmen, welche das EVU dem Endverbraucher anzeigen muss, z.B. die SWK: https://www.swk.de/de-de/mein-direkt/stromkennzeichnung .
Wie man sehen kann, setzt sich das Grünstromangebot der SWK zusammen aus
- „Erneuerbaren Energien, finanziert aus der EEG-Umlage“ (42,83%) sowie
- „Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage“ (57,17)%.
Warum zwei Arten von erneuerbaren Energien?
Das „Erneuerbare Energien Gesetz“ (EEG) fördert in Deutschland seit Jahrzehnten den Ausbau von erneuerbaren Energien durch eine Vergütung des eingespeisten Stromes, die (bis zum 1.7.2022) auf alle (kleinen) Endverbraucher umgelegt wurde und nun aus dem Bundeshaushalt bezahlt wird. Fast allein dadurch wurde der Ausbau umweltfreundlicher Energien entscheidend vorangebracht. Strom aus EEG-geförderten Anlagen muss in der Stromkennzeichnung separat von anderem Ökostrom ausgewiesenwerden, da er ja über eine öffentliche Umlage gefördert wurde und von den Stromversorgern nicht als eigenes Produkt verkauft werden darf (neuerdings allenfalls als „Regionalstrom“, wenn er aus Anlagen im Umkreis von 50 km stammt).
Die übrigen ausgewiesenen „Erneuerbaren Energien“, die nicht über die EEG-Umlage finanziert wurden, stammen z.B. aus Eigenanlagen der Stromversorger, die ohne EEG-Förderung errichtet wurden oder anderen Quellen. Es muss aber für jede verkaufte Megawattstunde beim Umweltbundesamt ein europaweit gültiger „Herkunftsnachweis“ (HKN) entwertet werden, der nachweist, dass dieser Strom tatsächlich aus erneuerbaren Quellen stammte und - durch die Entwertung gesichert - nur einmal verkauft wurde.
Fördert Ökostrombezug die Energiewende?
Grundsätzlich ist es als Willensäußerung und Vorbild sicherlich sinnvoll und das Gewissen entlastend, durch Ökostrombezug deutlich zu machen, dass den Kunden umweltfreundlicher Strom wichtig ist. Führt es aber wirklich zum Ausbau erneuerbarer Energiequellen? Das ist nun sehr unterschiedlich. Unmittelbar wird sicherlich kein Stromversorger für jeden neuen Kunden eine Solaranlage zubauen. Es gibt aber Anbieter, die versprechen, einen festen (kleinen) Prozentsatz des Strompreises in den Neubau von Anlagen zu sprechen. Andere versprechen, dass die Anlagen, aus denen sie den Strom beziehen, ein gewisses Alter nicht überschreiten sollen. Noch andere bemühen sich zumindest nach und nach ihre eigenen regenerativen Kapazitäten auszubauen.
Viele aber nutzen die preiswerteste Möglichkeit: Sie kaufen fossilen Strom und deklarieren ihn durch Zukauf eines Herkunftsnachweises in Ökostrom um. Das ist völlig legal. Es wurde ja irgendwo in Europa eine entsprechende Menge Ökostrom erzeugt, der nun nicht anderweitig verkauft werden kann. (Meist bekommt ein anderer Kunde dann etwas mehr fossilen Strom, weil eben nicht zugebaut sondern nur verschoben wird).
Warum "Skandinavienproblem"?
Aus Deutschland stammen aber nur 13,7% der Herkunftsnachweise (HKN), weil die meisten Betreiber lieber die (höhere) Förderung des EEG genutzt haben. Über 60% der Herkunftsnachweise, die in Deutschland entwertet werden, stammen aus Skandinavien. Dort gibt es unzählige Wasserkraftwerke, die seit Jahrzehnten laufen, längst abgeschrieben sind und sich durch solche Herkunftsnachweise eine kleine Zusatzeinnahme verschaffen. Die Skandinavier können den gleichen Strom dann zwar nicht selbst als Ökostrom kaufen. Das schmerzt sie aber nicht sonderlich, da sie ja wissen, dass der überwiegende Teil ihrer Stromerzeugung bereits regenerativ ist (in Norwegen z.B. schon über 90%).
In gewisser Weise verbrauchen wir hier damit den Wasserkraft-Strom aus Skandinavien und die Skandinavier in Skandinavien unseren Braunkohlestrom – und beide sind zufrieden. Nur für die Umwelt ist es kein Gewinn. Es wird keine regenerative Anlage zugebaut! HKN sind reichlich vorhanden. Die Energiewende wird nicht gefördert – weder hier noch in Skandinavien.
Wie kann ich doch etwas für die Energiewende tun?
Leider ist aus der Stromkennzeichnung nicht ersichtlich, welcher Art der erneuerbare nicht-EEG-Strom eines jeweiligen EVU ist. Eine neu eingeführte Regelung „optional gekoppelter Herkunftsnachweise“ kann die Herkunft aus konkreten lokalen Anlagen bescheinigen. Sie hat sich aber noch nicht weit durchgesetzt und ist auch noch nicht Teil der Kennzeichnung.
Man kann aber Strom von Ökostrom-Anbietern beziehen, die ihren Ökostrom glaubhaft aus hiesigen erneuerbaren Energiequellen beziehen, diese weiter zubauen und aktiv die Energiewende fördern. Es gibt mehrere, unterschiedlich strenge Label, die dies überprüfen und zertifizieren.
Auch die SWK haben bereits zahlreiche eigene Anlagen und bemühen sich ernsthaft um weiteren Zubau. Wie hoch aber der Anteil von Skandinavienzertifikaten noch ist, ist unklar.
Weitere Informationen:
Wer sich detaillierter für Ökostromangebote interessiert, kann z.B. bei der Verbraucherzentrale nachlesen:

Es gibt ein Problem beim Bezug von Ökostrom, welches zunehmend relevant für die Energiewende werden wird, aber öffentlich noch wenig diskutiert wird: Bei einem Ökostrom-Vertrag entspricht das Angebot des Stromversorgers der Nachfrage des Verbrauchers über das Jahr gerechnet – nicht aber zu jedem einzelnen Zeitpunkt (24/7 = 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche).
Vorausgeschickt werden muss, dass Strom ja in aller Regel über das bundesweite Stromnetz bezogen wird, aus dem alle Verbraucher ihren Strom beziehen und in das alle Erzeuger ihren Strom einspeisen. Es werden also viele verschiedene Arten Strom hineingeschüttet, aber es kommt immer eine Mischung von allen heraus. Ökostromverträge sind also nicht Vereinbarungen über den Strom, der bei Ihnen aus der Steckdose kommt, sondern über Art und Menge von Strom, die der Versorger, mit dem Sie den Vertrag haben, in das allgemeine Netz einspeist oder, als Weiterverkäufer, einspeisen lässt.
Wo ist das Problem?
Nehmen wir nun an, Sie verbrauchen 1000 kWh Strom im Jahr und Sie hätten einen Vertrag mit einem Versorger, der Ihnen zusichert, für Sie entsprechend viel Ökostrom einzuspeisen. Und nehmen wir ferner an, der Versorger hätte tatsächlich Solaranlagen, mit der er selbst den Strom produziert (so wie z.B. die SWK Solaranlagen in Krefeld und im Umland besitzen).
Was passiert dann in der Nacht? Die Solaranlagen liefern nachts keinen Strom. Sie ziehen also Strom aus dem allgemeinen Netz, der (noch) zu hohem Prozentsatz aus fossilen Quellen stammt, ohne dass der vereinbarte Ökostrom in das Netz eingespeist wird. Ist das Betrug? Nein, denn der Versorger hat Ihnen nur eine Gesamtmenge versprochen. Er speist also am nächsten Tag, wenn die Sonne scheint, eine größere Menge Solarstrom ins Netz und gleicht damit die Mindermenge der Nacht aus. Wenn alles korrekt läuft, ist in der Summe also bilanziell genau die Menge eingespeist worden, die Sie gebraucht haben. Der Vertrag wurde also erfüllt. Allerdings nicht genau zu dem Zeitpunkt, an dem sie den Strom real verbraucht haben.
Alles in Butter? Nicht ganz: Wenn wir annehmen, dass es nur Sie und ihren Versorger gäbe, wäre, trotz 100% Ökostrom-Vertrages, Klimaneutralität nicht erreicht, da immer noch (nachts) CO2 produziert wird. Regenerative Erzeugungskapazität für die Nacht (oder den Winter) muss der Versorger für Sie laut Vertrag nicht zubauen (lassen).
Google geht voran!
Google hat das Problem erkannt. Schon seit über sechs Jahren bezieht Google „100% seines Stromes“ aus regenerativen Quellen. Über das Jahr bilanziert, kamen aber faktisch (in 2022) nur 64% des Gesamtstromes wirklich Stunde für Stunde aus lokalen regenerativen Quellen, der Rest war noch fossil. 2022 hat Google deshalb die Initiative 24/7 gestartet (https://www.google.com/ about/datacenters/cleanenergy/ ). Google will bis 2030 alle seine Anlagen rund um die Uhr mit jeweils im lokalen nationalen Netz erzeugtem Ökostrom versorgen. Sie wollen so erreichen, dass die lokalen Netze tatsächlich vom Ausbau der regenerativen Energiequellen profitieren und wollen die Glaubwürdigkeitsprobleme von reinen Zertifikatslösungen vermeiden (siehe dazu auch den nächsten Blog).
In manchen Gegenden fällt es leichter - so liegt der Regenerativen-Anteil an Googles Strom in Finnland, Chile und einigen US-Staaten bereits deutlich über 90% - in anderen schwerer: In manchen US-Staaten wurden erst 30% erreicht, in Japan und Singapur erst 20%.
Die letzten Meter werden teuer
Noch etwas stellt Google jetzt fest: Die letzten 30% Ökostrom zur Erreichung des 24/7-Zieles zu bekommen wird mindestens noch einmal so teuer sein, wie die ersten 70%. Der Grund ist vereinfacht gesagt, dass es dann nicht mehr reicht, in einer Stromlücke (z.B. nachts) den fossilen Generator anzuwerfen, sondern aufwändige Speichermedien (Pumpspeicher, Batterien, Wasserstoff etc.) bzw. Verteilnetze und intelligente Verbrauchssteuerung geschaffen werden müssen. Nur so aber, kann Klimaneutralität wirklich erreicht werden.
Was bedeutet das für Deutschland und Krefeld?
Wie Google wird es auch der Energiewende insgesamt gehen: Die ersten Meter sind leicht. Bonn z.B. will für seine Klimaneutralität ein Restkontingent an Strom als Ökostrom aus dem allgemeinen Netz ziehen (bilanziell im obigen Sinne nehme ich an). Um aber auch nachts die Kohle- oder Gaskraftwerke irgendwann wirklich abschalten zu können bzw. den tagsüber„nachproduzierten“ bilanziellen Ökostrom irgendwie nutzen zu können, müssen dann z. B. Speicher geschaffen werden. Wer wird diese zahlen? Am Ende der Wende könnte Ökostrom plötzlich deutlich teurer werden, besonders für die, die spät kommen und die letzten neuen Verträge machen müssen.
Besser wäre, wir würden heute schon 24/7 denken. Aktuell gibt es keinen Ökostrom-Anbieter, der 24/7 anbietet, dafür fehlen heute noch zu viele Voraussetzungen. Solaranlagenbesitzer könnten immerhin Stromspeicher bauen – die aber nicht über den Winter helfen. Angebotsseitig wären z.B. möglichst viele Windkraftanlagen in Krefeld hilfreich, da sie auch nachts und vor allem im Winter Strom liefern, wenn Solaranlagen schwächeln. Die SWK würden gerne welche errichten. Dazu fehlen aber noch die Standorte. Dass NRW die Abstandsregeln gekippt hat, wird neue Möglichkeiten eröffnen. Für die (Wind-)Flauten wird man intelligente Steuerung des Verbrauches und Speicher installieren müssen...... es gibt viel zu bedenken und zu tun.
Auch bei den Bilanzen für Krefeld im Rahmen des Klimaneutralitätsprojektes KrKN35 sollten wir dieses Problem zumindest im Hinterkopf haben. Wir sollten es nicht einfach bilanziell "wegrechnen".
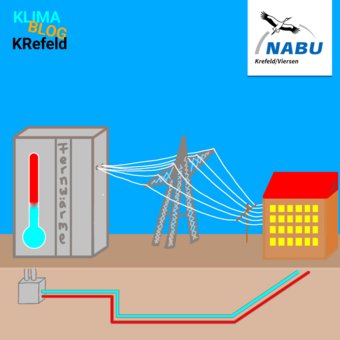
Krefeld hat bereits ein Fernwärmenetz (Karte siehe https://www.swk.de/ privatkunden/dienstleistungen/waerme ). Das ist sehr erfreulich! Es wird uns helfen, die Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen. Wie bereits in Blog 25 „Fernwärmeausbau starten“ dargelegt, hat die Fernwärme gerade in verdichteten Innenstadtbereichen große Vorteile.
In diesen Tagen (August 2023) hat die Stadt die Förderzusage für die Erstellung eines „Wärmeplanes“ bekommen. Die Erstellung wird jetzt ausgeschrieben und der Plan soll bis Ende 2024 fertig werden - schneller als die Bundesregierung vorschreiben wird (Mitte 2026). Die frühzeitige Erstellung wird den Bürgern helfen, die richtigen Entscheidungen für die Heizung ihrer Wohnungen zu treffen (siehe auch Blog 29). Es soll z.B. festgelegt werden, in welchen Straßen zukünftig Fernwärme angeboten werden wird.
Es stellt sich die Frage: Wie stark soll das Fernwärmnetz ausgebaut werden?
SWK und NGN haben für die Planungen die meisten Grundlagendaten. Die Politik und Stadt wollen den Rahmen setzen. Alle werden sich diese Frage stellen müssen.
Aktuell versorgt das Fernwärmenetz in Krefeld ca. 8.500 Haushalte mit Wärme d.h. 7% aller 120.000 Krefelder Haushalte. Laut Daten des Gutachtens KrKN35 sind dies in Krefeld derzeit 11% der Gesamt-Heizwärmemenge.
Bundesweit werden 6 Mio. von 42 Mio. Haushalten mit Fernwärme versorgt, was 14% entspricht.
Was sagen die Gutachten bundesweit?
Auf Bundesebene gibt es fünf große Studien („Big Five“), die sich mit der Frage beschäftigen, wie Deutschland bis 2045 klimaneutral werden kann. Sie äußern sich alle nur sehr knapp zu der Fernwärmefrage. Ihre Vorhersagen für Veränderungen bis 2045 (laut Vergleichsstudie https://www.stiftung-klima.de/app/uploads/2022/03/2022-03-16-Big5_Szenarienvergleich_final.pdf) liegen bis auf zwei Ausreißer (+100% und -16%) nahe beieinander bei einem Zuwachs von +23% - bezogen auf die absolute Fernwärmemenge.
Die Zuwächse der damit versorgten Haushalte weichen z.T. stark ab – je nachdem wie stark der Energiebedarf der Einzelhäuser durch Dämmung abnimmt. So rechnet sogar die DENA-Studie, die bis 2045 ein Minus von 16% in der Wärmemenge rechnet, mit einem Plus von 43% bei den versorgten Haushalten.
Was sagt KrKN35 für Krefeld?
Das Krefelder Gutachten KrKN35 (zumindest die wenigen bereits öffentlichen Folien dazu, siehe Blog 3 und 13) nimmt (im Szenario ohne Wasserstoffheizung) einen Anstieg der Fernwärmemenge von 230 GWh in 2020 auf 390 GWh pro Jahr bis 2035 an, d.h. um knapp 60%. Da aber durch energetische Sanierung der Gebäude eine Abnahme der benötigten Gesamtwärmemenge um 65% angenommen wird, würde der Fernwärmeanteil prozentual von 11% auf 52% zunehmen. Da eine Halbierung des Energieverbrauches durch Dämmung (insbesondere im Innenstadtbereich) eher unrealistisch erscheint, wird der Anteil deutlich niedriger sein (geschätzt 20-30%).
Wie viele Haushalte das dann rechnerisch sein würden, hängt von der angenommenen Verteilung der Sanierungsmaßnahmen ab. Dazu sagen die „dürren“ Folien nicht genug. Dazu muss man auf das fertige Gutachten warten.
Was machen andere Städte?
Köln will die Fernwärmemenge um 40% steigern. Hannover will eine Versorgung von 60% der Haushalte mit Fernwärme erreichen. Stockholm stellt jetzt bereits 70% der Wärme über Fernwärme bereit. Vergleichbare Anteile erreichen bereits heute auch einige ostdeutsche Städte. Die Zahlen sind alle schwer vergleichbar wegen unterschiedlicher Grundannahmen.
Die AGFW (der „Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V.) hat eine Studie 70/70 erstellt, in der sie einen Zubau des Fernwärmeanteiles auf jeweils 70% für die 70 größten Städte Deutschlands vorschlägt.
Wie geht man in der Praxis vor?
Bei der praktischen Erstellung der Wärmeplanung wird man aber zunächst nicht vom Ziel her denken: Man wird sich jedes Quartier, jede Straße und teilweise jedes Haus einzeln ansehen müssen und entscheiden müssen, welches die optimale Wärmeversorgung sein wird. Im dichten Geschosswohnungsbau der Innenstadt wird das in den meisten Fällen die Fernwärme sein.
Wenn man im Energieatlas NRW die Planungskarte Wärme aufruft (https://www.energieatlas.nrw.de/ site/planungskarte_waerme ), kann man links unter „Wärmeplanung vor Ort“ unter dem Punkt „Wärmenetze“ eine Karte „Wärmeliniendichte“ aufrufen. (Man muss dazu nah genug – Innenstadt bildfüllend - an Krefeld heranzoomen). Dort kann man sehen, wie groß der lokale Wärmebedarf ist. Ganz grob geschätzt dürfte Fernwärme in Straßen mit über 2500 kWh Wärmebedarf pro Straßenmeter pro Jahr wirtschaftlich sein (bei Zusammenlegung mit anderen Sanierungsmaßnahmen, wie Kanal, Straßendecke, Datenleitungen etc. vielleicht noch optimierbar). Wenn man das mit dem bestehenden Wärmenetz vergleicht, dann sieht man, dass in Krefeld viel Luft nach oben besteht.
Mutig voran!
Es wird unterschiedliche Ansichten zu Wirtschaftlichkeit, einzusetzenden Mitteln und tolerierbaren Baumaßnahmen geben. Der NABU hofft aber im Sinne des Klimas auf ein möglichst mutiges Vorgehen.
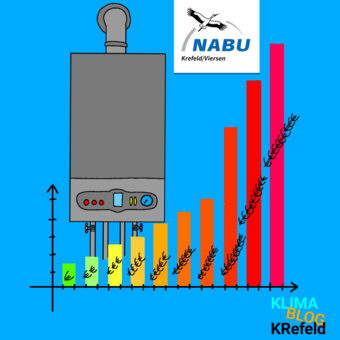
Im Zuge des aktuell heftig diskutierten Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) sind viele Menschen verunsichert. Wenn das Gesetz in seiner jetzigen Form verabschiedet wird, müssen ab 2024 neu eingebaute Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das bedeutet, dass dann im Prinzip, von wenigen Ausnahmen abgesehen, neue Öl- oder Gasheizungen nicht mehr zugelassen sind. Allerdings können bestehende Heizungen auch nach 2024 noch betrieben werden – und zwar bis zu 30 Jahre oder bis sie irreparabel kaputt gehen.
Besser noch schnell eine Ölheizung einbauen?
Wie man hört, überlegt jetzt manch einer, sich noch rasch eine neue Öl- oder Gasheizung einbauen zu lassen, bevor diese nicht mehr zugelassen werden. Dabei wird aber oft nicht bedacht, dass Öl- und Gaspreise in den nächsten Jahren deutlich steigen werden. Der EU-Emissionshandel wird ab 2026 auch die fossilen Heizenergien umfassen und deren Emission begrenzen. Durch die Notwendigkeit stetig weniger werdende Emissionsrechte zu kaufen, wird der Preis für CO2 schrittweise steigen und Öl und Gas beträchtlich teurer machen.
Die Öl- oder Gasheizung wird zur Kostenfalle
Wie das Wirtschaftsforschungsinstitut MMC Berlin jetzt in einer Studie geschätzt hat (https://www.mcc-berlin.net/fileadmin/data/C18_MCC_Publications/2023_MCC_CO2-Bepreisung_Klimaneutralität_Verkehr_Gebäude.pdf ), dürfte bis 2030 der Preis pro Tonne CO2 auf zweihundert bis dreihundert Euro ansteigen. Hochgerechnet kämen damit auf einen durchschnittlichen vier-Personen-Haushalt über zwanzig Jahre zusätzliche (!) Heizkosten von ca. 15.000 bis 16.000 Euro für eine Gasheizung und bis zu 23.000 Euro für eine Ölheizung zu.
Wer also jetzt in eine neue Heizung investieren will oder muss, muss sich im Klaren sein, dass er, zusätzlich zur Anschaffungsinvestition, mit steigenden Zusatzkosten rechnen muss. Auch ist noch völlig unklar, wie die Netzkosten verteilt werden, wenn es irgendwann nur noch wenige Abnehmer im Netz gibt.
Noch riskanter sind Wetten auf Gasheizungen mit „Wasserstoff-Option“. Es ist derzeit sehr unwahrscheinlich, dass zu Lebenszeiten der neuen Gasheizung günstiger Wasserstoff in Breite verfügbar und über die Gasleitungen geliefert wird (siehe Blog 14 und 26).
Was ist die Alternative?
Die Alternative wäre z.B. der Einbau einer Wärmepumpe bzw. der Anschluss an das Fernwärmenetz(welches dazu weiter ausgebaut werden sollte). Auch da kann es Preissteigerungen geben, die aber im Vergleich gering ausfallen sollten, da ja gezielt die fossilen Energien bepreist werden, die bei Strom und Fernwärme einen immer geringeren Anteil ausmachen werden. Zudem gibt es Fördermittel für die Anschaffung einer Wärmepumpe.
Darüber hinaus soll perspektivisch ein Teil der Gelder aus dem Emissionsrechteverkauf an die Bürger zurückfließen („Klimadividende“). Der Besitzer einer Wärmepumpe oder eines Fernwärmeanschlusses streicht diese Gelder ohne entsprechende Heizkostensteigerungen ein.
Empfehlung:
Warten Sie aktuell möglichst mit der Heizungserneuerung bis das GEG verabschiedet ist. Dann sind die Entscheidungsgrundlagen klarer. Drängen Sie dann bei den Sie beratenden Fachleuten nach Möglichkeit auf eine klimafreundliche Lösung ohne fossile Brennstoffe; es dürfte auf längere Sicht in den meisten Fällen die günstigere sein. Ein gutes Gewissen bekommen Sie dann noch als Zugabe dazu!
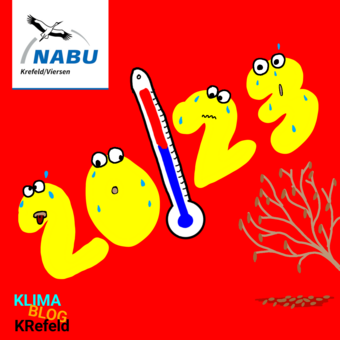
Die klimabezogenen Schlagzeilen der letzten zwei Wochen waren eindrucksvoll und fordern die Welt zum Handeln auf:
Spanien: „Olivenbauern warnen vor einer „katastrophalen“ Saison“
(28.4.2023, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/duerre-in-spanien-olivenbauern-warnen-vor-katastrophaler-saison-18855953.html und andere Quellen): Hitzewelle in Südspanien. Allzeit-Hitzerekord für Mai mit 41 Grad. Seit 100 Tagen kein Niederschlag. Wettermodelle errechneten solche Wetterlagen eigentlich erst für 2043. „Irreversible Verluste“ auf ca. 3,5 Mio. Hektar Anbaufläche erwartet. Andalusien verliert sieben Prozent seiner Wirtschaftsleistung. Weniger als die halbe Ernte von Oliven, Hopfen und Weizen erwartet. Olivenöl schon ein Fünftel teurer.
Südostasien: „Rekordhitze in Südostasien – Vietnam schwitzt bei mehr als 44 Grad“
(9.5.2023, https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/suedostasien-von-hitzewelle-getroffen-mehr-als-44-grad-in-vietnam-18879600.html ): Mit 44,1 Grad die höchste jemals gemessene Temperatur in Vietnam, auf den Philippinen 49 Grad. Die Hitze werde bis August anhalten. Die Regierungen warnen vor Stromausfällen und Gesundheitsschäden bei Aufenthalt im Freien. Die brutale Hitze sei eine Warnung an die Welt – schrieb die Bangkok Post. Die Thailändische Regierung empfiehlt den Bauern des weltweit zweitgrößten Reisexporteurs wegen Wassermangels nur eine Ernte statt zwei einzuplanen – mit der Folge inflationärer Entwicklungen in ganz Asien (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-12/el-nino-may-slash-thai-rice-crop-and-spur-inflation-across-asian-economies ).
Pakistan: „Sommer in Pakistan: 50 Grad Celsius“
(6.5.2023, https://www.zeit.de/2023/19/sommer-pakistan-jacobabad-hitze ): Etwa die Hälfte der 1 Mio. Einwohner von Jacobabad in Südpakistan flieht jeden Sommer vor der Hitze nach Norden. Seit fünfzehn bis zwanzig Jahren nehme dieser Trend zu. Bei 50 Grad (plus Luftfeuchte) werden die Grenzen der Bewohnbarkeit erreicht. „NGOs und Medien bezeichnen Jacobabad deswegen auch als „Ground zero“ des überhitzten Planeten“.
Uruguay: "Trinkwasservorräte in Montevideo reichen noch einen Monat"
(16.5.2023, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/duerre-in-uruguay-trinkwasser-in-montevideo-wird-knapp-18899301.html ). Längste Trockenperiode in der Geschichte des Landes. Ausrufung des Notstandes steht bevor. Stausee nur noch 1/10 gefüllt. Steigender Salzgehalt des Trinkwassers.
Alberta, Kanada: „Notstand für Teile Kanadas ausgerufen“
(7.5.2023, https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2023-05/waldbraende-kanada-alberta-notstand-evakuierungen ). Nach den verheerenden Bränden von 2022 schon wieder 109 Brände, 122.000 ha Land betroffen. Die Temperaturen liegen seit einiger Zeit 10 bis 15 Grad über dem Normalwert. 25.000 Menschen sind geflohen. Ölsandgebiete mit einer Jahresproduktion der Größenordnung von Kuwait liegen im Hochrisikogebiet. - Massive Waldbrände auch in Russland und – ungewöhnlich – im Januar in Kuba.
Sogar der Ozean: „Ozean im Hitzestress“
(4.5.2023, https://www.zeit.de/2023/19/erderwaermung-ozeane-hitze ): Seit Beginn der Aufzeichnungen waren die Weltmeere noch nie so warm wie heute. Der Ozean kann 1000mal mehr Hitze speichern als die Atmosphäre. Deshalb ist dieser Hitzerekord unter allen Temperaturextremen der letzten Jahre besonders bedeutsam.
Im Sommer der Turbo: „El-Nino-Phänomen könnte für Rekordhitze sorgen“
(9.5.2023, https://www.br.de/nachrichten/wissen/mojib-latif-sorgt-el-nino-fuer-rekord-hitze,TdkKyAj ): El-Nino ist ein Wetterphänomen, welches alle zwei bis sieben Jahre auftritt (meist Juni bis August) und weitreichende Auswirkungen auf das Klima weltweit hat. Vereinfacht ausgedrückt kehrt sich zeitweise die Wärmeströmung des pazifischen Ozeans um. Auswirkungen sind vermehrte Regenfälle, Überschwemmungen und Orkane in Südamerika sowie Hitze und Dürre in Südostasien. Die Wahrscheinlichkeit eines El-Nino-Phänomens liegt für diesen Sommer bei 80%.
Was hat Deutschland damit zu tun?
Das Wetter hat uns in den letzten Wochen eher vermehrten Regen beschert – zum Glück noch ohne wesentliche Überschwemmungen und Starkregenereignisse, die mit dem Klimawandel tendenziell zunehmen werden. Der Regen gleicht die ungewöhnliche Trockenheit der letzten Jahre ein wenig aus (leider nur teilweise, nun soll es wieder trocken werden).
Dennoch sind wir aufs engste mit den aktuell von der Hitze betroffenen Ländern verbunden – nicht nur über die steigenden Oliven- und Reispreise. Die Wechselwirkungen gelten weltweit. Unsere hohen Treibhausgasemissionen sind eine wesentliche Triebfeder der Klimaveränderungen weltweit. Umgekehrt führen zunehmend unbewohnbare Bereiche und wegen Dürre aufgegebene Landwirtschaft zu Not und Wanderungsbewegungen. In einigen Jahrzehnten wird zusätzlich auch der Meeresspiegelanstieg Milliarden von Menschen vertreiben. Das wiederum führt zu Unruhen und wirtschaftlichen Auswirkungen, die kein Land verschonen werden.
Und was können wir in Krefeld tun?
Krefeld hat am weltweiten CO2-Ausstoß einen Anteil von einem Zwanzigtausendstel oder 0,005%. Eigentlich gar nicht so wenig, wenn man an die große Zahl von Menschen auf der Erde denkt. Dennoch sagen viele: Da sollen doch erst einmal die „Großen“ anfangen zu vermeiden! Ich will mit dem schon etwas abgegriffenen Bild der Lemminge antworten, die auf eine Klippe zulaufen: Was nützt es, wenn einer stehen bleibt, fragt der einzelne Lemming; es müssen doch alle stehen bleiben!!! Aber wenn er daraus folgert, nicht stehen zu bleiben, erliegt er einem Fehlschluss: Wenn alle stehen bleiben müssen, was muss denn dann wohl (je)der Einzelne tun? Richtig! Er muss stehen bleiben – und zwar ganz!!!
Krefeld bleibt stehen und stoppt den Klimawandel!
Zum Glück haben wir in Krefeld beschlossen, stehen zu bleiben. Bis 2035 wollen wir klimaneutral sein. Das müssen wir mit aller Kraft anstreben. Das wird nicht einfach. Es ist ungewohnt, für Lemminge stehen zu bleiben und es kommt zu Reibung, weil nicht alle gleich schnell bremsen wollen und können.
Es wird Veränderungen bringen (nicht nur Heizungstausch) und Geld kosten. Aber, wie man an den Schlagzeilen zu den immer rascheren Klimaveränderungen sieht, haben wir nur noch wenige Jahre bevor wir das immer knappere Geld nur noch für Schadensbegrenzung ausgeben können und damit alle verlieren.
Vernünftig ist, jetzt massiv umzusteuern und alle verfügbaren Mittel, in Klimastabilität zu investieren und sonstige Projekte erst anzugehen, wenn wir unseren Anteil an der Klimastabilisierung geleistet haben. Ohne stabile Rahmenbedingungen wird es keine stabile Zukunft geben.
Wie wir stabile Rahmenbedingungen schaffen können, wird für Krefeld in Kürze das Gutachten KrKN35 zeigen, welches sich leider immer noch verzögert aber jederzeit erwartet wird. Dann können wir loslegen.
(PS: Dann wird es auch wieder mehr aktuelle Blogs geben).

Im „Krefeld Klimaneutral Newsletter“ der Stadtverwaltung (der übrigens unter https://www.krefeld.de/de/umwelt/krefeldklima-newsletter abonniert werden kann), wurde letzter Tage über den Stand der Krefelder Förderprogramme „Klimafreundliches Wohnen in Krefeld“ und „Umweltfreundliches Leben in Krefeld“ berichtet: Am 28. März 2023 verabschiedete der Rat der Stadt Krefeld die überarbeiteten Richtlinien für 2023. Es werden beispielsweise gefördert: Photovoltaikanlagen, Balkon-PV-Anlagen, Solarwärmeanlagen, Batteriespeicher, Ladestationen (Wallboxen), Wärmepumpen (falls über Ökostrom bzw. Photovoltaik betrieben), Fassaden- und Dachbegrünung, Lastenräder.
Wo gibt es nähere Informationen?
Unter https://www.krefeld.de/klimafreundlicheswohnen bzw. https://www.krefeld.de/umweltfreundlicheslebenkönnen Sie die Einzelheiten der Förderungen erfahren, die Förderrichtlinien einsehen und weitere Informationen erhalten.
Ab wann können Anträge gestellt werden?
Eine Beantragung von Mitteln ist
- ab dem 8. Mai 2023 für „Umweltfreundliches Leben in Krefeld“ und
- ab dem 15. Mai 2023 für „Klimafreundliches Wohnen in Krefeld“ möglich
(wenn die Förderampeln auf „grün“ stehen).
Rasche Antragstellung empfohlen!
2022 konnten mit den Programmen u.a. 459 Photovoltaikanlagen gefördert werden. Erfahrungsgemäß sind die Mittel rasch ausgeschöpft, so dass sich, bei Interesse, eine rasche Antragstellung empfiehlt.
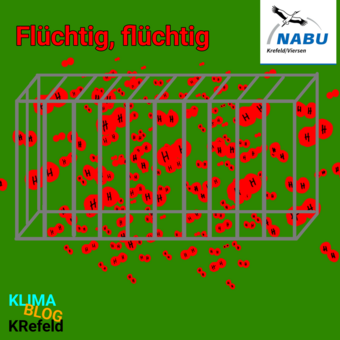
Grüner Wasserstoff muss durch Elektrolyse aus grünem Strom erzeugt werden. Und bis er z.B. in einem Auto benutzt werden kann, muss er zahlreiche weitere Schritte durchlaufen. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich damit der Wissenschaftler und Experte für Brennstoffzellen Dr. Ulf Bossel, der 1976 von seinem Braunschweiger Professor für eine "Wasserstoffwirtschaft" begeistert wurde. 2002 hat er die Energiebilanz der Wasserstoffkette kritisch analysiert. Er erhielt ernüchternde Ergebnisse, die er in englischer Sprache publizierte. Er spricht rückblickend von gesellschaftlichen „Begeisterungszyklen“ für Wasserstoff etwa alle 20 Jahre.
Eine verkürzte Fassung seiner Arbeit wurde 2010 von der Leibnizgesellschaft ins Netz gestellt (www.leibniz-institut.de/archiv/bossel_16_12_10.pdf ). Darin befindet sich z.B. eine Auflistung der Schritte, die von grüner Energie bis zur Wasserstoffnutzung in einem Fahrzeug führen. Dr. Bossel nennt es die „Energievernichtungskaskade der Wasserstoffwirtschaft“ (auch viele andere Autoren kommen zu gleichen Ergebnissen):
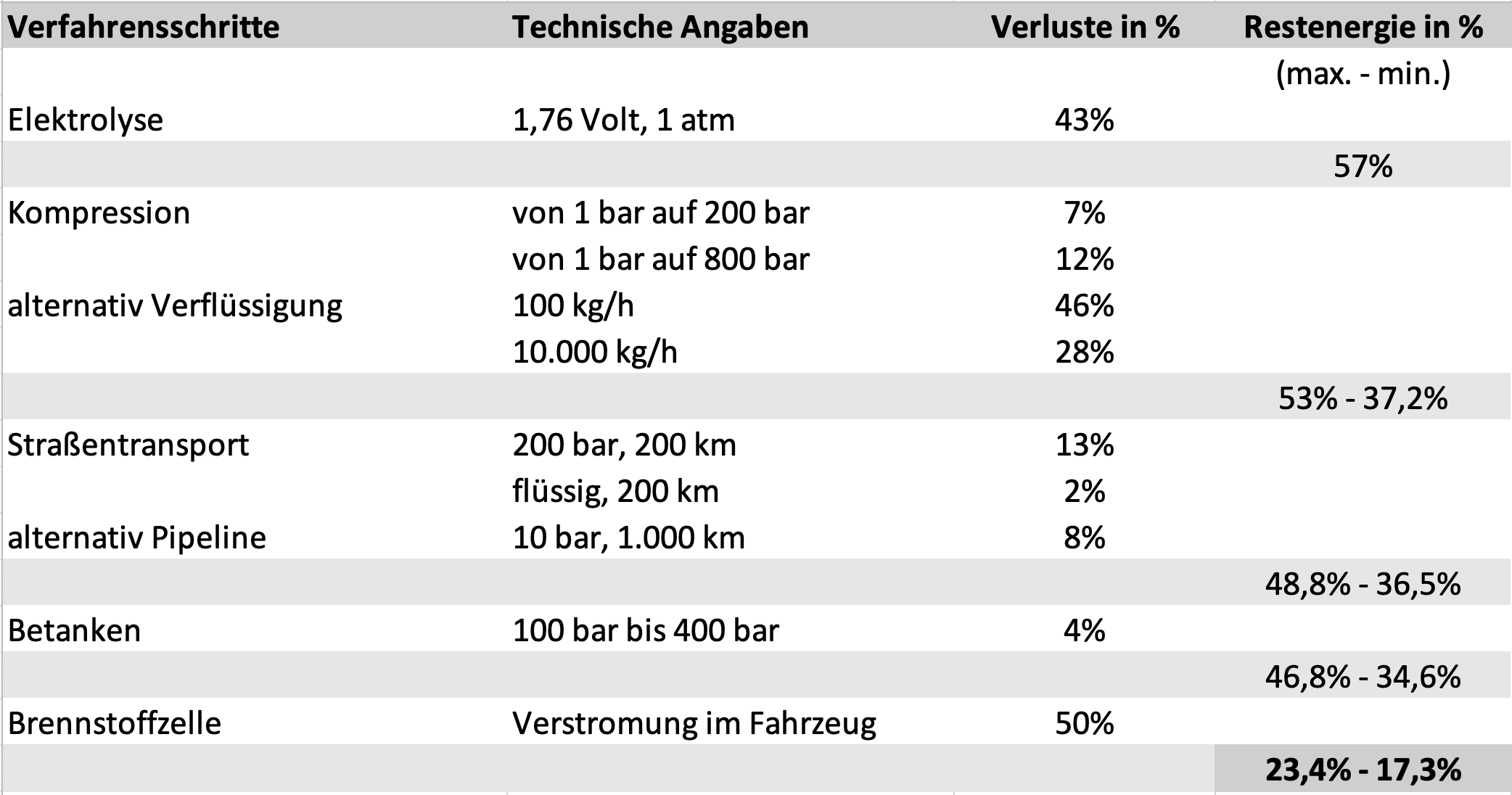
Wasserstoffmoleküle sind zudem ausgesprochen klein und flüchtig.
Entlang der ganzen Kette führt das zu Problemen: Sie verschwinden durch Dichtungen, brauchen spezielle Kompressoren, korrodieren Leitungen (von kleinsten Rissen aus), entschwinden aus undichten Tanks oder beim Transport etc..
Dabei könnte es mit Strom so einfach sein
In einer Stromwirtschaft kommen 90% des initial erzeugten grünen Stromes als nutzbare Energie beim Verbraucher an, bei Wasserstoff nur maximal 25%. Also kann man mit dem Strom, der nötig ist für ein Wasserstoff-Auto, vier Elektroautos betreiben.
Im Umkehrschluss gilt: Für jedes Wasserstoffauto benötigt man die vierfache grüne Erzeugungskapazität (und das, wo wir mit dem Ausbau schon jetzt nicht nachkommen), bzw. man erreicht damit nur ein Viertel der Emissionsminderung.
Will man den Wasserstoff für die Heizung verwenden, kann man mit Strom also vier Wasserstoffhäuser direkt elektrisch beheizen. Beim Einsatz von Wärmepumpen könnte man sogar neun Häuser heizen.
Fazit
Bis Wasserstoff in der Breite in Deutschland genutzt werden kann, sind noch viele Probleme zu lösen. Es wird sich vermutlich erweisen, dass die komplette Umstellung auf Stromwirtschaft vordringlich und zunächst günstiger ist. Sogar die Nutzung als Speichermedium könnte sich (auch z.B. durch neue Batterietechnologien) lange Zeit als unwirtschaftlich erweisen. Erst wenn die Erneuerbarenquote großräumig 80% bis 90% übersteigt (in 15 bis 20 Jahren) und fossile Spitzenlastkraftwerke zunehmend abgeschaltet werden müssen, könnte Wasserstoff als Speichermedium Kosten sparen. Bis dahin treten aber noch so viele Veränderungen ein, dass Prognosen schwierig sind.
Wasserstoff wird jedoch definitiv als Rohstoff in der Industrie gebraucht. Hier sollte der wertvolle „grüne Wasserstoff“ vorrangig zum Einsatz kommen. Dort wird man auch den hohen Preis notgedrungen zahlen müssen und dieser wird mit zunehmender Nutzung sinken. Die Vorbereitung entsprechender Infrastruktur (Pipelines etc.) muss für die Industrie in Krefeld (v.a. Chemie und Stahlproduktion) mitgedacht werden.
Wird jedoch schon vor ausreichender Verfügbarkeit von „grünem Wasserstoff“ auf eine deutlich erweiterte Nutzung gedrängt, könnte es durch die vermehrte Bereitstellung von „andersfarbigem“ Wasserstoff (z.B. aus Erdgas) wegen der obigen Energiekaskade paradoxerweise sogar zu einem erhöhtem Verbrauch fossiler Energie kommen.
Wie gesagt, als Industrierohstoff sowie für spezielle Speicherlösungen, die gut durchdacht werden müssen, wird Wasserstoff sicherlich wertvoll sein. Im Rahmen von Forschungsprojekten und experimentellen Anwendungen können eventuelle Vorzüge weiter entwickelt werden. Ansonsten sollten wir den noch auf Jahrzehnte nur begrenzt verfügbaren „grünen Strom“ lieber direkt nutzen. Wir haben einfach nicht genug davon, um ihn ineffektiv zu verteilen. Dies gilt auch für die Energiewende in Krefeld bis 2035.
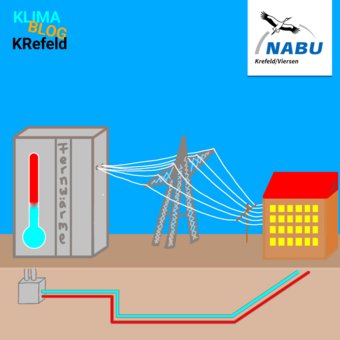
Die Wärmeversorgung steht für rund 65% des Krefelder Energiebedarfes. Ein Wärmeplan soll den Weg zur klimaneutralen Bereitstellung der Wärme beschreiben (siehe Blog 8). Zum Glück hat Krefeld schon ein Fernwärmenetz. Wie sonst sollte umweltfreundliche Wärme in die Innenstadt kommen? In verdichteten Stadtbereichen, insbesondere im Geschosswohnungsbau mit älterem Baubestand oder Einzelfeuerungen in den Wohnungen, sind Wärmepumpen oder Solarwärmekollektoren nicht einsetzbar oder überfordert – insbesondere wenn der Wohnungsbestand noch nicht vollständig saniert ist. Die Kombination von Teilsanierung (z.B. Fenster und Dach) und Fernwärme kann hier ein Zwischenschritt sein.
Fernwärme ist für städtische Energiewenden kaum verzichtbar
Fernwärmenetze sind gut geeignet, erneuerbare Energien und Abwärme kostengünstig und flexibel in die Wärmeversorgung zu integrieren. Durch Skaleneffekte bei Großanlagen (z.B. Tiefenwärme, Solarwärme, Großwärmepumpen) gibt es dabei kostengünstigere Lösungen als bei Nutzung für Einzelgebäude. Moderne Niedrigtemperatur-Wärmenetze sind deshalb sehr hilfreich für die Energiewende.
Gibt es in Krefeld eine Fernwärmeversorgung?
Krefeld hat ein gut ausgebautes Fernwärmenetz mit einer Länge von aktuell 94 km. Zahlreiche Stadtteile sind bereits angeschlossen. Neben der gesamten Stadtmitte sind dies große Teile von Cracau und Kempener Feld/Baackeshof, Dießem, Uerdingen und Gartenstadt, ein Streifen von Bockum entlang der Ost-West-Verbindung Friedrich-Ebert-Straße/Berliner Straße sowie kleinere Bereiche von jeweils benachbarten Stadtteilen. Rund 9.000 Kunden werden mit Fernwärme versorgt. Die Stadtwerke (SWK/NGN) modernisieren das Netz bereits (Senkung der Temperatur, Optimierung der Regeltechnik), um es für die Energiewende fit zu machen.
Woher kommt die Fernwärme in Krefeld?
74,9% der Fernwärme stammt aus der Müllverbrennungsanlage in Elfrath. 25% stammen aus Erdgas, welches in den KWK-Kraftwerken der SWK am Weeserweg und an der Schwertstraße verbrannt wird. Die Stadtwerke Krefeld (SWK) schreiben auf Ihrer Internetseite: „Das Fernwärmenetz der SWK ist nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) zertifiziert worden. Das sehr gute Ergebnis: Bei nur 9,4 Prozent Netzverlusten liegt der Primärenergiefaktor bei 0,23 und der Emissionsfaktor bei 34,2 g CO₂eq/kWh“. Hamburg, zum Vergleich, ist bereits auf seinen höheren (und damit „schlechteren“) Primärenergiefaktor von „nur“ 0,33 stolz (Emissionsfaktor 64 g CO2/kWh). Bundesweit wird für Fernwärme ein Primärenergiefaktor von durchschnittlich 0,7 zugrunde gelegt. Gas und Öl haben einen Primärenergiefaktor von 1,1. Die Ausgangslage in Krefeld scheint also auf den ersten Blick nicht schlecht. Doch bis zur Klimaneutralität sind noch weitere Schritte zu gehen.
Was ist jetzt zu tun?
Zur Erreichung der Klimaneutralität sind zwei Dinge zu tun:
Den Weg wird der Wärmeplan weisen, dessen Erstellung in Kürze beginnen wird. Für die regenerative Wärmeerzeugung bieten sich in Krefeld an: Tiefengeothermie (siehe Blog 9), Großwärmepumpen (z.B. Blog 16), Flächen-Solarthermie. Ob, wie lange und unter welchen Bedingungen Müllverbrennung dabei eine akzeptable Quelle ist, muss diskutiert werden. Dazu wird es noch einen ausführlicheren Blog geben. Es sei aber schon einmal angemerkt, dass Müllvermeidung (auch energetisch) sicherlich das oberste Ziel sein muss. Dass es aber wenig sinnvoll wäre, den dennoch noch längere Zeit anfallenden Müll zu verbrennen (Deponierung scheidet aus), aber die Abwärme nicht zu nutzen.
Der Zeitpunkt ist günstig!
Auf dem Hintergrund der aktuellen Gesetzgebungsdiskussionen auf Bundesebene müssen viele Menschen gerade jetzt überlegen, für welches neue Heizungssystem sie sich entscheiden. Für diese Entscheidung wäre ein rascher Ausbau des Fernwärmenetzes und eine frühzeitige Festlegung der zukünftigen Verfügbarkeitsgebiete hilfreich. Das würde manchem Bürger vermutlich kostspielige und weniger zukunftsfähige Investitionen ersparen.
Was wird dazu gebraucht?
Für den Ausbau der Wärmenetze und für die entsprechenden Erzeugungsanlagen sind, trotz vorhandener Bundesförderungen, sehr hohe Investitionen erforderlich. Diese sind nur bei entsprechender Planungssicherheitmöglich. Auch die anzuschließenden Haushalte müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen langfristig günstige und nachhaltig erzeugte Wärme zur Verfügung gestellt wird. Der Anbieter der Wärmelieferung muss eine Sicherheit haben, dass die von ihm bereitgestellte Wärme dauerhaft abgenommen wird. Diese Planungssicherheit sollte, wie in vielen anderen deutschen Städten auch, durch eine rechtssichere und nach ökologischen und nachhaltigen Kriterien entwickelte kommunale Fernwärmesatzung geschaffen werden. Dazu wird es zu gegebener Zeit einen weiteren Blog geben.

Die Stadt Krefeld will mit ihren rund 1.000 städtischen Gebäuden Vorbildfunktion beim Klimaschutz übernehmen. Deshalb bringt der Fachbereich „Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)“ in bemerkenswert rascher Folge zahlreiche Klimaschutzprojekte auf den Weg. Hier ein kleiner Überblick über einige bereits öffentlich bekannt gewordene Projekte:
Solarstrom: Es werden 17 große Photovoltaikanlagen auf Schulgebäuden errichtet (Gesamtleistung 1.790 kWp); die Förderungen sind bewilligt, die Umsetzung ist auf dem Weg. Für weitere 178 Liegenschaften wurde nun die Mittel für vorbereitende Beratungsleistungen zum Photovoltaikausbau (Wirtschaftlichkeitsanalyse, Vorplanungsstudie, statische Untersuchungen) beantragt. Nach deren Abschluss sollen auch Fördermittel für den Bau dieser weiteren Anlagen beantragt werden.
Ladesäulen: Es werden nach und nach Ladesäulen für Elektroautos an städtischen Liegenschaften errichtet: Die ersten stehen bereits.
Energetische Sanierung: 2022 wurde die Stadt Krefeld Modellkommune der Deutschen Energieagentur (dena). Das Projekt „Co2ntracting: build the future!“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt Kommunen mit Hilfe von Energiespar-Contracting (ESC). Contracting-Modelle für mehrere Gruppen von städtischen Gebäuden werden geprüft (im ersten Schritt 146 Einzelgebäude, in einem weiteren Schritt 570 Gebäude). Ziel ist, die energetische Sanierung (Dämmung, Heizungsmodernisierung etc.) der Gebäude an ausführende Unternehmen zu vergeben, die die Investitionen übernehmen. Stadt und Unternehmen teilen sich anschließend die ersparten Kosten.
Energiemanagement: Das Energiemanagementsystem der städtischen Gebäude wird neu implementiert (Software, Messtechnik und Personal). Mit der zunehmenden Anbindung der größten Verbrauchsstellen an das System wird Energiesparen durch optimierte Überwachung und Steuerung der Energieflüsse immer effektiver.
Fassadenbegrünung: Drei große städtische Gebäude sollen vorbildhaft eine Fassadenbegrünung erhalten. Diese mindert den Hitzestress außen, die Erwärmung innen und reduziert den Heizbedarf im Winter. Zudem wird CO2 gebunden.
Weitere Maßnahmen: Bereits in den letzten Jahren wurden Jahr für Jahr städtische Gebäude energetisch saniert (21 Gebäude in 2021, 10 in 2022), Beleuchtungskörper ausgetauscht (2021 wurden LED-Leuchten in einem Wert von 350.000 Euro eingesetzt) uva.
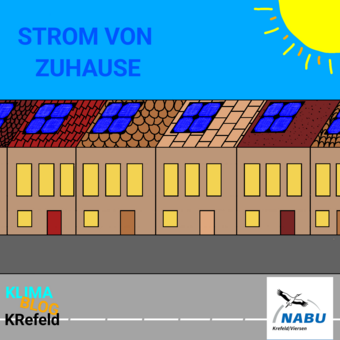
Krefeld verbraucht derzeit 940.000 MWh Strom im Jahr (2020). Es verursacht damit 26% seiner gesamten Treibhausgasemissionen. Mit Umsetzung der Energiewende wird der Stromverbrauch in Zukunft sogar ansteigen (geschätzt 10 bis 50%), da viele Prozesse von fossilen Energiequellen auf Strom umgestellt werden (z.B. auf Elektroautos, elektrische Wärmepumpen, strombasierte Industriewärme).
Wollen wir bis 2035 klimaneutral werden, müssen wir bis dahin also zwischen 1.030.000 MWh und 1.410.000 MWh grünen Strom im Jahr bereitstellen. Das wird nur unter Ausnutzung aller technisch möglicher Energiequellen funktionieren. Dazu gehört ganz wesentlich die Produktion von Solarstrom auf Krefelds Dächern.
Welchen Beitrag können private Dächer leisten?
In Krefeld gibt es ca. 122.000 Wohnungen in knapp 46.000 Wohngebäuden, davon etwa 39.000 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser zusammen haben schätzungsweise 5 Mio. m2Dachfläche. Laut Solarpotentialanalyse der Landesregierung sind etwa 2/3 dieser Dachfläche solar nutzbar und könnten bei vollständiger Belegung rund 500.000 MWh Solarstrom pro Jahr erzeugen. Das wäre immerhin ein Drittel bis die Hälfte des für 2035 angenommenen Stromverbrauches. Dazu müsste aber wirklich jedes Wohngebäude eine Solaranlage auf das Dach bekommen! (Weiteren Strom können Industriedächer, Parkplätze und zahlreiche Freiflächen liefern, was aber ein Thema für sich ist).
Ist eine Photovoltaikanlage wirtschaftlich?
Photovoltaikanlagen sind heute rentabler denn je. Sie haben sich in der Regel nach 8 bis 15 Jahren amortisiert. Je höher der Eigenverbrauch, um so wirtschaftlicher kann eine Anlage betrieben werden. Ein Batteriespeicher erhöht die Eigenverbrauchsquote, steigert die Wirtschaftlichkeit aber nicht in allen Fällen. Er trägt aber zur Strombereitstellung in der Nacht bei, was in Zukunft wichtig sein wird. Auch die Kombination mit einer Wärmepumpe ist vorteilhaft. Die seit Sommer 2022 erhöhte Einspeisevergütung für selbst nicht genutzten Strom und eine Förderung der Stadt Krefeld (s.u.) verbessern die Wirtschaftlichkeit zusätzlich. Mit dem neuen Vergütungssatz ist sogar bei Volleinspeisung Wirtschaftlichkeit möglich.
Welche Dächer sind geeignet?
In der Regel sind südlich orientierte Dächer am besten. Ost- oder/und Westausrichtung ist aber auch akzeptabel. Sogar eine Nordausrichtung kann u.U. rentable sein. Das Solarpotentialkataster Krefeld(https://www.solare-stadt.de/krefeld/Solarpotenzialkataster ) gibt Hinweise, welche Dächer wie geeignet sind. Auch Flachdächer sind geeignet.
Strom, Wärme oder beides?
Photovoltaikanlagen erzeugen Strom, Solarkollektoren erzeugen Wärme, PVT-Kollektoren beides. Je nach individuellen Gegebenheiten können alle drei System wirtschaftlich sein. Die Entscheidung für ein bestimmtes System hängt von der übrigen Haustechnik, dem Verbrauch und den Baulichkeiten eines jeden Hauses ab und kann letztlich nur Einzelfallbezogen mit einem versierten Berater getroffen werden. In diesem Blog geht es um Strom.
Kaufen oder Mieten?
Eine Solaranlage selbst zu finanzieren, bedeutete eine hohe Anfangsinvestition, die sich erst nach einigen Jahren amortisiert. Deshalb gibt es inzwischen zahlreiche Contracting-, Miet- und Pacht-Angebote. Stadtwerke (die SWK bisher nicht) oder private Anbieter bauen auf eigene Kosten die Solaranlage und bieten dann den Bezug des Solarstromes zu einem festen Satz an. In der Regel sind die summierten Zahlungen am Ende deutlich teurer als ein Kauf. Dafür muss man sich im besten Fall um Wartung und Versicherung nicht zu kümmern. Es ist dringend zu empfehlen, die Verträge im Vorhinein sehr genau zu prüfen.
Und was ist mit Mietwohungen?
Auch Vermieter können eine Solaranlage bauen und den Strom direkt an die Mieter verkaufen („Mieterstrom“: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Mieterstrom/faq-mieterstrom.html ). Wegen der Ersparnis von Steuern und Zuschlägen ist das i.d.R. für beide Seiten günstig und hat auch weitere Vorteile (grüner Strom, Wertsteigerung der Immobilie etc.).
Wo erfahre ich mehr?
Die Verbraucherzentrale bietet eine stets aktualisierte Information für die Planung an:
Auch zu Vor- und Nachteilen einer Batterie gibt es eine aktuelle Information der Verbraucherzentrale: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/lohnen-sich-batteriespeicher-fuer-photovoltaikanlagen-24589 .
Das Förderprogramm „Klimafreundliches Wohnen“ der Stadt Krefeld findet sich unter: https://www.krefeld.de/klimafreundlicheswohnen . Allerdings befindet es sich für 2023 noch in der Überarbeitung und ist voraussichtlich sehr schnell ausgeschöpft.

Eigener Strom in (praktisch) jeder Wohnung?
Haben Sie einen (möglichst sonnigen) Balkon, eine Terrasse, Dachfläche oder Fassadenwand an ihrer Wohnung? Dann können Sie mit dem Klimaschutz direkt beginnen. Wenn Sie dort ein „Balkonkraftwerk“ aufstellen, können Sie im Jahr etwa 200 bis 300 kWh Strom erzeugen – etwa den Verbrauch einer Waschmaschine für zwei Personen. Das erspart etwa 50 bis 80 Euro im Jahr. Bei Modulkosten von 350 bis 600 Euro würde sich das „Kraftwerk“ also nach 5 bis 10 Jahren amortisieren. In 20 Jahren werden ca. 2,5 Tonnen CO2 eingespart.
Die Aufstellung ist einfach (wobei die NGN in Krefeld allerdings noch einen Anschluss mit einem Spezialstecker verlangt), es ist allerdings ein kleiner bürokratischer Aufwand für die Anmeldung notwendig (s.u.). Falls man umzieht, nimmt man das Kraftwerk einfach mit.
Wo bekomme ich nähere Informationen?
Die Verbraucherzentrale hat eine ständig aktualisierte Erläuterung aller Einzelheiten auf ihrer Webseite https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/steckersolar-solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715 eingestellt. Dort kann man alles Wissenswerte erfahren.
Wo bekomme ich solch eine „steckerfähige Eigenerzeugungsanlage“
Mehrere Baumärkte/Elektromärkte in Krefeld bieten „Balkonkraftwerke“ an, teilweise sind sie sogar direkt verfügbar. Alternativ ist natürlich eine Bestellung über das Internet möglich.
Achten Sie darauf, dass entsprechend sichere Befestigungsmaterialen und der richtige Stecker (aktuell noch der „Wieland-Stecker“) mitgeliefert bzw. erworben werden. Die Leistung des Wechselrichters darf zudem 600 Watt nicht übersteigen (eine Erhöhung auf 800 Watt wird derzeit geprüft).
Für die Installation der Steckdose für den Spezialstecker ist i.d.R. die Hilfe eines Elektrikers notwendig. Wenn allerdings (hoffentlich bald) die Vorschriften geändert werden (wie vom VDE und der Bundesnetzagentur bereits empfohlen), kann ein Schukostecker genutzt und einfach selbst eingesteckert werden. Bitte verfolgen Sie dazu ggf. Veröffentlichungen im Internet.
Wo muss ich die Anlage anmelden?
Die Netzgesellschaft Niederrhein (NGN) bieten für die Anmeldung der Anlage in Krefeld eine Internetinformation an, der man die Einzelheiten der Anmeldung entnehmen kann (https://www.ngn-mbh.de/uebersicht/einspeisen/steckerfertige-erzeugungsanlage ).
Dort findet man auch einen Link zum Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, wo man die Anlagen zunächst anmelden muss. Danach ist lediglich noch die Mitteilung der zugeteilten Registrierungsnummer an die NGN erforderlich.
Unter Umständen werden anschließend vor Inbetriebnahme der Anlage auf Kosten der NGN (wenn diese beauftragt ist) ältere Stromzähler ausgetauscht, damit auch die Einspeisung von Strom möglich ist.
Muss ich sonst noch etwas beachten?
Die Anlage sollte sicher befestigt werden, darf nicht herunterfallen und keine Blendwirkung entfalten. Achten Sie dabei auf die korrekten Befestigungsmaterialien (z.B. Betriebsanleitung).
Falls Sie die Anlage an der Außenseite des Balkons oder an einer anderen Stelle der Außenwand des Gebäudes installieren wollen, muss der Vermieter gefragt werden. Ebenso sollte dies für den Wechsel der Steckdose geschehen.
Beitrag zur Klimawende in Krefeld?
Das Gutachten „KrefeldKlimaNeutral 2035“ baut auch auf engagierte Bürger, die Balkonkraftwerke einsetzen, um einen Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten. In der vorläufigen Veröffentlichung wird ein Beitrag von 920 MWh/Jahr angenommen. Das würde einer angenommenen Installation von ca. 2.200 Balkonkraftwerken entsprechen, womit ca. 5.000 Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden könnten. (Mal sehen, was die die Endfassung des Gutachtens vorschlägt). Es ist aber zu hoffen, dass noch viel mehr Krefelder Balkone als 2.200 zum Klimaschutz beitragen werden.
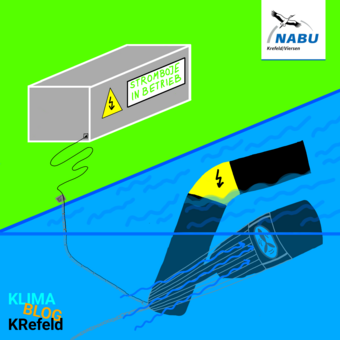
In St. Goar wurde Ende 2021 eine erste Strom-Boje im Rhein installiert. 16 sollten es ursprünglich einmal werden. Vielleicht kommt das ja noch. (http://s523185842.online.de/endspurt-fuer-die-netzanbindung).
Eine Strom-Boje sieht aus wie ein großer Trichter, der, an einer Kette befestigt, frei flottierend in einen Fluss gehängt wird. Ein Rotor (2,5 m Durchmesser) setzt die Fließenergie des Wassers in Strom um. Bei günstigen Bedingungen sind 100 kW Leistung möglich, womit ca. 100 Häuser mit Strom versorgt werden könnten. (https://www.strom-boje.at/de/die-stromboje.html).
In Österreich werden solche Strom-Bojen seit 2013 in verschiedenen Flüssen erprobt. Es gibt einen Plan, die 50.000 Einwohner der gesamten Region Wachau entlang der Donau mit Hilfe von 500 Strom-Bojen zu versorgen (https://de.wikipedia.org/wiki/Strom-Boje).
Könnten Strom-Bojen auch einen Beitrag zu Krefelds Stromversorgung leisten?
Da eine Strom-Boje ohne Pause Tag und Nacht das ganze Jahr über Strom erzeugt, wäre sie eine wichtige Ergänzung zu Sonnenenergie und Windkraft. Allerdings ist der Rhein bei Krefeld kein optimaler Ort für eine Stromversorgung mit Strom-Bojen.
Kaum genehmigungsfähig
Wie das Wasser-und-Schiffahrtsamt (WSA) auf Anfrage mitteilte, seien die „Voraussetzungen für Stromturbinen in Krefeld eher für ungünstig: an der hinsichtlich der Strömungsverhältnisse günstigeren Außenkurze tritt die Fahrrinne nahe an das Ufer und das Ufer unterliegt in weiten Teilen Hafen- und Umschlagszwecken“. Eine Genehmigung, die jeweils auf Einzelantrag erfolgt, sei deshalb nicht sehr wahrscheinlich.
Flusseigenschaften ungünstig
Die Strom-Bojen sind für Fließgeschwindigkeiten von über 2 m/s ausgelegt. Im Rhein, der bei Krefeld etwa 1,2 m/s schnell fließt, würden sie also nur einen Teil ihrer Leistung bringen – insbesondere, wenn sie außerhalb der Fahrrinne auf der (langsameren) Duisburger Seite ausgelegt würden. Schließlich benötigen die Turbinen bei einer Länge von 11 Metern und einer Breite von 5 Metern mindestens 3 Meter Wassertiefe, die, gerade bei den aktuellen häufigen Niedrigwasserständen, am ehesten dort gegeben sind, wo auch die Schiffe die viel befahrene Wasserstraße nutzen.
Fazit
In St. Goar teilt sich der Rhein in zwei Flussarme. Die Schiffe fahren auf der einen Seite, die Strom-Boje liegt auf der anderen. Solange sich der Rhein in Krefeld nicht teilt, dürften Strom-Bojen in der aktuell verfügbaren technischen Form leider keinen nennenswerten Beitrag zur Stromversorgung Krefelds leisten können - trotz ihrer technischen Zuverlässigkeit.

Krefeld will bis 2035 klimaneutral werden – ein tolles und verantwortungsvolles Ziel!
Es gibt zahlreiche Gründe, warum wir das Ziel erreichen können und werden:
Praktisch alle sind dafür, die Gegner sind verstummt:
- Der Stadtrat in Krefeld hat es als Ziel beschlossen.
- Die Stadtverwaltung ist motiviert und legt schon in vielen Bereichen los.
- Die SWK arbeiten im Stillen schon an vielen Projekten und könnten jetzt zusätzliche Motivation bekommen.
- In der Industrie gibt es eine „neue Ernsthaftigkeit“ der Klimaschutzbemühungen. Alte Wege werden überdacht, Neutralitätsziele überschlagen sich. Energiesicherheit wird plötzlich in einem Atemzug mit Ausbau der regenerativen Energien genannt.
- Die Bürger sind motiviert. Auch der Energiepreisanstieg durch den Ukrainekrieg drängt zum Handeln. Sie sparen Energie, bauen Solaranlagen und Wärmepumpen und gehen auf Demonstrationen.
- Die Natur zeigt uns immer klarer die gelbe Karte. Sie ist schon lange dafür......
Jeder, wirklich jeder, kann etwas tun:
Allein schon im Privaten: Schalter aus, Sparbirne, Kurzlüftung, Heizung runter, Bus fahren, radeln oder laufen, weniger Fleisch essen, Nachbarn und Kollegen überzeugen, weniger oder nicht fliegen, Fenster neu, Wohnung dämmen, Balkonkraftwerk oder Solaranlage auf dem Dach, Wärmepumpe, Fernwärme und vieles andere mehr....
Gewerbe, Industrie und Verwaltung haben zahlreiche Möglichkeiten, die z.T. schon in diesem Blog erwähnt wurden. Und die SWK erst........
Warum fassten erst seit 2019 zahlreiche Städte Neutralitätsbeschlüsse?
Ja, der Fridays-for-Future-Bewegung und den hunderttausenden Menschen, die auf die Straßen gingen, ihnen gebührt der größte Dank.
Es kam aber hinzu, dass die Zeit einfach reif war: Gut eine Generation lang wussten wir von den Klimaveränderungen, haben dieses Wissen aber nicht wirklich an uns herangelassen und unser Handeln kaum verändert. Die nächste Generation reagierte mit berechtigtem Unverständnis und protestierte heftig gegen die Einschränkungen ihrer Zukunft. Nun bekommen auch die Älteren zunehmend ein schlechtes Gewissen....... und jetzt können alle gemeinsam tätig werden.
Hinzu kommt für Krefeld jede Menge Rückenwind von oben
Die überregionalen Rahmenbedingungen verändern sich rasch: Ehrgeizige Ausbauziele, Förderungen und Lenkungen, Emissionszertifikate, Planungserleichterungen, grünerer Strommix, Energiepreisveränderungen, Forschungsergebnisse, neue oder preiswertere Technologien und vieles andere machen uns die Arbeit in Krefeld immer leichter.
Was wir jetzt brauchen ist BEGEISTERUNG für das, was wir hier in Krefeld erreichen wollen!!!!
Wir brauchen und wir können nicht mehr warten. Wir haben schon begonnen! Wie schon in Blog 6 gesagt: Skepsis macht schwer, also beflügelt voran:
Wir wollen Krefeld fit für die Zukunft machen und ohne schlechtes Gewissen und Energiepreissorgen hier leben können. Ist dafür nicht jede Anstrengung eine Freude?
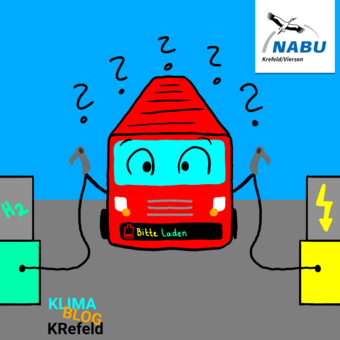
Am 2. August 2021 trat die europäische Clean Vehicles Directive (CVD) in Kraft. Sie schreibt vor, dass bis Ende 2025 mindestens 45 Prozent der neu beschafften und im öffentlichen Nahverkehr eingesetzten Fahrzeuge „saubere Fahrzeuge“ sein müssen, die Hälfte davon (22,5%) sogar „emissionsfrei“. Bis 2030 erhöht sich die Quote auf 65 Prozent (bzw. 32,5%).
„Emissionsfrei“ im Sinne der Richtlinie sind:
- Batterieelektrische Busse mit Depotladung (große Batterie nötig = teurer)
- Batterieelektrische Busse mit Gelegenheitsladung (kleinere Batterie möglich)
- Oberleitungsbusse (bisher nur in drei Städten eingesetzt, z.B. Solingen)
- Wasserstoffbetriebene Busse mit Brennstoffzellen oder als Verbrenner
Wie soll Krefeld sich entscheiden?
Konventionelle Dieselbusse waren aufgrund ihrer hohen Reichweiten (über 500 km) recht universell einsetzbar. Ob jetzt aber der Batterie oder dem Wasserstoff der Vorzug gegeben werden soll, ist schwer zu entscheiden.
Bei der Umstellung auf „emissionsfreie“ Fahrzeuge sind viele Faktoren zu bedenken, die hier wegen ihrer Komplexität nicht einmal ansatzweise diskutiert werden können (zur Übersicht siehe z.B. https://www.vdv.de/emissionsfreie-energie-und-antriebskonzepte-fuer-stadtbusse.pdfx ). So müssen die individuellen Fahrstrecken analysiert werden, die Haltezeiten, die Energiebedarfe (in Krefeld zum Glück wenig Steigungen), der Heizbedarf (verbraucht im Winter u.U. bis zu 50% der Batterieladung), die Tankstellenkosten, die Treibstoffkosten, Fördergelder, Angebot von Fahrzeugen auf dem Markt, lokale Besonderheiten und vieles mehr. Wasserstoffbusse z.B. können Dieselbusse auch einzeln ersetzen, bei Batteriebussen müssen evtl. Strecken angepasst werden (Aufladepunkte).
Wie haben andere Städte sich entschieden?
Die Stadt Shenzen in China betreibt 16.000 Elektrobusse. Andererseits will Peking 5.000 Wasserstofftankstellen bis 2035 errichten. Südkorea drängt auf Wasserstoff. Viele Städte in Deutschland diskutieren noch. Die größten Städte setzen schwerpunktmäßig auf Elektrobusse: Berlin (>120), Hamburg (>150), Köln, München, aber auch Dortmund, Münster, Leipzig, Osnabrück usw.. Andere bevorzugen ein Mischmodell: Z.B. will Frankfurt je zur Hälfte Strom bzw. Wasserstoff einsetzen. Auch die Ruhrbahn (Essen/Mülheim) will mischen. Duisburg dagegen will ganz auf Wasserstoffbusse setzen. Dazu ermutigt sie ein Gutachten der Kölner Firma EMCELL GmbH (die Dienstleistungen rund um Elektromobilität, Schwerpunkt Brennstoffzellen anbietet). Das Gutachten weist allerdings eindeutig auf die besondere Eignung Duisburgs für Wasserstofflösungen hin (Logistik-Drehscheibe, Industriestandort, Wasserstoff-Kompetenzzentrum, Topographie etc.) und gibt kein allgemeines Votum für Wasserstofftechnologie ab. Das Ergebnis sei auf andere Städte nicht übertragbar (https://www.dvg-duisburg.de/die-dvg/aktuell/wasserstoffbusse ).
Was sagt die Wissenschaft?
Eine Studie der Hochschule Offenburg (https://www.mdpi.com/1996-1073/14/14/4384 ) errechnet bezüglich der Kosten, dass Batteriebusse über ihre Lebenszeit in jedem Fall günstiger als Wasserstoffbusse seien (2030 sogar billiger als Dieselbusse). Wasserstoffbusse könnten mit Dieselbussen nach 2030 bezüglich der Betriebskosten eventuell annähernd konkurrieren, wenn Wasserstoff sehr billig zu haben wäre. Wie rasch Wasserstoff billiger wird, ist derzeit kaum vorhersagbar. Andere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen (z.B. https://escholarship.org/uc/item/7s25d8bc ).
Gibt es schon negative Erfahrungen?
Mehrere europäische Städte, die zunächst auf Wasserstoffbusse setzten (auch wegen der hohen Fördermittel), wenden sich wieder ab. Montpellier beispielsweise stornierte eine Bestellung von 51 Wasserstoffbussen, da sie herausgefunden hatten, dass die Betriebskosten sechsmal höher als bei Batteriebussen gewesen wären (95 c/km vs. 15 c/km) (https://efahrer.chip.de/news/stadt-tauscht-elektro-und-wasserstoff-busse-die-kosten-fallen-auf-ein-sechstel_106871 ). Wiesbaden schaffte 10 Wasserstoffbusse wieder ab – wegen der Betriebs- und Wartungskosten (https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/oepnv-elektrobus-verkehrswende-100.html ). Der umgekehrte Systemwechsel scheint bisher nicht vorzukommen. Bei sehr günstiger Entwicklung des Wasserstoffpreises könnte sich das ändern.
Die Energieeffizienz spricht eher für Batterie
Grüner Wasserstoff müsste mit auch grünem Strom produziert werden. Der Elektrobus nutzt davon 60-80%, der Wasserstoffbus wegen Umwandlungsverlusten nur 30-40%. So lange also nicht grüne Energie in Hülle und Fülle zur Verfügung steht, spricht viel für einen sparsamen Einsatz. Auch dieser Grundsatz aber muss vor Ort individuell bewertet werden.
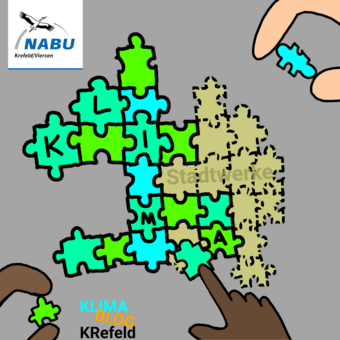
Der deutsche Energiemarkt hat eine Besonderheit: Mit über 900 Stadtwerken ist die Energieversorgung sehr dezentral aufgestellt. Während Bund und Länder noch über den richtigen Weg zur Klimaneutralität stritten, haben sich immer mehr, vor allem kleinere Kommunen selbst auf den Weg gemacht und eigene Stadtwerke gegründet, um eine vollständig erneuerbare bzw. auch energieautarke Versorgung zu erreichen. Vorbild waren die Elektrizitätswerke Schönau, die unmittelbar nach Tschernobyl 1986, aus einer Bürgerinitiative heraus, von Ursula und Michael Sladek ins Leben gerufen wurden. Sie kauften das lokale Stomnetz und strebten - damals völlig utopisch scheinend - eine komplett regenerative Energieversorgung an und setzten dies nach und nach in die Tat um. Sie waren so erfolgreich, dass sie nach der Strommarktliberalisierung 1998 sogar zu einem bundesweiten Anbieter für Ökostrom wurden. So nahm die „Ökostromrevolution“ von unten ihren Lauf (https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizitätswerke_Schönau ).
Inzwischen sind auch große Städte auf dem Weg, Beispiel München
Die Stadtwerke München (SWM) z.B. steigerten ihren Ökostromanteil in nur 12 Jahren von fünf auf 90 Prozent (2022). 2025 sollen erneuerbare Energiequellen aus eigenen Anlagen den Strombedarf komplett decken, trotz angenommener Steigerung von aktuell 6,3 Terawattstunden (TWh) auf 8,4 TWh. Bei der Wärmeversorgung spielt schon jetzt die Tiefen-Geothermie eine bedeutende Rolle. In der Fachstudie „Klimaneutrale Wärme München 2035“ (https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Klimaneutrale-Waerme-Muenchen.pdf ) steht sie an vorderster Stelle. Drei Heizwerke sind bereits in Betrieb, weitere sollen folgen.
Beispiel Mannheim
Die MVV Energie AG treibt die Energiewende ebenfalls sehr aktiv voran. Bis 2030 will sie eine CO2-Reduktion von mindestens 80 Prozent gegenüber 2018 erreichen. 2040 wollen sie sogar „klimapositiv“ werden, das heißt mehr CO2 aus der Atmosphäre entnehmen als sie hineingelangen lassen. Hilfreich ist dabei ein bereits sehr gut ausgebautes Fernwärmenetz. 2030 soll dieses vollständig auf „grüne Energiequellen“ umgestellt sein. Sie setzen dabei auf Abwärme aus der Abfallbehandlung und Biomasse, Klärschlammverwertung, Biomethan, Flusswärmepumpen, Geothermie und Industrieabwärme. Am 2040 sollen alle Abfallbehandlungsanlagen durch CO2-Abscheidung dekarbonisiert sein und damit der Atmosphäre CO2 entziehen.
Bundesweit gibt es viele vergleichbare Initiativen
Die Stadtwerke Flensburg und Kiel z.B. wollen, wie Stockholm schon seit 1986, in großem Stil Meereswärme nutzen. Flensburg will 50% seines Wärmebedarfes im Winter darüber decken und 2035 klimaneutral sein.
Und Krefeld?
Krefeld ist in einer guten Ausgangsposition. Auch in Krefeld gibt es die Stadtwerke Krefeld (SWK), die ein maßgeblicher Player der Klimaneutralität sein werden. Zahlreiche klimafreundliche Projekte habe sie bereits anstoßen (eine Messung des konkreten Fortschrittes muss durch eine konsequente Erfassung der Emissionen – auch Scope 2 und 3 – noch möglich gemacht werden). Die Erzeugung eigener erneuerbarer Energie hat bereits Fahrt aufgenommen. Weitere Möglichkeiten können vor Ort eröffnet werden.
Krefeld verfügt über ein umfangreiches Fernwärmenetz, welches ausgebaut werden kann. Die Stadtwerke machen es derzeit mit Absenkung der Vorlauftemperatur und neuen Regeleinrichtungen zukunftsfähig. Tiefenwärmeerschließung, Rheinwärmepumpe oder die Nutzung industrieller Abwärme sind auch in Krefeld möglich und werden z.T. bereits in Angriff genommen. Wenn alle Beteiligten mitziehen, ist Klimaneutralität bis 2035 zu schaffen.
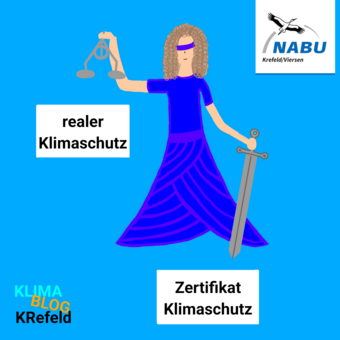
In den letzten Jahren überboten sich Hersteller mit Hinweisen auf die „Klimaneutralität“ ihrer Produkte. Dabei nutzten sie die Angebote vieler mehr oder weniger seriöser Anbieter, Emissionen hier durch „Einsparung“ von Emissionen an anderen Orten - z.B. durch Erhalt von (angeblich) bedrohten Wäldern – zu kompensieren.
Das Landgericht Stuttgart zog jetzt die Bremse.
Es urteilte am 30. Dezember 2022 (Az. 53 O 169/22): „Die Werbung mit Umweltschutzbegriffen und -zeichen ist danach ähnlich wie die Gesundheitswerbung grundsätzlich nach strengen Maßstäben zu beurteilen.....Zu erwarten ist bei einer ohne nähere Erläuterung platzierten Angabe „klimaneutral“, dass das werbende Unternehmen alles im weitesten Sinn Zumutbare unternimmt, um seine CO2-Emissionen zu vermeiden und lediglich den unvermeidlichen Rest der Emissionen kompensiert“. Diese Bemühung müsse sich zudem auf alle Produktbestandteile (inkl. Verpackung etc.) beziehen und müsse den gesamten Lebenszyklus des Produktes abdecken.
Klimaschutz „nur“ mit Zertifikaten geht also nicht mehr
Hinzu kommt, dass auch die Qualität und der Wert der Zertifikate zunehmend in Frage gestellt wird. In der Presse häufen sich die Berichte von unzureichend belegten Klimaeffekten oder Betrug (z.B. Wirtschaftswoche vom 3.2.2023: „Macht Bäume pflanzen ein Kohlekraftwerk klimaneutral?“ oder https://www.bloomberg.com/news/features/2020-12-17/the-real-trees-delivering-fake-climate-progress-for-corporate-america ). Auch das Landgericht Stuttgart verlangte Belegbarkeit.
Die Europäische Union versucht Klarheit zu schaffen
Die EU arbeitet an einer Richtlinie gegen „Greenwashing“. Die Mitgliedstaaten müssen dann Gesetze erlassen, die präzise vorschreiben sollen, welche Umweltaussagen unter welchen Bedingungen erlaubt sein sollen. Behauptete Emissionsminderungen müssten dann z.B. vom TÜV zertifiziert werden. Hohe Strafen drohen bei Verstößen.
Unternehmen werden vorsichtig
Die Presse berichtete kürzlich, dass z.B. die Drogeriekette Rossmann unter diesen Bedingungen erst einmal Abstand von entsprechender Umweltwerbung nehmen wolle. In ihrer Glaubwürdigkeit erschütterte Umweltbehauptungen seien schädlicher als gar keine.
Was bedeutet das für Krefelder Unternehmen?
Krefeld ist auf dem Weg klimaneutral zu werden. Wenn z.B. der von den SWK gelieferte Strom eines Tages komplett in eigenen Anlagen klimaneutral erzeugt wird, kann jede Krefelder Firma, die SWK-Strom bezieht, diesbezüglich ihre Klimaneutralität belegen – ein positiver Standortfaktor. Beispielsweise will Covestro 2035 klimaneutral werden. Klimaneutraler Strom wäre dafür die Voraussetzung.
Ausbau eigener Stromerzeugung in Krefeld notwendig!
Die SWK bemühen sich bereits seit längerem um eigene Erzeugungskapazitäten und bauen ihr diesbezügliches Portfolio aus. Wenn nun z.B. weitere Windkraftstandorte oder Solarenergieflächen in Krefeld ausgewiesen würden und zusätzliche Quellen erschlossen werden (z.B. Tiefenwärme) wäre ein weiterer Schub möglich. Auch Privatpersonen und die Firmen selbst können durch Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern einen Beitrag leisten.
Die Münchener Stadtwerke wollen bereits 2025 ausschließlich klimaneutralen Strom liefern. Vielleicht kann Krefeld bald folgen.
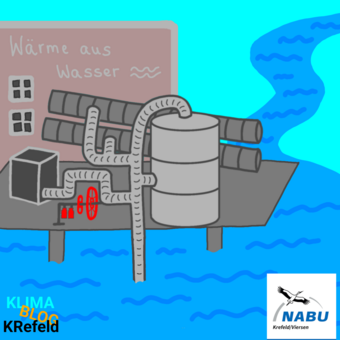
Die Wärmeversorgung der Krefelder Haushalte und Betriebe verursacht den höchsten Energiebedarf in Krefeld. Woher kann diese kommen? Die Tiefen-Geothermie als eine mögliche Quelle wurde bereits dargestellt (Blog 9). Mannheim zeigt uns eine weitere Möglichkeit. Dort wird nämlich seit einigen Monaten eine Großwärmepumpe aufgebaut, die die Wärme des Rheinwassers nutzt (https://www.mvv.de/ueber-uns/unternehmensgruppe/mvv-umwelt/aktuelle-projekte/mvv-flusswaermepumpe ). Sie soll noch 2023 in Betrieb gehen.
Rheinwasser-Großwärmepumpe Mannheim
Die Wärmepumpe wird in der ersten Ausbaustufe eine thermische Leistung von ca. 20 MW haben. Damit werden schätzungsweise 3.500 Haushalte mit Wärme versorgt werden können und 10 - 20.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.
Das Rheinwasser ist im Sommer bis 25°C, im Winter nur etwa 5°C warm. Diese Wärme reicht aber aus, um das Kältemittel der Wärmepumpe zu verdampfen und das Rheinwasser bis auf minimal etwa 2°C abzukühlen. Der Kältemitteldampf wird dann mittels eines strombetriebenen Verdichters komprimiert, damit Druck und Temperatur steigen. Es können damit Temperaturen von 83°C bis 99°C erreicht werden, die z.B. auf das Fernheizwasser übertragen werden können. Die eingesetzte Energie (Strom) wird dabei um einen Faktor von 2,7 vermehrt.
Nimmt die Umwelt Schaden? Und der Geldbeutel?
Der bauliche Eingriff ist gering. Flusslebewesen müssen durch entsprechende Vorrichtungen geschont werden. Es wird so wenig Rheinwasser entnommen, dass die Abkühlung nicht messbar sein wird. Eine Abkühlung wäre aber angesichts der zunehmenden Überwärmung des Rheines durch Industrie und Klimawandel eine eher wünschenswerte Folge. Unter diesem Aspekt wären durchaus viele Wärmepumpen am Rhein wünschenswert.
Sorge tragen muss man auch, dass das Kühlmittel nicht entweicht, welches ebenfalls klimaschädlich sein kann. Mannheim setzt hier auf eine klimaschonende Chemikalie.
Laut ihrer Internetseite haben die Mannheimer Stadtwerke für die Pumpe etwa 15 Mio. Euro investieren müssen. Sie haben zusätzlich aber beträchtliche Fördermittel erhalten und ein Forschungsprogramm angeschlossen, um die Erkenntnisse weiterzuentwickeln. Mit zunehmender Anwendung und Serienfertigung werden die Kosten solcher Großwärmepumpen sinken.
Ist das Potential ausbaubar?
Man schätzt, dass das nutzbare Wärmeangebot des Rheines einen Ausbau der Pumpen in Mannheim auf insgesamt 500 MW Leistung ermöglichen würde. Damit könnten dann 50.000 Haushalte mit Wärme versorgt werden. – Das wäre auch in Krefeld möglich!!!
Bis 2030 möchte Mannheim seine gesamte Fernwärme aus „grüner Energie“ beziehen.
Gibt es schon praktische Vorbilder?
Stockholm beispielsweise deckt 60% seines Wärmebedarfes über Fernwärme ab und betreibt seit den 80er Jahren eine Serie von sechs Meerwasserwärmepumpen mit einer Gesamtleistung von 180 MW, die zigtausend Gebäude mit Wärme versorgen. (https://www.friotherm.com/wp-content/uploads/2018/01/vaertan_e008_de__12jun08web.pdf ).
Obwohl die Details der Umsetzung des Projektes „KrefeldKlimaNeutral 2035“ noch nicht erarbeitet und beschlossen sind, arbeiten bereits viele Bereiche in Verwaltung und städtischen Betrieben an Umsetzungselementen. Zudem wächst die Stabsstelle Klimaschutz der Stadtverwaltung und wird dadurch zunehmend wirksam. Wenn das Projekt im ersten Halbjahr 2023 politisch beschlossen ist, kann in allen Bereichen gezielt losgelegt werden.
Bereiche, deren engagierte Projekte bereits öffentlich erkennbar wurden, sollen in der Folge als „Mutmacher“ schon einmal erwähnt werden.
Der Krefelder Zoo: Fernwärme und Solarstrom für Mensch und Tier
Der Zoo wurde 2020 vom Umweltministerium NRW zum Regionalzentrum für „Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)“ ernannt. Mit Unterstützung der Zoofreunde wurde 2022 auch die „BNE-Bildungsbox“ eröffnet, in der die BNE-Projekte eine räumliche Heimat gefunden haben.
Das traurige Ereignis des Affenhausbrandes 2020 löste jetzt zusätzlich eine umfassende Initiative zur energetischen Optimierung aus. Dahinter steht die Vision, den Zoo, neben einem Zentrum für Artenschutz und Biodiversität auch zu einem „Musterprojekt für nachhaltige Entwicklung und Klimaneutralität“ in Krefeld zu machen. Konkrete Schritte sind bereits erkennbar:

Das Wissenschaftszentrum der „Scientists for Future“ hat ein Policy-Paper zur Nutzung von Wasserstoff veröffentlicht (https://info-de.scientists4future.org/wasserstoff-in-der-energiewende).
Grundsätzlich lasse sich Wasserstoff (H2) wie Erdgas in Pipelines oder Tankschiffen transportieren und in Tanks oder Kavernen speichern. Das suggeriere, dass grüner, also elektrolytisch mit regenerativem Strom CO2-frei erzeugter Wasserstoff alle Aufgaben übernehmen könnte, für die heute fossile Rohstoffe eingesetzt würden. Der Eindruck trüge, denn für viele Zwecke sei Wasserstoff energetisch ineffizient und viel zu teuer.
Verbreiteter Zweckoptimismus der Erdgasnetzbetreiber
In einigen Studien der Erdgasnetzbetreiber werde Zweckoptimismus deutlich: So gehe der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches DVGW, der unter seinen Mitgliedern über 2.000 Versorgungsunternehmen versammele, nicht von einer Knappheit an Wasserstoff aus. Es wird dabei eine Importquote von 90% angenommen – wie heute bei Gas und Öl. Wasserstoff werde sogar für Heizzwecke propagiert. Es werde aber nicht belegt, wann und woher der Wasserstoff denn konkret kommen solle (siehe auch Blog 10).
Sinnvolle Nutzung von Wasserstoff:
Wasserstoff werde benötigt, um Ammoniak und Methanol als Grundstoffe für die chemische Industrie herzustellen. In der Eisen- und Stahlherstellung erfolge gerade die Umstellung auf Wasserstoff als Reduktionsmittel - er soll die Kohle ersetzen. Auch für die langfristige Speicherung von Energie wird Wasserstoff von einer breiten Mehrheit der Wissenschaft als notwendiger Energieträger eingestuft.
Probleme:
Der Einsatz von Wasserstoff muss daher durch die Politik dorthin gelenkt werden, wo sein Einsatz notwendig und effizient ist und volkswirtschaftlich hohen Nutzen stiftet.
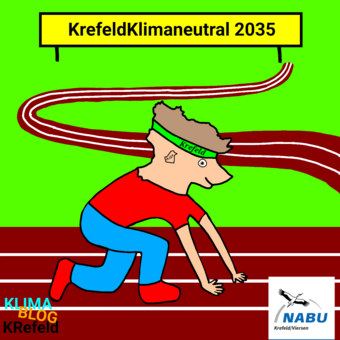
Das Gutachten „KrefeldKlimaNeutral 2035“ verzögert sich noch einige Tage
Eigentlich sollte es am 27.1. (morgen) der Stadt übergeben werden (siehe Blog 4). Nun besteht aber noch Abstimmungsbedarf in Teilbereichen.
Das Gutachten wird die Leitschnur für die weiteren Planungen und auch Geldausgaben sein. Dies wird sich dann erst in den Haushaltsplanungen 2024 in größerem Umfang niederschlagen.
Klimaschutz ist aber auch schon im Haushalt 2023 enthalten
Im aktuell in den Gremien der Stadt diskutierten Haushaltsentwurf 2023 finden sich deshalb noch begrenzte Mittel für den Klimaschutz (gegenüber früher viele, gemessen am Bedarf wenige). So wird das sehr gut angenommene Förderprogramm „klimafreundliches Wohnen“ (es werden u.a. Solaranlagen gefördert) mit 500.000 Euro fortgeführt. Zudem werden Mittel für ein Gutachten zur Wärmeplanung eingestellt (sehr wichtig! - siehe Blog 8) und für eine „Potentialanalyse Wasserstoff“. Für letzteres wird eine geeignete Fragestellung gefunden werden müssen (siehe Blog 11 und nächster Blog). Weitere Mittel wird es für Quartiersanierungspläne, Krefelder Klimapakt, Klimaanalyse und einige andere Punkte geben.
Sind alle für Klimaschutz?
Erfreulich war bei den Beratungen bisher, dass speziell diese „Klima-Mittel“ kaum in Frage gestellt wurden. Die Wichtigkeit des Klimaschutzes scheint erkannt zu sein. Hoffen wir, dass sich dies auch bei Verabschiedung und finanzieller Ausstattung von „KrefeldKlimaNeutral 2035“ in den kommenden Monaten und Jahren fortsetzen wird.
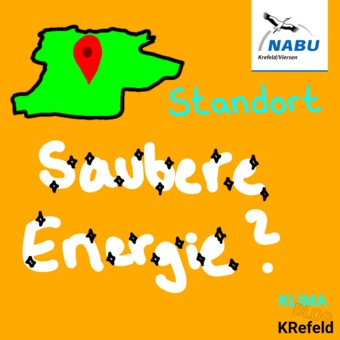
Die Wirtschaftsförderung in Schleswig-Holstein wirbt mit sauberem Strom (https://wtsh.de/de/standortfaktor-gruene-energie ). Die Ansiedelung mehrerer großer Industriebetriebe gebe ihr Recht, wie ein Artikel in der ZEIT vom 14.1.2023 analysiert. 3.000 Windräder produzierten so viel Strom, dass die Hälfte davon an andere Bundesländer abgegeben werden müsse.
Umweltfreundliche Energie ist heute ein Trumpf
Betriebe suchten nach einer „günstigen, naturnahen und sicheren Energieversorgung. Weniger aus Liebe zum Planeten als aus Kalkül. Viele Konzerne müssen ihren Mitarbeitern, Geldgebern und Kunden zeigen, wie sie in den nächsten Jahrzehnten klimaneutral werden. Und so lange reichen viele Investitionsentscheidungen nun mal“ – schreibt die ZEIT.
(Und sogar die „Bayrische Staatszeitung“ gibt es zu: www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/politik/detailansicht-politik/artikel/oekologie-als-standortfaktor.html)
Nordschweden boomt
Noch mehr gelte dies für den Norden von Schweden. Dort hätte facebook bereits 2011 den Reigen der Ansiedelung von großen Betrieben begonnen – alle auf der Suche nach günstiger und grüner Energie, die dort aus Wind und Wasser in Fülle bereitstehe. Inzwischen boome die gesamte Region.
Kann Krefeld das auch?
Krefeld wird aufgrund seiner Struktur und Lage wohl eher nicht zu den führenden Produzenten von sauberer Energie werden können. Aber jeder Schritt in die richtige Richtung ist wertvoll. Das Neutralitätsziel bis 2035 wird sicherlich zu der einen oder anderen Standortentscheidung beitragen.

Wenn man im Internet nach städtischen Initiativen zur Klimaneutralität bis 2035 sucht, hat man rasch über 50 deutsche Städte gefunden, die sich mit dem Thema beschäftigen. Bei näherer Betrachtung hat allerdings nur ein Teil davon das Ziel konkret formuliert und einen Ratsbeschluss gefasst.
Je konkreter der Inhalt, um so seltener sind Ratsbeschlüsse
Dabei handelt es sich oft nur um einen einleitenden Ratsbeschluss z.B. ein Gutachten zu erstellen. Ratsbeschlüsse zur Umsetzung erstellter Gutachten sind noch seltener. Am seltensten sind Beschlüsse, die dafür dann auch Jahr für Jahr die notwendigen haushaltswirksamen Schritte beschließen.
Die Ratsbeschlüsse sind im Internet nicht immer leicht zu finden. Ein Beispiel für einen gut zu findenden Umsetzungsbeschluss ist der Beschluss der Stadt Bonn vom 8.12.2022:
(https://www.bonn.sitzung-online.de/public/to020?TOLFDNR=2031779)
Umsetzende Beschlüsse auf Gutachtenbasis gibt es beispielsweise auch in Wuppertal (16.11.2021), München (10.01.2022) Frankfurt (12.05.2022) und Stuttgart (27.07.2022).
Neun Städte wollen mit EU-Mitteln schon 2030 klimaneutral werden - oder doch nicht???
Neun deutsche Städte sind unter 30 Bewerbern für die Teilnahme an der „EU City Mission“ ausgewählt worden. Diese stellt von 2022 bis 2023 viel Geld für Innovationen bereit, die notwendig sind, um Klimaneutralität sogar bis 2030 zu erreichen. Es handelt sich um Aachen, Dortmund, Dresden, Frankfurt a.M., Heidelberg, Leipzig, Mannheim und München.
Die offiziellen Beschlusslagen dazu sind allerdings sehr unterschiedlich: Einen Klimaschutz-Aktionsplan bis 2030 hat Mannheim beschlossen. Dortmund hat einen Plan „2030“, der aber erst bis 2035 Klimaneutralität anstrebt. München und Frankfurt haben Beschlüsse bis 2035 (wollen aber zumindest ihre Stadtverwaltungen bereits 2030 klimaneutral gestalten). Leipzig und Heidelberg streben 2040 an. Dresden will unter dem Druck eines Bürgerbegehrens Klimaneutralität bis 2035 prüfen.
Obwohl sie gar nicht zu den "EU-City-Mission"-Städten gehört, hat der Stadtrat Erlangen am 26.11.2020 beschlossen, bis 2030 klimaneutral zu werden.
Es gibt schon viele, viele Gutachten....
Um entsprechende umsetzungsbezogene Beschlüsse zu fassen, haben eine ganze Reihe von Städten, wie auch Krefeld, Gutachten beauftragt, welche ermitteln sollen, wie sie bis 2035 klimaneutral werden können. Für Interessierte ist hier eine kleine Auswahl aufgeführt. (In einzelnen Fällen betreffen die Gutachten nur Teilbereiche der Klimaneutralität).
Bonn: Herunterladbar von der Ratsvorlage (siehe oben im Text)
Freiburg: https://rettet-dietenbach.de/wp-content/uploads/2018/11/G-19-216-Anlage-5-ifeu.pdf
München: https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Massnahmenplan-Klimaneutralitaet-Muenchen.pdf
Gießen: https://www.giessen.de/media/custom/2874_2718_1.PDF?1599643415?direct
Berlin: https://buerger-begehren-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2021/10/Potenzialstudie_Berlin.pdf
Köln: https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0040.asp?smcrecherche=7020 im Suchfeld 2547/2022 eingeben
Viele setzen heute ihre Hoffnung auf Wasserstoff
Wie in den letzten beiden Beiträgen erläutert sind Wärmeplanung und Fernwärme wichtige Elemente einer nachhaltigen Wärmeversorgung. Es gibt diesbezüglich aber zwei „Glaubensrichtungen“:
Im Gutachten "KrefeldKlimaNeutral 2035" werden die beiden „Glaubensrichtungen“ wohl ansatzweise durch die beiden Wärmeszenarien „all-electric“ und „H2“ repräsentiert.
Es ist schwierig, hier in die Zukunft zu blicken (ähnlich wie bei der Frage, ob die Zukunft des Autos elektrisch oder wasserstoffbasiert sein wird).
Europa ruft lautstark nach Wasserstoff!
Was den Wasserstoff angeht, so wird dieser langfristig mit absoluter Sicherheit eine tragende Rolle bei der Energiebereitstellung spielen. Entsprechend vollmundig sind die Willensbekundungen der Politik weltweit, wobei es sicherlich auch um den Kampf um zukünftige Pfründe bei der Umsetzung geht – nachdem wir die Solartechnik bereits "an China verloren“ haben.
Aber der Weg dahin wird noch lang sein!!!
Es ist also durchaus unsicher, ob überhaupt die europa- und bundesweiten Hoffnungen realisiert werden können.
Krefeld wird sich aber sicherlich hinten anstellen müssen.....
Wann wir aber am Ende in Krefeld einen ausreichend großen Teil vom Kuchen zu einem vertretbaren Preis bekommen, steht in den Sternen. Für „KrefeldKlimaNeutral 2035“ wird Wasserstoff aus der Sicht des NABU keine Rolle spielen. Das „H2-Szenario“ ist unrealistisch.
(MENA-Studie, ausführlich via: https://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/789
Natur-Studie: Probabilistic feasibility space of scaling up green hydrogen supply; https://www.nature.com/articles/s41560-022-01097-4
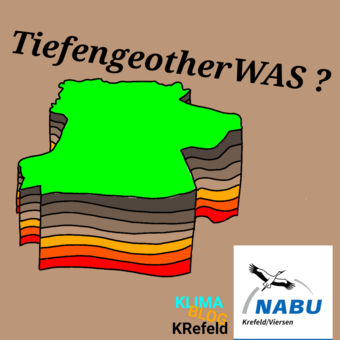
Wie im letzten Beitrag dargestellt, ist die Bereitstellung von klimagasfreier Wärme (v.a. für die Wohnungsheizung) von größter Bedeutung. Wegen des großen Anteils der Wärme an den Gesamtemissionen, kann und muss hier sehr viel CO2 eingespart werden.
Woher soll die Wärme kommen? Besonders im Winter scheidet die Sonne aus (Wärmespeicherung ist sehr teuer und nur begrenzt möglich). Windenergie sollte besser direkt als Strom genutzt werden und steht in Krefeld auch nur begrenzt zur Verfügung. Biomasse stellt heute einen relevanten Anteil und wird das in Zukunft auch tun. Dennoch ist die Verfügbarkeit gerade in Krefeld flächenmäßig begrenzt und die Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion muss stets abgewogen werden.
Fast grenzenlos viel Wärme liegt unter unseren Füßen
Das Erdinnere ist heiß und enthält genug Energie, um uns für Jahrhunderte mit Wärme zu versorgen. Allerdings muss man sehr tief bohren, um die Wärme nutzen zu können. Die Temperatur der Erdkruste steigt in der Tiefe um 3°C je 100 Meter an. Ab 400 m Tiefe bezeichnet man die Wärme aus der Tiefe als „Tiefengeothermie“. Die oberflächlichere Wärme kann mit Wärmepumpen genutzt werden, z.B. für die Heizung von Einfamilienhäusern und kleineren Mehrfamilienhäusern.
In 2.500 m Tiefe ist Wasser mit einer Temperatur von 70 bis 100°C zu finden – genug, um in ein (entsprechend angepasstes) Fernwärmenetz eingespeist zu werden. In 5.000 m Tiefe werden Temperaturen von über 150°C erreicht, womit auch Strom erzeugt werden könnte.
Vorteile der Tiefenwärme sind: Sie ist zeitlich rund um das Jahr Tag und Nacht verfügbar (grundlastfähig). Sie ist sehr verlässlich und jahrzehntelang nutzbar. Sie hat wenig Platzbedarf und ist praktisch emissionsfrei im Betrieb.
Warum wird Tiefenwärme noch so wenig genutzt?
Der Hauptgrund ist, dass sie nicht überall günstig verfügbar ist: Die Wärme darf nicht zu tief liegen und die Tiefenwasserverhältnisse müssen günstig sein. Sie muss in der Nähe der Nutzer vorhanden sein. Bohrungen sind zudem sehr teuer (viele Mio. Euro) und es besteht immer ein Risiko, dass sie erfolglos sind.
Außerdem gab es in der Anfangszeit ungünstige Umweltauswirkungen, die aber inzwischen, mit mehr Erfahrung, technisch beherrschbar sind.
Manche Städte gehen deshalb schon voran: München z.B. hat schon sechs Tiefenbohrungen in Nutzung und erzeugt damit Wärme für über 100.000 Haushalte. Ein weiterer Ausbau ist geplant (bis zu 70% des Wärmebedarfes der Wohnungen soll gedeckt werden).
Tiefenwärmenutzung ist in Krefeld möglich!!!
Bisherige Erkenntnisse zeigen, dass Krefeld mit erfreulich günstigen geologischen Voraussetzungen rechnen kann. Noch im Herbst 2022 erkundete das Geologische Landesamt mit seismischen Untersuchungen (Vibrations-Trucks) den Untergrund. Mit den Ergebnissen wird im Sommer 2023 gerechnet. Weitere Untersuchungen wären allerdings notwendig, bevor konkret gebohrt werden kann. Diese werden zeigen, an welchen Stellen genau Wärme wirtschaftlich gewonnen werden kann und ob an diesen Stellen eine Einspeisung in das Fernwärmenetz möglich ist.
Es gab 2011 bereits ein Projekt, welches Erdwärmebohrungen zur Strom- und Wärmeproduktion zum Ziel hatte. Es scheiterte damals kurz vor Realisierung an veränderten überregionalen Rahmenbedingungen, die damals gegen das Fracking gerichtet waren. Die Zeiten haben sich geändert. Es ist höchste Zeit, das Krefelder Tiefenwärme-Projekt wieder aufleben zu lassen.
(detailliert zum Thema z.B.: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/effiziente-fernwaermeversorgung-mit-niedertemperaturwaerme)
In Krefeld steht die Wärmeversorgung für 65% des Energiebedarfes (sogar nach der Herausnahme der EST-Großbetriebe aus der Bedarfsstatistik). Damit ist sie zur Erreichung der Klimaneutralität in Krefeld eines der wichtigsten Themen.
Die Wärmeversorgung ist der größte Berg auf dem Weg zur Klimaneutralität
Dennoch rückte leider, im Gegensatz zu Nachbarländern wie Dänemark, Österreich, Niederlande oder der Schweiz, die Bedeutung der kommunalen Wärmeplanung in Deutschland erst in den letzten Jahren ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Ein wesentliches Hemmnis war bisher die fehlende CO2-Bepreisung und damit auch die unzureichende Wirtschaftlichkeit. Das ändert sich jetzt: Durch die EU-Emissionszertifikate (siehe Blogbeitrag "Umgehendes Handeln...." vom 11.1.2023) sind steigende Emissionspreise – und damit unaufhaltsam steigende Heizkosten - garantiert.
Frühzeitiges Handeln spart besonders viele spätere Kosten - und soziale Verwerfungen!
Ein Kurzgutachten des Umweltbundesamtes (UBA) fasst den derzeitigen Kenntnisstand kurz zusammen (Link siehe unten). Hier einige Auszüge:
Die Wärmeplanung ist kompliziert, da sehr viele Akteure einbezogen werden müssen (Mieter, Vermieter, Firmen, Versorger, Verwaltung uva.). Auch innerhalb der Stadtverwaltung sind viele Bereiche betroffen.
Ziel der Wärmeplanung ist ein „Kommunaler Wärmeplan“, der sowohl Erzeuger als auch Verbraucher gleichermaßen betrachtet. Es ist zudem ein auf viele Jahre angelegter Multi-Akteurs-Prozess.
Energiesparen und erneuerbare Energiequellen sind gleichermaßen notwendig!
Das Ziel einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung lässt sich nur sinnvoll erreichen, wenn der Wärmebedarf der Gebäude mittels Energieeffizienzmaßnahmen drastisch gesenkt wird und gleichzeitig erneuerbare Energiequellen oder Abwärmepotentiale für den Restbedarf erschlossen werden. Es gibt kein „entweder – oder“. Hohe Effizienzstandards senken nicht nur den Bedarf sondern ermöglichen auch erneuerbare Energieversorgung (Niedertemperatur- Wärmenetze).
Es ist dabei weitgehend anerkannt, dass Wärmenetze (Fernwärme) eine Schlüsselrolle bei der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energiequellen spielen, da erst dadurch Wärmequellen wie tiefe Geothermie, Industrieabwärme, Großspeicher oder Freiflächen-Solarthermie erschlossen werden können. Erfreulicherweise hat Krefeld bereits ein Fernwärmenetz, welches aber massiv ausgebaut werden muss.
Auch erneuerbarer Strom wird einen wachsenden Beitrag zur Versorgung mit Wärme leisten (z.B. Wärmepumpen in dezentralen Gebieten, wo Fernwärme nicht hinkommt).
Effizienz und Versorgung hinken den Klimaschutzzielen weit hinterher
Die derzeitige Sanierungsrate (Dämmung von Wohnungen etc.) von 1% reicht bei weitem nicht für das Bundesziel der Klimaneutralität in 2045 und erst recht nicht für das Krefelder Ziel in 2035. Laut dem Gutachten "KrefeldKlimaNeutral 2035" sind 5% erforderlich ("all electric Szenario"). Auch der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmebereitstellung verharrt auf niedrigem Niveau (bundesweit ca. 15%, in Krefeld geringfügig mehr).
Folgende Aufgaben werden in dem UBA-Gutachten identifiziert:
Immer vom Ende her denken: Wie kann die treibhausgasneutrale Versorgung am Ende aussehen?
(Link zum UBA-Kurzgutachten: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/kurzgutachten-kommunale-waermeplanung)
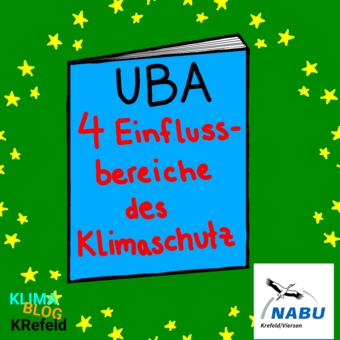
Das Umweltbundesamt (UBA) gab im November 2022 die Broschüre „Klimaschutzmanagement und Treibhausgasneutralität in Kommunen – große Potentiale wirksam erschließen“ heraus (Link unten). Darin werden mögliche kommunale Maßnahmen, in vier Einflussbereiche unterteilt, aufgelistet:
A) Verbrauchen und Vorbild: z.B. kommunale Gebäude, Fuhrpark, Beschaffung, Straßenbeleuchtung, kommunale Betriebe.
B) Versorgen und Anbieten: Infrastruktur, Nahverkehrsangebote, Fernwärme, Abfallentsorgung
C) Planen und Regulieren: Flächennutzungsplanung (z.B. Windkraft), Energiestandards, Solarpflicht, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsleitung.
D) Beraten und Infomieren: Informationskampagnen, Energieberatung, Teilhabe und finanzielle Anreize.
Folgend listet die Broschüre 38 wirksame Klimaschutzmaßnahmen auf, die praktisch alle in Krefeld umsetzbar sind. Diese sind innerhalb der Themenbereiche geordnet nach ihrer Einsparung in Mio. t CO2-Äquivalenten (in Klammern) bei bundesweiter Anwendung. Die tendenziell wirkungsvollsten Maßnahmen, die bundesweit umgesetzt zu über 5 Mio. t CO2-Äquivalenten führen würden, sind fett hervorgehoben:
A1) Umfassende energetische Sanierung der kommunalen Gebäude (3,24 Mio. t CO2)
A2) Gebäudesanierung kommunale Wohnbaugesellschaften (2,37)
A3) Umstellung auf erneuerbare Energien in kommunalen Gebäuden (2,32)
A4) Energieautarke Kläranlagen (1,68)
A5) Optimierung der Straßenbeleuchtung (1,53)
A6) Kommunales Energiemanagement (1,39)
A7) Optimierung Raumlufttechnik (RLT)-Anlagen (1,27)
A8) Umstellung auf erneuerbare Energien in kommunalen Wohnbaugesellschaften (0,81)
A9) Linienbusse elektrifizieren (0,74)
A10) Stromeffizienz in der Trinkwasserversorgung (0,43)
A11) Stromeffizienz in der Abwasserentsorgung (0,42)
A12) Kommunalen Fuhrpark optimieren (0,41)
A13) Beschaffung IKT (0,29)
A14) Dienstfahrten vermeiden (0,26)
A15) Beschaffung Gerät Kantinen (0,13)
B1) Dekarbonisierung von Fernwärmenetzen (6,55)
B2) Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur (5,06)
B3) Ausbau des ÖPNV-Angebotes (5,06)
B4) Optimierte Deponiegaserfassung und Reduktion um 50% (3,4)
B5) Nutzung der Abwärme kommunalen Abwassers (3,0)
B6) PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften (2,55)
B7) Effizienz von Fernwärmenetzen (1,64)
B8) Reduktion von Treibhausgasen in der Bioabfallverwertung (0,37)
B9) Umstellung des Verpflegungsangebotes in Kantinen (0,22)
C1) Festlegung von Windkraftgebieten in der Flächenplannutzung (14,34)
C2) Anschluss- und Benutzungszwang an dekarbonisierte Fernwärme für Bestand (8,59)
C3) Flächendeckendes Parkraummanagement (5,06)
C4) Anschluss und Benutzungszwang Fernwärme nur für Neubauten (0,85)
C5) PV-Nutzungspflicht Neubau (0,60)
C6) Hohe Effizienzanforderungen Bebauungsplanung (Gewerbe/Handel/Dienstleistung) (0,34)
C7) Kompaktheit Bebauungsplanung (Gewerbe/Handel/Dienstleistung) (0,15)
C8) Hohe Effizienzanforderungen (Private Haushalte) (0,09)
C9) Kompaktheit Bebauungsplanung (Private Haushalte) (0,04)
D1) Förderprogramm für PV-Aufdachanlagen für private Haushalte (12,30)
D2) Aktivierung der Eigentümer*innen von Ein- und Zweifamilienhäusern zur Gebäudesanierung durch intensive Beratung und Begleitung vor Ort (11,06)
D3) Verdichtung und Erweiterung Fernwärme (1,84)
D4) Mobilitätsberatung (0,76)
D5) Beratung und Information von KMU zur Einführung EMS (0,23)
Praktisch alle Maßnahmen sind in Krefeld umsetzbar!
Auf Krefeld heruntergebrochen allerdings dürfte das Windkraftpotential wegen geringerer Fläche etwas geringer sein (dennoch eine Frage des Willens und der Akzeptanz), das Solarpotential auf privaten Dachflächen dürfte durch Fachkräftemangel nur verzögert umsetzbar sein.
Dafür aber dürfte die Bedeutung der Gebäudesanierung und der Ausbau der Fernwärme in Krefeld von allerhöchster Bedeutung sein (dazu mehr in weiteren Blogs).
Gebäudesanierung und Ausbau der (dekarbonisierten) Fernwärme von hoher Bedeutung!!!
Aber wichtig: Keine der Maßnahmen reicht allein. Alle Maßnahmen sind wichtig, um das Gesamtziel zu erreichen!
Link zur Broschüre: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaschutzmanagement-treibhausgasneutralitaet-in
Detaillierter in: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/kommunales-einflusspotenzial-zur

„Klimaneutral bis 2035? Ich glaube das ist nicht mehr zu schaffen!“
Das hört man oft, wenn man den Beschluss des Krefelder Stadtrates bis 2035 klimaneutral zu werden, lobt. Wie soll man mit dieser Skepsis umgehen?
Ohne Zweifel bedarf es allergrößter Anstrengungen und einer beträchtlichen Umorientierung jeglichen privaten, geschäftlichen und städtischen Handelns in Krefeld, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Resigniert zu seufzen bietet da sicherlich Erleichterung. Denn sonst müsste man ja umdenken und sich auch noch anstrengen.
Man soll die Skepsis aber nicht lächerlich machen. Sie ist ja durchaus berechtigt. Es könnte sein, dass wir das Ziel tatsächlich verfehlen. Es gibt so viele Variablen, dass große Unsicherheiten in beide Richtungen bestehen. Wohlgemerkt: In beide Richtungen. Es ist nichts entschieden. Es hängt von uns ab.
"Wenn wir 1,5°C nicht schaffen, dann eben 2°C – oder 2,5°C. Dann haben wir ja mehr Zeit"...
... so versuchen sich andere zu beruhigen. 1,5°C werden innerhalb der nächsten +/- 10 Jahre erreicht sein, wenn wir nicht sehr entschieden handeln. Mehr Zeit wäre schön. Leider aber sind Naturgesetze nicht verhandelbar. Der Kipp-Punkt für das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes (Folge: Viele Meter Meeresanstieg) wird vermutlich gerade erreicht. Der westantarktische Eisschild kollabiert bei ca. 1,5°C (weitere Meter), die Umwälzströmung der Labradorsee (evtl. auch der Golfstrom) bei ca. 1,8°C (brrr! Dann wird es kalt in Europa – und heißer im Süden). Es folgen der ostantarktische Eisschild, die Versteppung des Amazonas und das Tauen der arktischen Permafrostböden usw.
Über 1,5°C wird es wirklich ungemütlich – und extrem teuer.
Wenn drei riesige Eisschilde abschmelzen (und mit ihrem Eis auch nicht mehr die Sonne reflektieren, beschleunigt sich der Prozess unumkehrbar. Jedes zehntel Grad zählt jetzt. 1,5°C Erderhitzung verändert alles. Das muss einer kritischen Masse an Menschen jetzt klar werden. Man darf jetzt einfach nicht resignieren!!!
Es steckt darin auch eine riesige Chance: Jetzt erst recht!
Denn wenn wir jetzt entschlossen handeln, können wir das Ziel erreichen. Letztlich bremst uns die Skepsis (und das schon seit 30 Jahren). Der Mensch kann, wenn er will: Smartphones waren innerhalb 10 Jahren weltweit verbreitet.
Jetzt ist das Mitwirken von tausenden Privatpersonen und Geschäftsleuten notwendig. Jeder kann etwas tun (von LED-Leuchten und sparsamen Elektrogeräten bis zu Hausdämmung, Photovoltaikanlagen und Heizungserneuerung). Entsprechend entschlossen müssen auch die Forderungen an die Politik sein: Krefeld ist mit einem Startschuss vorangegangen. Jetzt muss die entschlossene Umsetzung folgen. Jeder Schritt muss ausreichend groß und entschieden sein.
Jetzt lohnen sich sogar alle privaten und öffentlichen Investitionen noch. Später wird die Schadensbegrenzung extrem teuer.
Insofern sollten auch die Gesamtkosten nicht schrecken, die in den nächsten Wochen in den Gutachten auftauchen werden. Zum allergrößten Teil sparen wir Kosten, die sonst später unweigerlich zu zahlen sein werden. Die Gaskrise im Ukrainekrieg hat eine Vorschau geliefert. Es wird dann keinen dauernden „Doppelwumms“ geben können, um soziale Verwerfungen zu vermeiden. Eher würde das Ziel aufgegeben und die Katastrophe nähme ihren Verlauf. Wollen wir das? Skepsis macht schwer. Wir müssen beflügelt handeln.
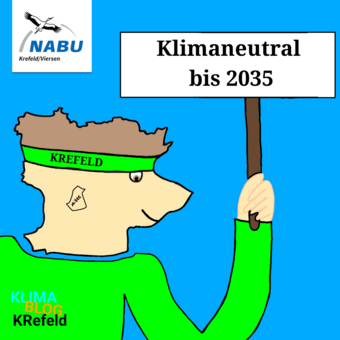
Am 13.12.2022 trugen die Gutachter erste vorläufige Ergebnisse des Berichtes KrefeldKlimaNeutral 2035“ vor. Die 59 Folien enthielten zwar viele Daten, waren aber noch sehr bruchstückhaft. In den folgenden Zeilen soll eine sehr grobe Inhaltsangabe versucht werden.
Das Gutachten gliedert sich in sechs Unterpunkte:
1+2) Einleitung und Treibhausgasbilanz – mit kleinem Haken:
Es wird von einem Gesamtenergiebedarf Krefelds von 5,4 Terawattstunden/Jahr ausgegangen (Bezugsjahr 2021, in 2010 waren es noch 7 Terawattstunden).
Das entspricht einer Kohlendioxidemission in 2021 von 6,86 Tonnen CO2 pro Einwohner (2010 waren es 9,95 Tonnen).
Aber Vorsicht: Aus den Zahlen sind die Verbräuche der "ETS-Betriebe" herausgerechnet. Das sind diejenigen Großbetriebe, die direkt am EU-Emissionszertifikatehandel teilnehmen (siehe Blog „Warum reicht es nicht...“ vom 11.1.2023). Da Krefeld mehrere dieser Großbetriebe hat, sind sie zusammen für über die Hälfte des Krefelder Energieverbrauches verantwortlich. Mit den Betrieben zusammen verdoppeln sich also die obigen Energieverbrauchsmengen (Gesamtverbrauch mit ETS-Betrieben in 2021: Knapp 12 Terawattstunden/Jahr).
3) Wärmewende – der dickste und schwierigste Batzen:
Der Wärmebereich ist mit 3,5 TWh der größte Verbraucher (über 50%). Es werden zwei Pfade beleuchtet.
- „All electric“-Szenario, bei dem durch intensive Dämmung und andere Sanierungsmaßnahmen der Wärmeverbrauch der Gebäude deutlich gesenkt wird und heizungstechnisch, neben Ausbau der Fernwärme, in weiten Bereichen eine Umstellung von fossilen Brennstoffen auf elektrische Wärmepumpen erfolgt. Die Sanierungsrate (Wärmedämmung) soll dabei von aktuell rund 1% des Gebäudebestandes pro Jahr auf 5% (!!!) pro Jahr angehoben werden.
- H2-Szenario, bei dem die Sanierungsrate nur auf 2,5% angehoben wird und in weiten Bereichen Wasserstoff als Brennstoff für die Heizung bzw. Fernwärme zum Einsatz kommt.
Vorsicht: Der NABU hält für extrem unwahrscheinlich, dass es bis 2035 ausreichend Wasserstoff geben wird – insbesondere nicht zu Heizzwecken.
4) Mobilitätswende – kleinster Posten aber nicht einfach:
Der Verkehr verursacht ca. 16% der klimawirksamen Emissionen in Krefeld. Hauptmaßnahmen sind Umstieg auf treibhausgasfreie Energieträger (v.a. Strom) sowie Bahn und Rad.
5) Stromwende – Sparen, Sparen, Sonne, Sonne, Sonne, Wind:
Der Strombereich verursacht 26% der klimawirksamen Emissionen. Bei den erwähnten Maßnahmen stehen Effizienzsteigerungen sowie massiver Ausbau der Photovoltaik im Vordergrund (Dachflächen, Parkplätze, Freiflächen, Agri-PV uva.). Auch die Windkraft soll ausgebaut werden. Extern bezogener Strom soll treibhausgasfrei sein.
6) Handlungskonzept – wann, was, wie und wie teuer?:
In diesem Abschnitt werden die Maßnahmen nochmals zusammengefasst und in Zeitabschnitte und Handlungsstränge aufgeteilt. Es wird geschätzt, dass Gesamtinvestitionsmittel von 15 Milliarden Euro erforderlich sein werden (ganz wesentlich private Investitionen). Wieviel davon die Stadt selbst aufbringen, bzw. durch Fördermittel einwerben muss, konnte noch nicht abgeschätzt werden. Es werden im Verlauf etwa 20-40 neue Stellen bei der Stadt benötigt. Allerdings erhofft man sich abschließend auch die jährliche Einsparung von über 70 Mio. Euro im Stadthaushalt.
Fazit: Erst einmal schauen, was im Endbericht steht!
Inhaltlich könnte man zu vielen Punkten etwas sagen. Im Verlauf des Blogs werden einige Punkte auch noch intensiver beleuchtet werden. Eine endgültige Einschätzung der Wirksamkeit der Maßnahmen wird aber sicherlich erst bei Vorlage des endgültigen Gutachtens voraussichtlich Anfang Februar 2023 möglich sein.

Dazu muss man zunächst wissen was die EU-Deckelung der Emissionen ist und was sie zur Folge hat. Der Europäische Emissionshandel (EU-ETS) ist seit 2005 das zentrale Klimaschutzinstrument der EU. Mit ihm sollen die Treibhausgas-Emissionen der Energiewirtschaft und der energieintensiven Industrie reduziert werden. Seit 2012 nimmt zusätzlich der innereuropäische Luftverkehr teil. Ab 2027 sollen auch Verkehr und Gebäudeheizung hinzukommen.
Emittenten müssen für jede Tonne emittierten Kohlendioxids den Besitz von entsprechenden Emissionszertifikaten nachweisen. Die Zertifikate können käuflich erworben und untereinander gehandelt werden. Die Gesamtzahl der Zertifikate wird jährlich reduziert (um rund 4,4 %). Dadurch sinkt die jährliche CO2-Emission. Gleichzeitig steigt der Preis für jede emittierte Tonne CO2.
Da damit ja offenbar „automatisch“ die Emissionen sinken, könnte sich die Frage stellen, warum man seitens der Stadt und der Bürger überhaupt initiativ tätig werden sollte.
Wenn der erhoffte Erfolg also scheinbar"von selbst" kommen würde, könnte man dann nicht einfach warten?
Für umgehendes, eigeninitiatives Handeln gibt es aber eine Vielzahl von Gründen. Um nur einige zu nennen:
1) Mit der jährlichen Reduzierung der Emissionsrechte steigt der Preis für Energie. Was das für Folgen haben würde, konnte man 2022 sehen, als die Preise für Strom und Gas sprunghaft stiegen und die Bundesregierung mit milliardenschweren Programmen Notlagen und Unruhen verhindern musste. Den Verbrauch rechtzeitig zu senken und auf emissionsfreie Energien umzuschwenken ist also das Gebot der Stunde. Nur so können soziale Verwerfungen zu späterem Zeitpunkt, wenn die Preise unweigerlich steigen, vorausschauend verhindert werden (besondere Betroffenheit von geringeren Einkommen).
Uff, warten wird am Ende teuer - besonders für einkommensschwache Familien!
2) Man sieht auch schon heute, dass die Wartezeiten für den Einbau alternativer Energiequellen hoch sind. Mit steigenden Energiepreisen wird in den 30er Jahren die Nachfrage nochmals explodieren. Alle gleichzeitig können dann nicht bedient werden.
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! - und hat seine Solaranlage zeitgerecht auf dem Dach!
3) Das gilt auch für die Verfügbarkeit von Fachkräften für Stadtverwaltung, städtische Betriebe und Unternehmen. Schon heute sind die Angebote knapp. Wenn erst einmal alle Städte aus Kostengründen auf die Idee kommen, Energiekonzepte umzusetzen, wird der Markt leer sein.
Wenn die Fachleute in Essen, Köln und Duisburg angeheuert sind, guckt Krefeld in die Röhre!
4) Die Stadt, die frühzeitig lokal saniert und nachhaltige Energiesysteme schafft, sichert sich Wertschöpfung vor Ort (lokale Planer, Handwerker, Betreiber, Zulieferer etc.). Diese können später auch umliegende Bereiche bedienen. Wenn man spät kommt, sieht es umgekehrt aus! Der Wohlstandsgewinn durch lokale Wertschöpfung kann geschätzt werden. Die Stadt Bonn erwartet z.B. 123 Mio. Euro zusätzliche Unternehmensgewinne und ein- bis zweitausend zusätzliche Stellen (siehe später folgender Blog-Beitrag). Hinzu kommen die Ersparnisse durch geringere zukünftige Energiekosten für alle.
Wir haben ferne Länder für Öl und Gas bezahlt. Wollen wir das auch mit Sonne und Wind so halten? Oder selbst daran verdienen?
5) Für den Klimaschutz im Allgemeinen ist es wichtig, dass es Städte gibt, die voran gehen, dadurch motivieren, beispielhafte Lösungen präsentieren und letztlich beweisen, dass wirksamer Klimaschutz möglich ist.
Irgendwer muss anfangen - warum nicht wir? Wenn es sogar handfeste Vorteile bringt!!!
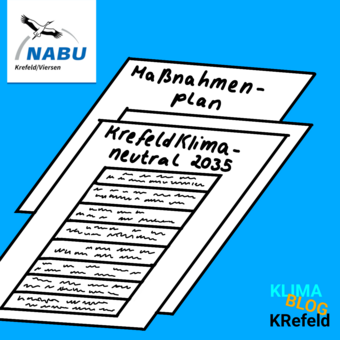
Wie im obigen „Rückblick“ dargestellt, entschied die Politik per Beschluss im Klima-Ausschuss am 18.2.2021 (bestätigt nochmals durch Ratsbeschluss am 16.11.2022), die Zielsetzungen des Klimakonzeptes Krefeld (KrefeldKlima 2030) zu verschärfen, um Klimaneutralität bereits 2035 zu erreichen. Sie forderte das Gutachtertrio von "KrefeldKlima 2030" (Infrastruktur&Umwelt, Wertsicht, Drees&Sommer) auf, einen entsprechend verschärften Maßnahmenplan zu erarbeiten.
Die Politik hat in Krefeld also reagiert und einen Rettungsplan auf den Weg gebracht!
Das Gutachten sollte ursprünglich im Mai 2022 vorliegen, benötigte aber mehr Zeit. Am 13.12.2022 erfolgte eine Darstellung erster, vorläufiger Ergebnisse vor dem Klima (Umwelt)- und dem Planungsausschuss sowie dem Landschaftsbeirat. Dabei wurde folgender Zeitplan vorgelegt:
20.12.2022: Online-Beteiligung der Politik, um Rückfragen zu klären
9.1. bis 27.1.2023: Einarbeitung von Anregungen aus Politik und Verwaltung
27.1.2023: Vorlage des Entwurfes eines Endberichtes bei der Stadt
28.1. bis 2.3.2023: Abstimmung des Endberichtes, Überarbeitung und Fertigstellung
2.3.2023: Abgabe des abgestimmten Endberichtes bei der Stadt Krefeld
Nach 2.3.2023: Beteiligung Verwaltungsvorstand
1. Halbjahr 2023: Erarbeitung der Sitzungsvorlage für Klima- und Planungsausschuss
1. Halbjahr 2023: Beratung in den Gremien und abschließender Ratsbeschluss
Nach diesem weisen Anfangsbeschluss muss unbedingt an Ziel und Zeitplan festgehalten werden!!! Weitere Verzögerungen können wir uns nicht leisten!

Zunächst galt in Deutschland das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Nach Urteil des Bundesverfassungsgerichtes reichte das aber nicht aus, um zukünftige Lebensgrundlagen zu schützen. Deshalb wurde das Ziel in einem Kompromiss auf 2045 vorverlegt.
Das Verfassungsgericht hat Deutschland also schon gerügt und strengere Ziele gefordert!
Reicht 2045 denn immer noch nicht aus? Das Expertengremium „Intergovernmental Panel on Climate Change“, welches die weltweiten wissenschaftlichen Ergebnisse immer wieder aktuell zusammenfasst, hat Ende 2022 einen Bericht herausgegeben („Global warming of 1,5°C“). Auf 631 Seiten wird die Wichtigkeit der Begrenzung des globalen Temperaturanstieges auf unter 1,5°C nochmals ausführlich diskutiert und belegt.
Der Temperaturanstieg beträgt derzeit ca. 0,2°C pro Dekade. Aktuell liegt die Temperaturerhöhung bereits bei ca. 1,2°C. D.h. im Laufe der nächsten Dekade werden wir das Limit von 1,5°C überschreiten, wenn nicht weltweit die Emissionen drastisch reduziert werden.
Die eben noch tolerable Temperaturerhöhung von 1,5°C wird also wahrscheinlich schon vor 2040 überschritten werden!
Mit steigender Temperatur steigen die klimabedingten Risiken und die Kosten für deren Bekämpfung. Ein Anstieg der Temperatur über 1,5°C hinaus würde zu einer deutlichen Erhöhung der Risiken führen. Beispielsweise wären die Hitzeperioden länger und die Hitzespitzen deutlich höher, die Hitzetoten nähmen zu. Bei 2°C Temperaturerhöhung stiege das Meer bis 2100 um zusätzliche 10 cm mehr an (für Küstengebiete verhehrend). Dürren und Starkregenereignisse wären deutlich häufiger.
Schon bei einem Temperaturanstieg von 1,5°C sind vielerorts starke Beeinträchtigungen des Lebens nicht mehr vermeidbar: Küstenüberschwemmungen, Probleme in arktischen Regionen (Gebäude, Pipelines etc. sinken in tauenden Permafrostboden), Beeinträchtigungen der Fischerei und seltener Biotope, Hitzefolgen, Starkregenereignisse uva.
Der Klimabericht des IPCC zeigt auch auf, dass die Reduzierung der klimaschädlichen Emissionen rasch erfolgen muss. Wichtig nämlich: Auch kurze Überschreitungen des 1,5°C Zieles würden erhöhte Schäden auslösen und schädliche Kausalketten in Gang setzen. Auch wenn eine Rückkehr unter 1,5°C anschließend gelingt, sind diese nicht mehr umkehrbar (Kipp-Punkte). Um ein solches Überschießen der Temperatur zu vermeiden, ist laut IPCC schon vor 2030 (!!!) eine deutliche Reduzierung der weltweiten Emissionen notwendig.
Wir müssen also sofort beginnen, sonst kommt der Stein ins Rollen!
Die Temperaturerhöhung kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit unter 1,5°C gehalten werden, wenn Krefeld, Deutschland und die Welt mit ihren Emissionen ein errechenbares Restbudget einhalten. Dieses Ziel wird aber bei den aktuell von der Weltgemeinschaft angestrebten Emissionsminderungen deutlich verfehlt.
Nachdem wir über 30 Jahre wider besseres Wissen munter weiter emittiert haben, ist unser Restbudget erschreckend klein! Es reicht keinesfalls bis 2045 oder gar 2050!
Wir alle müssen also umgehend mit wirksamem Klimaschutz beginnen. Erfreulicherweise verschreiben sich mehr und mehr Städte in Deutschland und weltweit dem 2035-Ziel. Wie im übernächsten Beitrag dargestellt, hat es zudem zahlreiche weitere Vorteile, so früh wie möglich zu handeln.
Je mehr Städte mitmachen, um so besser!
Seit den 80er Jahren gibt es in Krefeld einzelne Bestrebungen, Klimaschutz zu intensivieren. 1991 veranstaltete der NABU zusammen mit den SWK einen Stromsparwettbewerb. Die SWK bewarben in kleinem Umfang Klimaschutzmaßnahmen (Photovoltaikanlagen etc.). Zeitweise gab es bei der Stadt auch einen Klimabeauftragten. Energiesparen erfolgte aber in erster Linie im Rahmen finanzieller Sparmaßnahmen.
Ende der 90er Jahre wurde ein Energiegutachten auf den Weg gebracht, welches den Energieverbrauch Krefelds analysierte und verschiedene Entwicklungsszenarien darstellte. Diese beinhalteten aber keine sehr weitreichenden Empfehlungen zur Energieeinsparung. Politisch stießen sie ebenfalls keine wesentlichen Entwicklungen an. Es erfolgten spätere Fortschreibungen.
Gezielterer Klimaschutz begann in Krefeld mit "KrefeldKlima 2030":
Am 1.12.2018 hatte die Stadt Krefeld eine Bietergemeinschaft aus drei Gutachtern mit der Erstellung eines „integrierten Klimaschutzkonzeptes“ beauftragt. Das fertige Konzept beinhaltete Maßnahmenempfehlungen bis 2030. Die Umsetzung wurde am 23.6.2020 durch den Rat der Stadt Krefeld beschlossen. Sie hatte Klimaneutralität bis 2050 zum Ziel.
Das Konzept enthielt eine Vielzahl von Empfehlungen für Maßnahmen zu Klimaschutz, Klimafolgenanpassung sowie damit verbundene Aktivitäten der Stadt. In der Folge wurden zwei Planstellen für das Klimaschutzmanagement geschaffen und besetzt, die der „Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ im Geschäftsbereich VI, "Umwelt und Verbraucherschutz, Soziales, Senioren, Wohnen und Gesundheit" zugeordnet sind. Mit der Planung und Umsetzung verschiedener Einzelmaßnahmen wurde begonnen.
Das reichte bei weitem nicht! 2021 wurde deshalb Ernst gemacht:
Die fortschreitenden globalen Klimaveränderungen und deren immer deutlichere Folgen, die alarmierenden wissenschaftlichen Erkenntnisse (Kipp-Punkte, schwindendes Rest-Emissionsbudget zur Einhaltung des 1,5 Grad-Zieles) und die zunehmenden Forderungen aus der Bevölkerung (in Krefeld z.B. Demonstration von „Fridays-for-future“ im März 2019 mit mehreren tausend Teilnehmern) erforderten mehr. Nun hielt auch die Politik in Krefeld (nach den Wahlen 2020) die bisher beschlossenen Zielsetzungen für unzureichend. Am 18.2.2021 beschloss der Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft, dass Krefeld bereits bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden sollte. Das Projekt „KrefeldKlimaNeutral 2035“ wurde ins Leben gerufen. Die Gutachter des Vorgutachtens (KrefeldKlima 2030, s.o.) wurden beauftragt, gemeinsam mit der Stadt Krefeld einen Maßnahmenplan für die Erreichung dieses verschärften Zieles zu erarbeiten.
Am 13.12.2022 wurden die ersten vorläufigen Ergebnisse des Gutachtens mehreren Krefelder Gremien in einer gemeinsamen Sitzung vorgestellt. Ein Erreichen der Klimaneutralität bis 2035 ist danach möglich, wird aber intensivste Anstrengungen von allen Krefeldern erfordern.
Klimaneutralität in Krefeld ist möglich, wenn alle mitmachen!!!

Keinen Beitrag verpassen. Abonnieren sie unseren Newsletter
Newsletter abonnieren